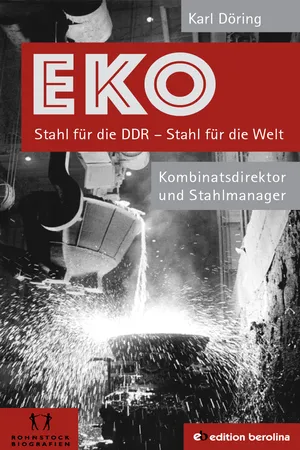![]()
Mehrere Eisen im Feuer – auf Partnersuche im Stahlpoker
Einer war zu viel in der bundesdeutschen Stahlwirtschaft. Das sollte EKO sein. Keiner der westdeutschen Stahlkonzerne hatte auf uns gewartet. Im Gegenteil: 1990 waren sie nur zu etwa achtzig Prozent ausgelastet. Mit ihren freien Kapazitäten hätten unsere »Kollegen« aus dem Westen nur zu gerne unseren Markt bedient – jährlich acht Millionen Tonnen Walzstahl hatte die DDR zuletzt produziert, 90 000 Kumpel waren an siebzehn Standorten beschäftigt. Nichts wäre ihnen lieber gewesen, als all das verschwinden zu sehen.
Keine gute Ausgangssituation, um einen Betrieb zu einem angemessenen Preis an den Mann zu bringen … Dennoch versuchte die Treuhand genau das: uns auf einen übersättigten Markt zu werfen! Dabei hätte ihr Präsident Rohwedder, der sich als ehemaliger Stahlmanager bestens in der Branche auskannte, ein Machtwort sprechen und fordern müssen, die ostdeutsche Stahlindustrie zunächst in einer Staatsholding zusammenzuführen. Innerhalb weniger Jahre wäre es möglich gewesen, sie zu restrukturieren. Gewiss, es hätte einen spürbaren Abbau von Personal und Produktionsumfang gegeben, aber die ostdeutsche Stahlindustrie wäre nicht verschleudert worden und hätte bei der anschließenden Privatisierung einen guten Kaufpreis erzielt.
Obwohl die Konzepte zur Privatisierung von Staatsunternehmen in vielen westdeutschen Schubladen lagen, blieb die Treuhand ihrer Devise treu: schnell privatisieren, schnell verkaufen. Niemand kam auf die Idee, uns nach dem Vorbild der Salzgitter AG in die Marktwirtschaft zu entlassen, die erst ein Jahr vor Treuhandgründung endgültig privatisiert worden war. Viele Jahre hatte sich der westdeutsche Konzern in Staatsbesitz befunden. Auch der Stahlgigant British Steel agierte bis in die Achtzigerjahre noch als Staatsunternehmen.
Die westdeutschen Stahlwerke steckten zur Wendezeit in einem über fünfzehn Jahre andauernden Fusionspoker, bei dem es praktisch jeder mit jedem versuchte. In diesem Prozess erhielten die Stahlkonzerne in den Jahren 1982 und 1983 bis zu fünf Milliarden D-Mark an staatlichen Subventionen, um die Branche neu zu strukturieren. 1984 und 1985 kamen weitere drei Milliarden D-Mark an öffentlichen Mitteln hinzu. Staatskonzerne in der Stahlindustrie gehörten über Jahrzehnte selbstverständlich zur Marktwirtschaft, ebenso wie die Vergabe öffentlicher Fördergelder zwecks ihrer Restrukturierung und Privatisierung. So wurde etwa die gesamte französische Stahlindustrie 1986 verstaatlicht und in einen Staatskonzern zusammengeführt, um sie neu zu strukturieren und schließlich erneut in private Hände zu übergeben: Seit 1995 firmiert der Konzern als Usinor Sacilor.
Bezüglich der ostdeutschen Stahlwirtschaft wurden solche Übergangsprozesse nicht einmal ansatzweise in Erwägung gezogen. Stattdessen ließ man uns – in jeglicher Hinsicht benachteiligt – ins offene Messer einer nunmehr ihres regulierenden Counterparts beraubten und mithin umso rücksichtsloser agierenden Marktwirtschaft rennen.
Benachteiligt, weil unsere Betriebe nur fünfzig Prozent der westdeutschen Produktivität erreichten. Weil wir uns mit der IG-Metall plötzlich einem Gewerkschaftsverbund gegenüber sahen, der uns – trotz ständig rückläufiger Aufträge – mit immens hohen Lohnforderungen überrollte und damit zugleich dafür sorgte, dass wir keinen Wettbewerbsvorteil gegenüber den westlichen Unternehmen erzielten. Weil wir – und das war vielleicht der schwerwiegendste Nachteil – den wirtschaftlichen Irrsinn der Altkredite zu tragen hatten.
Diese Kredite hatten, so war die übliche Verfahrensweise, die ostdeutschen Betriebe vor der Wende bei der Staatsbank der DDR aufgenommen, um ihre Wirtschaftstätigkeit zu gewährleisten, da der erwirtschaftete Gewinn fast gänzlich an den Staat abgeführt wurde. Bereits in früheren Debatten um Wirtschaftsreformen in der DDR war die Frage aufgeworfen worden, wie die Kombinate vom Joch der Staatsbankkredite erlöst werden könnten. Doch Günter Mittag und seine Mitstreiter hatten sich gegen eine größere ökonomische Selbstständigkeit der volkseigenen Betriebe gesträubt. Das sollte uns nun bitter zu stehen kommen …
In der ersten Sitzung des Verwaltungsrates der Treuhandanstalt hatte ich mich gemeinsam mit einigen Kollegen bereit erklärt, das Problem der Altkredite der Kombinate zu analysieren und Lösungsvorschläge zu unterbreiten. Denn mit der Wirtschafts- und Währungsunion vollzog sich eine wundersame Wandlung dieser Kredite. Aus der Staatsbank, bei der das EKO und die anderen Betriebe in der Schuld standen, gründete sich einen Tag nach der Märzwahl 1990 die erste private Geschäftsbank der DDR aus, die Deutsche Kreditbank AG. Zu ihr wanderten unsere Kreditschulden. So stand uns über Nacht, ohne dass wir je gefragt wurden, ein neuer, privater Kreditpartner gegenüber. Die „Privatisierung“ der Staatskredite ging ohne eine entsprechende Regelung der Volkskammer vonstatten, eine völlig verantwortungslose und im Grunde unzulässige Verfahrensweise.
Im nächsten Schritt gründete die Kreditbank Joint-Venture-Institute mit der Deutschen Bank und der Dresdner Bank. Nach der Vereinigung im Oktober 1990 gingen die Joint-Venture-Banken bald in ihren Stammhäusern auf. Plötzlich hatten wir Kreditschulden bei westdeutschen Großbanken, die nie eine müde Mark an uns ausgereicht, nie einen Finger für uns krumm gemacht hatten. Und damit nicht genug: Uns sollten nunmehr marktübliche Zinsen berechnet werden – zur Jahreswende 1990/91 unglaubliche zehn Prozent! Die Staatsbankkredite hatten wir zu einem bis maximal zweieinhalb Prozent erhalten.
Mein Freund Edgar Most, der letzte Vizepräsident der DDR-Staatsbank, schildert in seinem Buch ausführlich, wie sich dieser Vorgang aus Sicht der Bank darstellte und hält alles, was da passierte, für richtig. Einschließlich der Tatsache, dass die Banken sich für die geschenkten Kredite beim Staat schadlos halten konnten, wenn die Unternehmen zahlungsunfähig wurden! Für die Unternehmen, die seine Darstellung leider auslässt, war dieser Bankendeal vollkommen inakzeptabel. Keines der Kombinate war in der Lage, derartige Kredite zurückzuzahlen. Für die EKO Stahl AG schlugen diese mit 1,2 Milliarden D-Mark zu Buche. 1991 hätten wir beim aktuellen Zinssatz 120 Millionen D-Mark allein für die Zinsen berappen müssen.
Vier Wochen nach der Währungsunion legten wir auf der zweiten Verwaltungsratssitzung ein Papier zu den Altkrediten aus der Sicht der Unternehmen vor. »Unverzüglich sollte ein Moratorium für Tilgung und Zinszahlung auf Altkredite ausgesprochen werden«, empfahlen wir.
Claus Köhler, Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, schreibt in seinem Gutachten vom 6. August 1990: »Die Altkredit-Schulden belasten die Betriebe in der DDR erheblich. Sie sollten zumindest teilweise gestrichen werden. Das ist gerechtfertigt, da diese Schulden durch die in der Planwirtschaft angeordneten Geldabführungen an den Staat ohne Rücksicht auf die Ertragslage entstanden sind. Diese Altkredit-Schulden der Betriebe spiegeln daher teilweise eine Staatsschuld wider. Die Treuhandanstalt sollte einen grundsätzlich für alle Betriebe geltenden Prozentsatz der Altkredit-Schulden festsetzen. In dieser Höhe werden Altkredit-Schulden gestrichen. […] Je mehr Altkredit-Schulden gestrichen werden, desto höher werden die Privatisierungserlöse sein. Die Werterhöhung der Betriebe spiegelt sich im Wert der B...