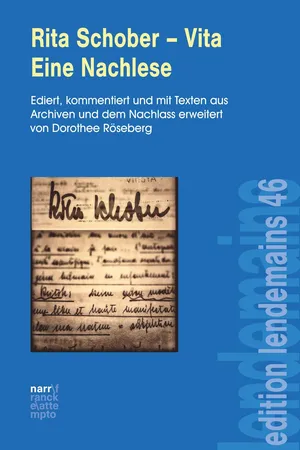
eBook - ePub
Rita Schober - Vita. Eine Nachlese
Ediert, kommentiert und mit Texten aus Archiven und dem Nachlass erweitert von Dorothee Röseberg
- 366 pages
- English
- ePUB (mobile friendly)
- Available on iOS & Android
eBook - ePub
Rita Schober - Vita. Eine Nachlese
Ediert, kommentiert und mit Texten aus Archiven und dem Nachlass erweitert von Dorothee Röseberg
About this book
Sie stehen noch in vielen Bücherschränken: die deutschen Ausgaben der Rougon-Macquart von Émile Zola mit den Nachworten von Rita Schober. Aus Anlass des 100. Geburtstages der international bekannten Romanistin und Zolaforscherin erscheint erstmals ihre Vita. Wer war diese Frau, die fünf Staatsbürgerschaften hatte, die großen politischen Umbrüche des 20. Jahrhunderts erleben musste und in der DDR als eine der ersten Frauen Professorin wurde? Wie erinnert sie selbst nach 1989 ihr Leben? Dieses Selbstzeugnis wird mit bislang unveröffentlichten Dokumenten aus ihrem Nachlass und aus Archiven konfrontiert und kommentiert. Dabei geht es um die Frage: Wie schreibt man sein Leben nach tiefgreifenden gesellschaftlichen Brüchen?
Frequently asked questions
Yes, you can cancel anytime from the Subscription tab in your account settings on the Perlego website. Your subscription will stay active until the end of your current billing period. Learn how to cancel your subscription.
No, books cannot be downloaded as external files, such as PDFs, for use outside of Perlego. However, you can download books within the Perlego app for offline reading on mobile or tablet. Learn more here.
Perlego offers two plans: Essential and Complete
- Essential is ideal for learners and professionals who enjoy exploring a wide range of subjects. Access the Essential Library with 800,000+ trusted titles and best-sellers across business, personal growth, and the humanities. Includes unlimited reading time and Standard Read Aloud voice.
- Complete: Perfect for advanced learners and researchers needing full, unrestricted access. Unlock 1.4M+ books across hundreds of subjects, including academic and specialized titles. The Complete Plan also includes advanced features like Premium Read Aloud and Research Assistant.
We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.
Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.
Yes! You can use the Perlego app on both iOS or Android devices to read anytime, anywhere — even offline. Perfect for commutes or when you’re on the go.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Yes, you can access Rita Schober - Vita. Eine Nachlese by Dorothee Röseberg in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in Literature & Literary Criticism for Comparative Literature. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.
Information
TEIL I VITA – EINE NACHLESE
Editorischer Kommentar
Am 23. Mai 2014 übergab mir Wolfgang Klein 58 Dateien mit dem Vermerk ‚Vita’, die er in dem privaten Nachlass Rita Schobers, gemäß einer früheren Absprache mit dieser, auf deren PC nach ihrem Tod gesichert und übernommen hatte.
Die ursprüngliche Konzeption ihrer Vita hat Rita Schober in einem Brief formuliert, den sie am 12. September 2006 an Wolfgang Asholt geschrieben hatte. Hier der Wortlaut des Briefes, der als eines der 58 Dokumente überliefert ist:
„Berlin, den 12. September 2006
Lieber Herr Asholt,
ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie freundlicherweise meine Überlegung prüfen wollen. Vielleicht lassen sich so die verschiedenen Ansätze besser unter einen Hut bringen.
Nachfolgend mein Vorschlag:
Titel : Nachlese
Inhalt:
Korrespondenzen:
- Klemperer / Hg. Wolfgang Klein
- Krauss / Hg. Karlheinz Barck
Zola:
- Einleitung: erweitertes und annotiertes Geleitwort (aus digitaler Version Direkt-Media), d.h.: Einbeziehung der wesentlichen Nachwortkorrekturen und zusätzlich neu der für Zola besonderen Übersetzungsprobleme, kleine Ergänzung der schon angesprochenen theoretischen Grundlagen. (Ich habe diese Ergänzungen aufgesprochen für ein Interview auf Band).
- Nachwort zu Nana, annotiert
- Nachwort zur Erde (gekürzt u. annotiert)
Meine vita als Romanistin:
Erzählt aus dem Rückblick und der Erinnerung, ich habe keine Tagebuchnotizen (wie mein Lehrer Klemperer), also nicht nur Fakten nach Akten
1. Les origines = Die Studienzeit in Prag (fertig, bis auf kleine Korrekturen)
2. Die Grundlagen meines wissenschaftlichen Werdegangs und meine Arbeit als Hochschullehrerin:
- Grundlagen: Klemperer = literarhistorisch; Kleinmachnow-Lehrgang = marxistisch-theoretisch; mein Mann Robert: politisch; Jakobson (Begegnung in Rumänien) = literaturtheoretisch (Strukturalismus)
- Wissenschaftliche Anregungen durch AILC = Konferenzen, Vorträge, Funktionen
- Die Berliner Jahre als Institutsdirektor (1957-1969), die Konferenzen des Instituts
- Kurzer Ausblick auf die letzten Jahre (als Dekan und Emerita, 1970 -1989)
3. Begegnungen und Erlebnisse einer allein reisenden Professorin
- wissenschaftliche Auslandskontakte und Gastvorlesungen in: Polen, Rumänien, Moskau, Paris, Aix-en-Provence (Raimond Jean), Bordeaux (Escarpit). Nur kurz Bedingungen der Reisen: travel-board = presumed-german, Geldreserve = 5 DM, Flug: festgelegte Linie: not to be tanslated, keine Versicherungen, keine Botschaft, Geldanweisungen nur für eine bestimmte Bank, Streiks = geschlossen, was nun? Nur kurze Hinweise
- Die Auslandssemester: Moskau 1970, Graz 1984, das Zola-Wochenend-Kolloquium bei Neuschäfer in Saarbrücken 1984 = Erfahrungen mit den Kollegen, den jeweiligen Bedingungen der Arbeit und Eindrücke von den Studenten. Tragender Teil dieses Abschnitts
4. Le tournant
Konferenz in Akademie 1989 zum 200. Gedenktag der französischen Revolution mit anschließender Teilnahme an der Protestkundgebung vor dem ZK mit Claudon und Manfred Naumann, und den Forderungen nach Rücktritt des Politbüros. Heimweg mit Claudon, der Anfang vom offiziellen Ende der DDR
Neue Freunde und neue wissenschaftliche Eindrücke und kleine Aktivitäten
Lieber Herr Asholt,
hoffentlich bekommen Sie nun keinen Schreck. Prag lege ich dem jetzigen Entwurf bei, denn Sie müssen sich ja ein Bild machen können. Im Wesentlichen sollte er nach meiner Meinung so bleiben. Die Vita meines eigentlichen Lehrers Preißig muß ich noch ergänzen, aber ich habe bereits die Daten und wollte jetzt nicht mit der Korrektur anfangen. Ich muß auch noch etwas bei Hausmann nachsehen.
Ein Grund für diesen Vorschlag ist unter anderem die Geschichte der DDR-Romanistik von Gerdi Seidel. Ich glaube, sie ist eine Hausmann-Schülerin und war auch bei mir zu einem Gespräch. Aber einiges scheint mir doch der Korrektur bedürftig.
Egal wie die Entscheidung ausfällt – es kann ja sein, dass der Verlag diese Mischart für grundsätzlich ungeeignet für seine Zwecke erachtet – dann bleibt es eben bei der Publikation der Korrespondenzen in der Zeitschrift, wenn es Ihnen recht ist.
Übrigens, die historisch-politischen Einschübe bei dem Prag-Teil schienen mir wegen der allgemeinen Unkenntnis dieser Geschichte notwendig, für die Zeit danach kann ich auf die inzwischen reichlich erschienenen historischen Arbeiten über die DDR einfach verweisen, falls es notwendig sein sollte für irgendein Detail.
Lieber Herr Asholt, nochmals herzlichen Dank für das heutige Gespräch und hoffentlich taucht die Karte noch auf. Ich habe in meinem Notizbuch nachgesehen, sie war bei dem ersten Kartenschwung dabei!
Ihnen und Ihrer lieben Gattin, alles Gute und ganz liebe Grüße
Ihre
Rita Schober“
Für die Vita als Romanistin hatte Rita Schober der Konzeption zu Folge vier Kapitel vorgesehen. Von ihnen liegt lediglich das erste vollständig vor. Es ist das älteste der 58 Dokumente und mit dem Jahr 2006 datiert. Wie aus dem Nachlass hervorgeht, hat sich Rita Schober seit dem Jahr 2000 mit dem Gedanken befasst, ihre Vita zu schreiben. Da 2006 das erste Kapitel vorliegt, ist davon auszugehen, dass sie in den letzten zehn bis zwölf Jahren ihres Lebens an ihr geschrieben hat. Mit Ausnahme des ersten Kapitels sind alle anderen unvollständig geblieben. Die Texte lassen sich den vorgesehenen Kapiteln wie folgt zuordnen:
Vier Texte zu Kapitel 1: Les origines, neun Texte zu Kapitel 2: Die Grundlagen meines wissenschaftlichen Werdegangs und meine Arbeit als Hochschullehrerin, zwanzig Texte zu Kapitel 3: Begegnungen und Erlebnisse einer allein reisenden Professorin und zehn Texte zu Kapitel 4: Le tournant.
Weitere fünfzehn Texte gehen über die Konzeption hinaus. Es handelt sich dabei in der Mehrzahl um Lebensläufe, die Rita Schober für verschiedene Publikationen angefertigt hat, um Verträge zu ihrer Nachlassbibliothek mit der Universität Potsdam und um Interviews. Die Interviews werden als ein fünftes Kapitel veröffentlicht.
Zum Abdruck kommen in der vorliegenden Vita also nicht alle 58 Texte, weil innerhalb dieser verschiedene Varianten von Dopplungen enthalten sind: Vorarbeiten, Ergänzungen, einfache Kopien und Wiederholungen, die sich aus Mehrfachverwendungen von Texten und Textteilen ergeben. Es erfolgte ein gründlicher Vergleich aller verschiedenen Textvarianten mit dem Ziel, alle Textfragmente der Vita zu erhalten und zu datieren. In den folgenden Kapiteln sind die editorischen Kommentare kursiviert.
1. Les origines oder der schwierige Anfang
Hierbei handelt es sich um die letzte Fassung vom 18.5.2009, die identisch ist mit einem Text vom 9.2.2008, bis auf einen Satz, der als Fußnote eingeschoben wird. Der Text vom 15.7.2006 wird durch die vorliegende Fassung vom 18.5.2009 lediglich ergänzt, bleibt jedoch weitgehend die Grundlage.
Die allgemeinen Voraussetzungen, die für einen Mensch bei seiner Geburt gegeben sind, kann sich niemand aussuchen. Zeit, Ort, Sprache, Land, die konkrete historische Situation, in die ein Kind hineingeboren wird, können sein späteres Leben entscheidend beeinflussen.
Ich wurde am 13. Juni 1918, in den letzten Wochen des Ersten Weltkrieges, in Rumburg, einer nordböhmischen, direkt an der Grenze zum Deutschen Reich gelegenen Kleinstadt geboren. Zu diesem Zeitpunkt gehörten die von Deutschen besiedelten Randgebiete Böhmens, die später unter dem Namen Sudetenland mehr unrühmlich als rühmlich in die Geschichte eingegangen sind, noch zu Österreich-Ungarn, schon wenige Monate später jedoch zu dem neu gegründeten tschechoslovakischen Staat.1 Dessen Führung lag mit Thomas G. Masaryk als Präsidenten und Edvard Benes als Außenminister in den Händen der tschechischen Nationalität. Und angesichts des prozentualen Verhältnisses zwischen den verschiedenen Volksgruppen und der Einbeziehung der deutschen Gebiete in diesen Staat gegen den Willen der dortigen Bevölkerung2 bestand von Anfang an die Gefahr neuer nationaler Auseinandersetzungen zwischen dem deutschen und dem tschechischen Bevölkerungsteil, wie sie schon im alten Österreich-Ungarn, vor allem seit 1848 von Seiten des tschechischen Teils gegen die österreichisch-deutsche Dominierung stattgefunden hatten. Damit war auch der Einmischung von außen, die Hitler nach 1933 mit Hilfe der sudetendeutschen Partei3 gezielt betrieb, ein Boden bereitet. Diese Vorgänge bestimmten in gewisser Beziehung die politischen und historischen Verhältnisse, unter denen meine Kinder- und Jugendjahre verliefen.
Für die konkrete Berufswahl eines Menschen kommt außer den äußeren Rahmenbedingungen als wesentlicher Steuerungsfaktor ein Zweites hinzu: das Elternhaus. Oft ist die Berufswahl selbst dadurch mehr oder weniger vorgegeben.
Später einmal Lehrer zu werden, war schon mein früher Kinderwunsch.
Lehrer hatten – ganz gleich, ob sie in der Volksschule oder im Gymnasium tätig waren – im Sommer zwei Monate Urlaub. Solch lange Zeit, über deren Verwendung man zunächst selbst verfügen konnte, aber war für meine Eltern, deren meist zwölfstündiger Arbeitstag Montag früh um acht Uhr begann und Samstag Abend um acht endete, ein kaum vorstellbarer Traum. Hinzu kam das soziale Prestige dieses Berufs. Lehrer und gar Gymnasiallehrer, die in Österreich-Ungarn und der daraus 1918 hervorgegangenen Tschechoslovakei Professoren hießen, genossen in einer Kleinstadt, wie in meinem Geburtsort, ein hohes Ansehen. Und da ich, soziologisch gesehen, aus einer kleinbürgerlichen Familie stammte, hatten meine Eltern den für diese Schicht begreiflichen Wunsch, dass es ihre Tochter im Leben einmal besser haben sollte als sie selbst. Der Lehrerberuf schien ihnen die dafür geeignete Laufbahn, zumal ich offensichtlich von klein an lernbegierig war.
Für ein gut erzogenes Kind gehörte es sich bei uns zu Haus zu irgendwelchen Geburts- oder Familientagen, Gedichte aufzusagen. Für mich konnten sie nicht lang genug sein. Je länger sie waren, umso lieber lernte ich sie. Doch das war nicht der einzige Anstoß für mein späteres literarisches Interesse. Mein Großvater, der als junger Mann mit einer Wandertruppe von zu Hause durchgebrannt und zeitweilig zur Bühne gegangen war, rezitierte noch im hohen Alter lange Passagen aus seinen ehemaligen Rollen, vor allem den Nathan aus Lessings Nathan der Weise und den Marquis Posa aus Schillers Don Carlos. Schiller war sein Lieblingsautor. Nachlesen jedoch konnte ich die von ihm rezitierten Texte nur in seinen Rollenbüchern, denn Bücher besaßen meine Eltern keine. So kam es, dass ich mir in einem Alter, wo es sich für ein junges Mädchen von vierzehn Jahren gehörte, an seine spätere Aussteuer zu denken, zu Weihnachten statt der obligatorischen Bettwäsche für den späteren Hausstand die Ausgaben der deutschen Klassiker, Schiller, Goethe, Lessing wünschte. Mein Vater kommentierte diesen Wunsch mit der kritischen Bemerkung, dass es mir später einmal am Nötigsten fehlen werde und ich als Taschentücher würde Buchseiten benutzen müssen.
Von meinem Großvater habe ich die Begeisterung für die Schönheit der Sprache gelernt. Wenn er den Prolog im Himmel aus dem Faust sprach, dann verwandelten Goethes wortgewaltigen Verse der Erzengel auf die unvergängliche Schönheit der Schöpfung „Die Sonne tönt nach alter Weise in Brudersphären Wettgesang…“ unsere sehr bescheidene Stube in die Unendlichkeit des Alls? Weltalls? für dessen kleinen Planeten Erde – wie ich aus heutiger Sicht hinzufügen würde – der Wortwechsel zwischen dem Herrn und dem Teufel eine neue Runde des ewigen Kampfes zwischen Gut und Böse ankündigte, der in der Tragödie erstem Teil mit der Schwerkraft eines unentrinnbaren Schicksals erneut seinen Lauf nimmt.
Zu diesen literarischen Anregungen kamen ästhetische für Farben und Formen durch meine Eltern. Mein Vater war Verkäufer und ein einfallsreicher Dekorateur in einem Modewarengeschäft und meine Mutter Schneiderin.
Sie war zwar eine sehr schlechte Geschäftsfrau, aber eine sehr gute Schneiderin, die die seltene Kunst des Schnitte-Entwerfens sich selbst beigebracht hatte und ihre Anregungen aus Wiener Modejournalen bezog. Diese bunten Bilderbücher, in denen es um die hohe Kunst des Nähens nach sorgsam ausgearbeiteten Modellen ging, und Vaters Auslagendekorationen waren meine Art von Initiation in die darstellenden Künste.
Meine Schulzeit verlief im Grunde problemlos. Nach vier Jahren Volksschule kam ich unter Überspringung der fünften Klasse, deren Lehrplan ich durch den gemeinsamen Unterricht der Vierten und Fünften in einem Jahrgang nebenbei mit absolviert hatte, in das deutsche Realgymnasium meiner Heimatstadt.
Beim Eintritt in das achtklassige Gymnasium gab mir meine Mutter gewissermaßen ein Ziel vor: ich müsste so gut abschneiden wie die beiden Brüder der jüdischen Familie Janowitz – ihnen gehörte das größte Modewarengeschäft im Ort – die alle Klassen in allen Fächern durchweg mit der Note Eins absolviert hatten.
Ich habe dieses Ziel erreicht und in der siebenten Klasse, dem vorletzten Gymnasialjahr, die anlässlich des fünfundachtzigsten Geburtstages von Masaryk herausgegebene Medaille als beste Schülerin des ganzen Gymnasiums erhalten und das Abitur – in der CSR hieß es die Matura – 1936 mit Auszeichnung bestanden.
Meine Lieblingsfächer waren von der ersten bis zur letzten Klasse Latein und Mathematik, wozu in der Oberstufe noch Chemie kam. In Latein und Mathematik hatte ich zudem fachlich hervorragende Lehrer, Prof. Öhlert und Prof. Langhans, die zugleich ausgezeichnete Pädagogen waren. Ihnen verdankte ich in erster Linie die Schulung meines logischen Denkvermögens und meines Interesses für komplizierte Fragestellungen. Die in der lateinischen Grammatik erworbenen Schulkenntnisse waren der feste Grundstock für mein späteres Lateinstudium. An eine Mathematikstunde aber erinnere ich mich heute noch, weil sie gewissermaßen ein Probefall für spätere Berufserfahrungen war. Es gab in meiner Klasse drei gleich gute Mathematiker, zwei Jungen und mich. Beim Übergang zur darstellenden Geometrie rief Prof. Langhans uns drei in einer der ersten Stunden gemeinsam an die Tafel, stellte uns eine Aufgabe und sagte zu mir: “Nun werden wir doch einmal sehen, ob Du jetzt auch noch so gut bist wie deine beiden Mitschüler.“ Räumliches Vorstellungsvermögen war nach seiner Ansicht bei Jungen besser ausgebildet. Es blieb bei diesem einen Test, denn er brachte nicht das erwartete Ergebnis.
Daß ich nach dem Abitur in Prag an der Deutschen Universität4 studieren und „Gymnasialprofessor“ werden wollte, stand für mich und meine Eltern fest. Die Frage war aber wie. Denn meine Eltern konnten das Studium nicht finanzieren. Vater war schon seit zwei Jahren arbeitslos. Und Mutters Verdienst aus der Schneiderei reichte gerade fürs tägliche Leben. Nun hatte ich aber seit meinem vierzehnten Lebensjahr Nachhilfestunden gegeben. Im Abiturjahr waren es sieben Schüler pro Woche. Das davon zusammengesparte Geld war ein kleiner Stock, der für die je vier Monate pro Semester vier Jahre lang eine kleine Summe sicherte. Zusammen mit der durch Spendensammeln selbst zu beschaffenden Unterstützung durch den örtlichen Akademikerverband und das durch Prüfungsleistung auch für Deutsche zu erreichende staatliche Stipendium pro Semester und weitere Nachhilfestunden während des Studiums und in den Ferien schien dieser Wunsch realisierbar. Das bedeutete allerdings, die Studienzeit von vier Jahren unbedingt einzuhalten und 1940, als Voraussetzung für eine Einstellung mit einem möglichst guten Staatsexamenszeugnis, abzuschließen.
Die schwierige Wahl der künftigen Studienfächer erleichterte für Lehramtsanwärter, im Hinblick auf die Aussicht, mit dem fertigen Studium auch tatsächlich eine Anstellung zu finden, in der CSR ein Amtsblatt, worin die in den nächsten Jahren freien Stellen aufgelistet waren. Dadurch ergab sich für mich die Notwendigkeit, Latein und Französisch zu wählen, obwohl ich, trotz meiner Liebe für Sprachen und Literatur, eigentlich lieber Mathematik und Chemie studiert hätte.
Doch all diese vorsorglichen Überlegungen und Planungen gerieten wie Treibholz in den Mahlstrom der Geschichte.
Am 14. Dezember 1935 war Masaryk, der Philosoph auf dem Präsidentenstuhl, im Alter von 85 Jahren zurückgetreten. Vier Tage danach wurde Benes zu seinem Nachfolger gewählt. Er galt als der Vertreter einer unnachgiebigen Linie in der Nationalitätenpolitik gegenüber den Sudetendeutschen.5
Die Lage in deren Gebieten hatte sich aber bereits seit Anfang der dreißiger Jahre durch die allgemeine Wirtschaftskrise mit dem Sinken der Industrieproduktion und wachsenden Arbeitslosenzahlen drastisch verschärft.6 Und ähnlich wie vor 1933 in Deutschland brachte auch in den Sudeten die schwierige ökonomische Lage und die Verlockung des anscheinenden „Wirtschaftswunders“ der durch Hitler in Deutschland – wie die spätere Geschichte zeigt, der Vorbereitung eines Krieges dienenden Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, wie Autobahnbau und Rüstungsproduktion – beseitigten Arbeitslosigkeit der Partei Henleins immer mehr Anhänger.
In steigendem Maße fanden seine Anschlußforderungen, die „Heim ins Reich Parolen“ offene Ohren.7 Die sich aggravierenden politischen Gegensätze vergifteten oft selbst das Privatlebe...
Table of contents
- Cover
- Titel
- Impressum
- Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- TEIL I VITA – EINE NACHLESE
- TEIL II NACHLESE AUS BIOGRAPHIEWISSENSCHAFTLICHER SICHT
- TEIL III DOKUMENTE
- Fußnoten