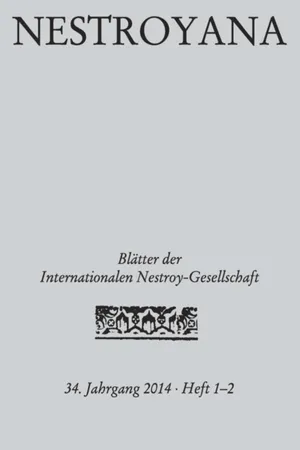![]()
Reinhard Urbach
Schnoferl und Naderer. Agenten in der österreichischen Literatur vor und nach 1848
I.
Der Agent ist einer, der Nachforschungen anstellt, möglichst unbemerkt. Wenn er auffällt, ist die Aussicht auf Erfolg gleich null. Er erfüllt einen Auftrag, wird dafür entlohnt. Er ist offiziell geheim. Auftraggeber ist der Staat, der Agent gehört zum Geheimdienst. Im Unterschied zum Spion, der für einen bestimmten Fall, ein Geheimnis, eine für den Auftraggeber handlungsentscheidende Nachricht im Feindesland eingesetzt ist, ist der Agent vielseitig verwendbar. Er kann zur Beobachtung auf eine Gruppe angesetzt sein, vielleicht noch ohne besonderen Tatverdacht oder spezielle Verdächtige, oder auch gezielt auf eine suspekte Ansammlung von Menschen. Das muss nicht im feindlichen Ausland geschehen, das findet vorzugsweise im Inland statt. Der Agent soll beobachten, kontrollieren, ermitteln.
Im Unterschied zum Denunzianten handelt der Agent nicht freiwillig. Der Denunziant schwärzt den verdächtigen Nachbarn an, gibt vor, der Obrigkeit damit einen Dienst zu tun, handelt aber meist aus Eigennutz, Missgunst, Neid, Hass, persönlicher Rache, auch aus ideologischer Überzeugung, oft in der Hoffnung auf Belohnung. Anlässe gibt es genug. Der Denunziant wirkt unaufgefordert, es sei denn, die Behörde trägt es ihm als Verpflichtung auf, Verdächtiges zu melden, staatsfeindliche Äußerungen anzuzeigen, „denn in allem läßt sich eine Beziehung finden, durch die etwas schädlich werden kann.“1 Der Feind lauert überall, sogar in der eigenen Familie. Man muss ihm das Handwerk legen. Dabei zu helfen, ist Ehrensache jedes Staatsbürgers. Der Denunziant wird im Allgemeinen verachtet, von den Mitbürgern sowieso, aber auch von den Nutznießern.
Im Unterschied zum Kriminalisten, dem berufsmäßigen Ermittler, ist der Agent ein Spitzel, der in der Regel keine Befugnis zum Eingreifen hat, er soll ja unerkannt bleiben. Die Lizenz zum Töten ist eine außergewöhnlich spektakuläre Ausnahme. Im Gegensatz zum Informanten ist der Agent nicht stationär. Der Informant sitzt auf einer bestimmten Position, die ihm erlaubt, Detailkenntnisse der Anrainer und Inwohner zu haben, die die Behörde abrufen kann. Hausmeister und Hotelbetreiber können solche Informanten sein. Der Agent dagegen ist ambulant, mischt sich ein, kommt dazu, macht sich vertraut. Im Unterschied zum Intriganten schmiedet der Agent kein Komplott. Netze, die der Intrigant auch aus „selbstloser Gemeinheit“ (Arthur Schnitzler) knüpfen mag, sind nicht sein Ziel. Der Intrigant will Konkurrenten ausschalten, stellt auch Schutzlosen und Unschuldigen Fallen, wenn er damit seine Stellung verbessern, seinen Einfluss vergrößern, seinen Reichtum vermehren kann. Der Agent kann Intrigen und Intriganten für sich einsetzen, aber nicht als persönlicher Nutznießer, sondern im Interesse des Auftrags, den er hat. Er beobachtet auch die scheinbar Unschuldigen, aber er verfolgt sie nicht aus privatem Interesse, er hat sein streng umrissenes Feindbild, darüber hinaus wird er nicht aktiv.
Spione, Denunzianten, Informanten, Kundschafter, Überläufer gab es immer.2 Geheimnisse aufzuspüren, Verdächtigen Fallen zu stellen, Feinde der vorgegebenen Ordnung zu überführen gehörte stets zu den Instrumenten der Machterhaltung, der Staatssicherheit, der politisch relevanten Wissbegierde. Im Sinne von Carl Schmitt: Der die Macht hat, schafft das Recht. Geheimnisse, undurchschaubare Handlungen, mysteriöse Vorgänge, rätselhafte Ereignisse sind bedrohlich, solange sie nicht entschlüsselt, entdeckt, entschärft und danach unschädlich gemacht werden können. Informationen über Meinungen und Vorhaben anderer garantieren Schutz und Unverwundbarkeit der eigenen Interessenssphäre. Zur Obhut der eigenen Bevölkerung ziehen Städte und Staaten Mauern hoch, die sie befestigen und für die sie Wächter und Wachen engagieren. Daraus entsteht als ein neuer Verwaltungszweig des Gemeinwesens (politeia) die Polizei. Sie wacht erst für, bald aber auch über die schutzbefohlene Bevölkerung. Die Polizei ist eine Tochter der Aufklärung, die hier nicht so sehr Erkenntnis als vielmehr Ermittlung, Entdeckung meint.
Seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts gibt es in Frankreich eine geheime Staatspolizei, die von Paris aus zentral gelenkt wird. In Österreich werden 1754 drei Polizeiaufseher für Wien installiert. Die Theorie folgte auf dem Fuß. Joseph von Sonnenfels (1732/33–1817) wird 1763 der erste Lehrstuhlinhaber der neueingeführten Polizey- und Kameralwissenschaft an der Universität Wien. Sein Standardwerk, das seit 1770 als offizielles Lehrbuch benützt wird: Grundsätze der Polizey, Handlung, und Finanz als Leitfaden des politischen Studiums, erscheint erstmals in Wien 1765 und erfährt bis 1819 acht Auflagen. Nach Sonnenfels ist „bürgerliche Folgsamkeit“ Bedingung, um das Ziel der staatlichen Bestrebungen zu erreichen: Wohlfahrt für alle. Als Gegenleistung für den Gehorsam bietet der Staat dem Bürger Sicherheit. Die Polizeiwissenschaft lehrt die Grundsätze, die angestrebte Sicherheit zu begründen und zu erhalten. Sonnenfels begegnet dem Vorwurf, damit die Freiheit des Einzelnen einzuschränken, mit der Abgrenzung von Zügellosigkeit, die das Böse nicht ausschließt, und Unabhängigkeit, die bedeutet, dass man für sein Tun nicht zur Rechenschaft gezogen werden könnte. Freiheit dagegen ist durch Pflichten im Sinne des Gesellschaftsvertrages eingegrenzt, die vom Staat durch die Gesetzgebung zur allgemeinen Bequemlichkeit garantiert und notfalls auch mit Gewalt unter dem Gesichtspunkt der Behutsamkeit durchgesetzt wird. „Behutsamkeit“ meint zum Beispiel, dass sich die Untersuchungshaft womöglich Unschuldiger von der strengen Verwahrung rechtmäßig Verurteilter unterscheiden müsse. Die Würde des Einzelnen soll gewahrt, seine Rechtschaffenheit muss geachtet werden, so wie seine Ehre mit der Einhaltung der Gesetze konform zu gehen hat. Die polizeilichen Maßnahmen zur Erhaltung der inneren Sicherheit werden penibel beschrieben. Es ist selbstverständlich, dass die Stadtwache die Ein- und Ausreise kontrolliert, dass die Wirtsleute die Meldezettel ordnungsgemäß abliefern. Die Polizei ist bei Verbrechen angehalten, „Nachsuchungen“ anzustellen. Bei Mord, Einbruch, Ausbruch von Gefangenen hat die Sturmglocke zu läuten. Flüchtigen Verbrechern darf die Post keine Pferde ausfolgen, Steckbriefe sollen die Ausforschung erleichtern. Vorschubleistung für Verbrechen muss durch Verordnungen und Vorschriften verhindert werden. Zufälle und Unfälle sollen möglichst vorbeugend ausgeschaltet werden, zum Beispiel durch ausreichende Straßenbeleuchtung, die bei Naturkatastrophen Plünderungen zu verhindern hilft. Dass die vorbeugenden und im Nachhinein aufklärenden Maßnahmen der Staatsgewalt alle auf der Grundlage der Gesetze und Verordnungen zu geschehen haben, setzt Sonnenfels voraus. Mit Schärfe wendet er sich gegen die unlautere und gesetzlich nicht abgesicherte Methode der geheimen Ausforschung und weiß sich damit einer Meinung mit seinem Vorbild Montesquieu, dessen Profil als Titelkupfer sein Buch ziert. Das Neue, das Sonnenfels einbringt, ist der Vorschlag, die „Geheimen“ zu Beamten zu machen. Denn dann sind sie ihrerseits kontrollierbar, stehen nicht nur im gesicherten Sold, sondern auch unter dem Kodex des Staatsangestellten, was sie vielleicht nicht vor Bestechung bewahrt, aber diese leichter ahndbar macht. Das ist ein gefährliches Zugeständnis an die Regierung. Der Staat, der alles kontrollieren darf, ist seinerseits nicht belangbar, wenn er die Aufsicht über die Bürger geheimen Organen anvertraut. Er soll sie zwar anstellen, aber insgeheim. Anders hätte die Beschäftigung keinen Sinn. So können sie auch nicht Gegenstand der Kameralistik werden. Sonnenfels kann nur allgemein auf die Denkbarkeit der Notwendigkeit geheimer Agenten eingehen. Maria Theresia, die sich über die Einrichtungen der Pariser Polizei unterrichten ließ (1771), ist bei der Errichtung einer Geheimen Polizei in Österreich vorsichtig. Sonnenfels hat sich zunächst durchgesetzt. 1773 ist er Mitglied der niederösterreichischen Regierung geworden, zuständig für die Einrichtung der Polizei. Frühere Einwände gegen die Einführung der mouches, der Geheimpolizisten aus finanziellen Gründen, untermauert er mit seinen moralischen Bedenken. Es sei „mit dem Begriff der bürgerlichen Freiheit unverträglich […], weil endlich dabey auch solche Mittel angewendet werden, welche sich mit den reinen Begriffen der Religion, mit der Anständigkeit der Sitten, mithin auch mit den ächten Grundsätzen der Staatsverfassung kaum vereinbaren zu lassen scheinen.“3 Die von Sonnenfels vorgeschlagene und ausgearbeitete Polizeiordnung wird am 2. März 1776 kundgemacht – ausdrücklich mit dem Hinweis, dass den Bezirksaufsehern bei der Einschulung „das geziemende Betragen, die Bescheidenheit und Behutsamkeit auf das nachdrücklichste anempfohlen, auch alles, was die billige Freiheit der Bürger zu stöhren fähig wäre, auf das schärfste untersagt ist.“4 Seinem Steckenpferd wird Rechnung getragen: Sonnenfels wird 1777 zum Illuminationsdirektor ernannt, woraufhin bis 1779 in Wien in einem Abstand von sechs Schritten von Lampenanzündern gewartete Öllaternen aufgestellt werden, die bis 1 Uhr nachts brennen. „Paris und Berlin besaßen damals nur in mondlosen Nächten eine eigene Illumination.“5
Die Polizei als Ordnungshüter – das ist dem Nachfolger Maria Theresias zu wenig. Seit 1782 ist Johann Anton Graf von Pergen Staatsminister in inneren Geschäften. 1785 überträgt ihm Joseph II. das gesamte Sicherheitswesen für alle nicht-ungarischen Teile der Monarchie. Er ist in dieser Funktion direkt dem Kaiser unterstellt und hat ständigen, unangemeldeten Zutritt. Nicht ohne Spott hatte er dem Kaiser vorgetragen, dass die maria-theresianische Polizei nur der „Verschönerung und Gemächlichkeit, auch Ordnung bei öffentlichen Anstalten“6 diene. Das sollte anders werden. Am 16. November 1785 erlässt Joseph II. die von Pergen verfasste „Geheime Instrukzion“ an die Provinz-Statthalter, die erste Grundlegung der geheimen Staatspolizei. Die Präambel ist noch ganz im Sinne der von Sonnenfels vertretenen aufgeklärten Ideologie gehalten. „Nur durch gut eingeleitete Polizey-Anstalten kann die innere Ruhe, Sicherheit und Wohlfahrt des Staates gegründet werden. Je weitschichtiger eine Monarchie ist, desto mehr liegt daran, solche Polizey-Anstalten einzuführen, die einförmig, zusammenhängend und dadurch tauglich seyen, die Übersehung im Ganzen und allen Theilen beständig zu erhalten.“7 Abgesehen von den Gegenständen, die der „Polizeyobsicht“ unterliegen und von denen jedermann weiß, gibt es aber
Gegenstände, die eine dermassen geheime Absicht erfordern, daß nicht einmal eine Landesstelle davon wißen, mithin viel weniger das Publikum nur die geringste Vermuthung bekommen darf, als ob sich die Aufmerksamkeit der Polizey bis dahin erstrecke. Nur einem Landeschef kommt es zu, von diesem Theile der Polizey, was nämlich der geheime Dienst genennet wird, Wissenschaft zu haben.8
Das Vertrauen in den geheimen Dienst ist groß genug anzunehmen, dass er imstande ist,
durch unbemerkte Nachspürungen die gefährlichen Anlagen aller Gattung, ehe solche zur Reife kommen, zu enthüllen und arbeitet mithin den heimlichen Feinden des Staates und der inneren Sicherheit um so nachdrücklicher entgegen, als diese sich lediglich gegen die öffentliche Aufsicht sicherstellen und nicht wissen können, daß sie insgeheim beobachtet werden.9
Es ist eine hauptsächlich innenpolitische Maßnahme. Die Kontrolle richtet sich zunächst gegen die eigenen Beamten, das Militär, den Klerus. Bei den Beamten sollen Korruptionsverdacht, Auslandskontakte, Amtsverschwiegenheit beobachtet werden. Die Militärkontrolle soll hauptsächlich Geheimnisverrat an ausländische Mächte ahnden. Bei der Geistlichkeit ist auf die „dem Regenten schuldige Unterwürfigkeit“10 und die Beachtung der Interessen des Staates in den Predigten zu achten. Es fällt nicht in die Zuständigkeit des geheimen Dienstes in den Provinzen, die ausländischen Mächte zu beobachten, über deren Interessen und Absichten man durch die von alters her eingerichtete Briefkontrolle ausreichend unterrichtet zu sein glaubt. Dagegen muss darauf geachtet werden, „ob nicht von Auslanden verdächtige Leute, falsche Werber, Spione, Kreditspapierverfälscher u. dgl. sich einschleichen, denen alles Ernstes und unablässig nachzuspüren und sowohl auf die Entdeckung ihrer heimlichen Unthaten als auf die Habhaftwerdung ihrer Personen, dann ihrer Mitschuldigen, Bedacht zu nehmen ist.“11 Vorrangig soll auch die Bevölkerung beobachtet werden. „Nicht minder muß die Polizey insgeheim nachforschen, was im Publikum von dem Monarchen und seiner Regierung gesprochen werde, wie das Publikum in diesem Punkte von Zeit zu Zeit gestimmt sey, ob...