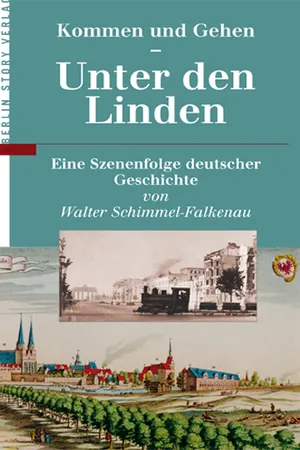
Kommen und Gehen - Unter den Linden
Eine Szenenfolge deutscher Geschichte von Walter Schimmel-Falkenau
- 370 pages
- English
- ePUB (mobile friendly)
- Available on iOS & Android
Kommen und Gehen - Unter den Linden
Eine Szenenfolge deutscher Geschichte von Walter Schimmel-Falkenau
About this book
Dies ist das schönste Buch über die Sternstunden der Straße "Unter den Linden". Selten gelingt es wie hier, die Höhepunkte der Geschichte so lebhaft darzustellen. Walter Schimmel-Falkenau (1895 - 1971) lässt die Vergangenheit sprechen. Wir begegnen Frauen und Männern, Damen und Herren, Königinnen und Königen, Künstlerinnen und Künstlern aus 300 Jahren.Warum liebte Kurfürstin Sophie Charlotte die Linden so? Wie fühlte sich Goethe im Palais Prinz Heinrich? Was hatte Mozart in der Oper auszusetzen? Wie kamen Luise und Friederike in die Stadt? Wieso begleiteten türkische Mameluken Napoleon in die Stadt? Was besprachen ETA Hoffmann und Julius Hitzig im Café Royal über Webers Freischütz? Wo trat Paganini, wo Henriette Sontag auf und wo lebte Bettina von Arnim? Wen verschaukelte der alte Schadow? Was hörte Fontane von Leopold von Ranke über die Emser Depesche? Wann tauchten Moltke, Roon und Bismarck Unter den Linden auf? Wo wurde Marlene entdeckt? Wie wurde der Fackelzug der Nazis aufgenommen? Die Bombennächte, der 17. Juni 1953 und der Mauerbau beschließen diese Biographie einer Straße.
Frequently asked questions
- Essential is ideal for learners and professionals who enjoy exploring a wide range of subjects. Access the Essential Library with 800,000+ trusted titles and best-sellers across business, personal growth, and the humanities. Includes unlimited reading time and Standard Read Aloud voice.
- Complete: Perfect for advanced learners and researchers needing full, unrestricted access. Unlock 1.4M+ books across hundreds of subjects, including academic and specialized titles. The Complete Plan also includes advanced features like Premium Read Aloud and Research Assistant.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Information
SKANDAL IN DER KÖNIGLICHEN HOFOPER
1. April 1871

BERLIN IM FRIEDENSTAUMEL
16. Juni 1871

Table of contents
- Cover
- Titel
- Impressum
- INHALTSVERZEICHNIS
- Vorwort zur Neuauflage
- Vor dreihundert Jahren
- Die jungfräuliche Lindenallee. Um 1700
- Berlin empfängt die Kronprinzessin. 27. Juni 1733
- Die Einweihung des Opernhauses. 7. Dezember 1742
- Die Königin bei A. Dorothea Terbusch am 7. März 1746
- Lessing rettet sich nach Berlin. Dezember 1748
- Der jungvermählte Chodowiecki. 13. Juni 1756
- Der Krieg macht vor Berlin nicht halt. Oktober 1760
- Der König enttäuscht die Berliner. Ende März 1763
- »… Wie Berlins Töchter und Söhne daherwalleten …« Um 1770
- Goethe im Palais Prinz Heinrich. Mitte Mai 1778
- Der König stirbt. 16./17. August 1786
- Mozart gibt ein Gastspiel. 19. Mai 1789
- Die Gräfin und das neue Brandenburger Tor Sommer 1793
- Wieder kam eine Kronprinzessin durch das Brandenburger Tor. 22. Dezember 1793
- Hoher Besuch bei Rahel Levin. Silvester 1799
- Schiller gibt Iffland einen Wink. Sommer 1804
- Voll Übermut in den Krieg. August 1806
- Napoleon und die »Linden«. Oktober 1806
- Das Abenteuer Schill. Mai 1809
- Königin Luise, Rückkehr und Heimkehr. 1809/10
- Humboldt und seine Universität. 15. Oktober 1810
- Die Kleist-Tragödie. November 1811
- Berlin im Befreiungsfieber. Frühjahr 1813
- Der Tag von Großbeeren. 23. August 1813
- Die Quadriga kehrt zurück. 30. Juni 1814
- Der erste Weihnachtsbaum. 24. Dezember 1815
- Der Beginn einer Romanze. 10. März 1819
- Die letzten Besucher der Gräfin Lichtenau. 19. Juni 1820
- Ein Ehepaar von Weber fährt über die „Linden«. 18. Juni 1821
- Ausklang einer Romanze. Frühjahr 1822
- Heinrich Heine lobt die „Linden«. Sommer 1822
- Paganinis Zaubergeige. Herbst 1828
- Henriette Sontags Abschiedsabend. 19. Mai 1830
- Besuch aus Paris. Januar 1833
- Letzte Begegnung. März 1833
- Bettina von Arnim empfängt. Frühling 1842
- Berlin bereitet Franz Liszt Ovationen. Sommer 1842
- Der Opernbrand. Die Nacht 18./19. August 1843
- Wie ein Phönix aus der Asche … 7. Dezember 1844
- Fontane erzählt. Herbst 1845
- Ludwig Tieck, wie man ihn nicht kennt. Um die Jahrhundertmitte
- Eine Revolution fegt über die „Linden«. März 1848
- Schüsse ins Leere. 7. Mai 1866
- Vor und nach zwei historischen Depeschen. 1870/71
- Skandal in der Königlichen Hofoper. 1. April 1871
- Berlin im Friedenstaumel. 16. Juni 1871
- Episode aus der Gründerzeit. 1872
- Eine Jubelpremiere. Herbst 1876
- Das Attentat. 11. Mai 1878
- Ein Hofhall, wie Menzel ihn malte. Winter 1886
- Als der alte Kaiser starb. März 1888
- Die Entlassung. 29. März 1890
- Rendezvous »Unter den Linden«. Herbst 1890
- Liebermann malt Fontane. April 1896
- »Mich dünkt, ich hab Euch lieb …«. Juni 1899
- Zwei Damen machen einen »Linden«-Bummel. September 1899
- Vom Kabarett zum Deutschen Theater. Im Herbst 1903
- Großer Tag für Emmy Destinn. 5. Dezember 1906
- Ein Maientag voll tieferer Bedeutung. 13. Mai 1910
- In der russischen Botschaft wußte man Bescheid. Ende Juli 1914
- Die Novemberrevolution. 8./9. November 1918
- Ein Pils zu 300 Milliarden! Anno 1923
- Marlene macht von sich reden … Frühling 1929
- Der Botschafter Frankreichs sah zu … 30. Januar 1933
- Olympiade 1936
- Und wieder traf’s die Lindenoper. 9./10. April 1941 bis 7. Dezember 1942
- Ein Drama in Funksprüchen. 3. Februar 1943
- Das Inferno. 1944
- Die Wanderer zwischen zwei Welten. Herbst 1945
- Als sie noch radelte. Oktober 1945
- Der Aufschrei. 17. Juni 1953
- Die Mauer. 13. August 1961