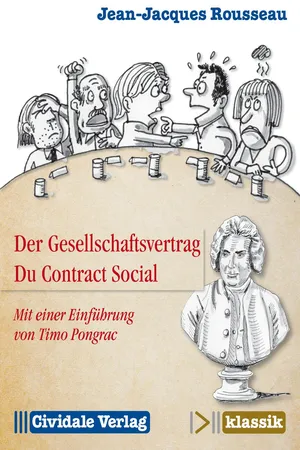![]()
Der Gesellschaftsvertrag von Jean-Jacques Rousseau.
Eine Einführung von Timo Pongrac
1. Einleitung
Wer sich heute mit dem Gesellschaftsvertrag von Rousseau beschäftigt, wird dazu vermutlich eine von zwei Veranlassungen haben. Die erste könnte historisches Interesse sein: Die Schrift erscheint als ein wertvolles Dokument vergangenen Denkens, das uns einen Einblick in die politischen Ideenwelten zurückliegender Zeiten eröffnet. Man liest sie in derselben Einstellung, mit der man ein Museum betritt. Ein solcher Zugang ist zweifellos naheliegend, denn Rousseaus Zeiten waren bewegte Zeiten. Er lebte in der Epoche der europäischen Aufklärung und damit in einer spannungsreichen Umbruchphase, in der die Fundamente der modernen Welt gelegt wurden. Das schlug sich auch in seinem Werk nieder. Es ist ein Dokument des sozialen Wandels, Ausdruck des bürgerlichen Strebens nach Emanzipation und Selbstbestimmung, des Kampfes gegen die feudalen und kirchlichen Fesseln der Vergangenheit. Dies gilt selbst dann noch, wenn man einräumt, dass Rousseau in vielen Dingen gerade gegen den herrschenden Zeitgeist, auch den der Aufklärung, anschrieb. Man mag ihn als Zivilisationsfeind, als rückwärtsgewandten Kritiker von Wissenschaft und Technik ansehen, erfüllt von den Sehnsüchten nach einem einfachen Leben.i Und doch ist Rousseau immer auch Aufklärer geblieben. Er beklagt die Missstände seiner Zeit und entwirft, in steter Auseinandersetzung mit seinen Zeitgenossen, Visionen des Besseren.
Letzteres wird wohl in keiner Schrift so deutlich wie in seinem Gesellschaftsvertrag, den man ohne zu übertreiben als wichtigsten oder zumindest einflussreichsten demokratietheoretischen Grundtext der Moderne bezeichnen kann. In ihm bündeln sich nicht nur die zentralen politikphilosophischen Interpretationslinien der europäischen Neuzeit. Er stellt auch eine bleibende Quelle der Inspiration für alle radikaldemokratischen Bewegungen der jüngeren Geschichte dar. Den Jakobinern etwa galt der Gesellschaftsvertrag gleichsam als Programmschrift der Französischen Revolution.ii Man könnte sich daher geneigt sehen, den historischen wie werkgeschichtlichen Ort des Textes auszuloten und Rousseaus Abhandlung vor dem Hintergrund ihrer Zeit zu erschließen, um sie in die vielgestaltigen und weitreichenden Diskurse der Aufklärung einzuordnen. Doch obzwar ein solcher Zugang zweifelsohne aussichtsreich und verlockend erscheinen mag, soll er in der hier vorliegenden Einführung ausdrücklich nicht verfolgt werden bzw. zumindest nicht im Zentrum stehen. Denn man kann sich der Schrift auch aus einer alternativen Perspektive und mit anderen als musealen Absichten anzunähern versuchen.
Dies führt uns zu dem zweiten möglichen Grund für eine Auseinandersetzung mit Rousseaus Abhandlung: Wer den Gesellschaftsvertrag nicht aus historischem Interesse zur Hand nimmt, der oder die dürfte vor allem wissen wollen, was uns das Werk heute noch zu sagen hat. Eine derartige Absicht kann man als systematisches Erkenntnisinteresse bezeichnen. Und auch sie erscheint legitim, denn Rousseaus Abhandlung ist eine philosophische Schrift. Als eine solche sucht sie nach allgemeinen und überhistorischen Wahrheiten, die im hier vorliegenden Falle die Grundsätze des Staatsrechts betreffen. Mit diesem Anspruch kann man den Gesellschaftsvertrag durchaus ernst nehmen. Man wird sich dann weniger für die vielfältigen geschichtlichen Bezüge und Querverweise interessieren. Im Zentrum steht vielmehr die Frage nach der Überzeugungskraft der im Text vertretenen Positionen und der zu ihrer Begründung angeführten Argumente. Man möchte wissen, wie schlüssig und plausibel die von Rousseau vorgebrachte Konzeption ist, um sich auf diesem Wege Anregungen für das heutige politische Denken und Handeln zu verschaffen. Dafür müssen die Begründungszusammenhänge des Textes selbst in den Blick genommen werden. Denn nur deren Kenntnis gestattet ein informiertes Urteil darüber, welche Überlegungen und Einsichten des Gesellschaftsvertrags auch für die Gegenwart noch relevant sein könnten. Diesem Erkenntnisinteresse entgegenzukommen, ist die erklärte Absicht der vorliegenden Einleitung. Sie möchte den Zugang zum Text erleichtern, indem sie die konzeptionellen Grundlagen und systematischen Zusammenhänge der von Rousseau verfolgten Argumentationslinien so transparent und plausibel wie möglich nachzuzeichnen versucht. Auch wenn dies manchmal mühevoll erscheinen mag, ist es der einzige Weg, sich das Anliegen des Gesellschaftsvertrags zu vergegenwärtigen.
Das soll indes nicht bedeuten, dass dabei ohne jede kritische Distanz verfahren wird. Mitdenken heißt Weiterdenken! Eine systematische Rekonstruktion des Gesellschaftsvertrags wird daher nicht nur die Stärken der Abhandlung, sondern ebenso die Schwachpunkte und Schwierigkeiten der rousseauschen Konzeption zu berücksichtigen haben. Auch das ist ein Gebot ernsthafter Auseinandersetzung mit dem Text. Nur wenn man diesen in allen seinen Facetten, also auch den problematischen, zur Kenntnis nimmt, kann man sich ein ausgewogenes Gesamturteil bilden.
Eine kritisch-distanzierte Einstellung einzunehmen, bedeutet aber auch, dass man nicht alle Ansichten des Autors teilen muss, um sich der Grundintention seines Werks zu vergewissern. Dadurch eröffnen sich gewisse Freiheitsspielräume. Von ihnen soll in der hier vorliegenden Einführung vor allem in einer Hinsicht Gebrauch gemacht werden: Wie viele seiner Zeitgenossen war auch Rousseau davon überzeugt, dass Politik eine ausschließlich männliche Domäne darstellt. Frauen sollten sich seiner Auffassung zufolge nicht um die öffentlichen Angelegenheiten bekümmern, sondern in der Sphäre des Haushalts ihren vermeintlich ‚natürlichen‘ Pflichten und Bestimmungen nachkommen. Obwohl sich diese Position nicht explizit im Gesellschaftsvertrag selbst ausgeführt findet, wird man sie durch Hinzuziehen anderer Schriften Rousseaus ohne weiteres belegen können.iii Inwiefern diese Ansicht auch sein politiktheoretisches Hauptwerk berührt, ist jedoch fraglich.iv Wir wollen im Folgenden jedenfalls davon ausgehen, dass sich der Gesellschaftsvertrag auch dann plausibel rekonstruieren lässt, wenn man dabei keinen politischen Ausschluss von Frauen voraussetzt. Das hat zur Folge, dass bei der Darstellung von Rousseaus politiktheoretischer Konzeption ganz selbstverständlich stets von Bürgern wie von Bürgerinnen die Rede sein wird. So viel interpretatorische Freiheit wird man sich herausnehmen müssen, um das rousseausche Projekt nicht bereits von seinen Grundlagen her hoffnungslos zu diskreditieren.
Damit ist die Absicht der vorliegenden Einführung in groben Zügen umrissen. Ihr Ziel besteht in einer systematischen Rekonstruktion des Gesellschaftsvertrags, bei der die wichtigsten Begründungszusammenhänge und Argumentationsfiguren des Textes betrachtet und diskutiert werden sollen. Historische Bezüge und Querverweise geraten dabei nur insoweit in den Blick, wie dies für eine Veranschaulichung des Grundanliegens der Schrift angebracht erscheint. Sie werden uns zudem ausnahmslos in Gestalt von anderen politischen Theorien begegnen – solchen nämlich, mit denen sich Rousseau in seinem Werk selbst auseinandergesetzt hat. Realgeschichtliche Darlegungen wird man in der Einleitung hingegen ebenso wenig finden wie biographische Ausführungen. Darin besteht eine Konsequenz der hier verfolgten theoretischen Schwerpunktsetzung.v
Die systematische Rekonstruktion des Gesellschaftsvertrags soll dabei in vier Schritten erfolgen. Zunächst wollen wir uns mit der grundlegenden Absicht des Textes vertraut machen. In diesem Zusammenhang werden auch die theoretischen Modelle anderer politischer Philosophen eine Rolle spielen. Sodann ist das spezifische Begründungskonzept in den Blick zu nehmen, mit dessen Hilfe Rousseau das von ihm ins Auge gefasste Gesellschaftsmodell zu rechtfertigen sucht: die titelgebende Figur eines hypothetischen Gesellschaftsvertrags. Welche konkreten politischen Einrichtungen und Institutionen auf diesem Wege Legitimation und Begründung finden sollen, wird das Thema des folgenden Kapitels sein. Abschließend widmen wir uns den externen Bedingungen, unter denen eine Umsetzung des rousseauschen Modells möglich schiene. Mit diesen Hintergrundinformationen sollte der Leser bzw. die Leserin imstande sein, sich durch die Lektüre des Gesellschaftsvertrags ein eigenes Urteil über die Überzeugungskraft und den möglichen bleibenden Wert der Schrift zu verschaffen.
2. Absicht und Kontexte des Gesellschaftsvertrags
Rousseaus Gesellschaftsvertrag ist ein Werk von bescheidenem Umfang. Lediglich eine „kleine Abhandlung“ könne er vorlegen, einige kurze Passagen aus dem, was ursprünglich einmal ein umfassenderes Werk über die Natur politischer Institutionen hätte werden sollen, das zu vollenden jedoch die Kräfte des Verfassers überstiegen habe.vi Rousseau, der im Laufe seiner Studien zu der Überzeugung gelangt war, „daß alles im letzten Grunde auf die Politik ankäme und daß, wie man es auch anstellte, jedes Volk stets nur das würde, was die Natur seiner Regierung aus ihm machen würde“vii, eröffnet sein politiktheoretisches Hauptwerk mit dem Eingeständnis, dass es sich dabei um nicht viel mehr als um ein Bruchstück handele. Eine solche Bemerkung lässt aufhorchen. Fragmente lesen sich nicht leicht. Vieles bleibt in ihnen unausgeführt, was eigentlich umfangreichere Betrachtungen und Erläuterungen erfordert hätte. Es geht um das Ganze – aber nur Teile davon werden präsentiert. Rousseau warnt uns also vor: Der Gesellschaftsvertrag ist das Resultat einer jahrelangen Arbeit, die nun in komprimierter und verdichteter Form verabreicht wird. Damit ist Komplexität vorgezeichnet. Um trotzdem den Überblick zu behalten, ist es hilfreich, sich vor der ersten Lektüre zunächst mit dem Grundanliegen der Schrift vertraut zu machen. Was ist die generelle Absicht von Rousseaus kurzer Abhandlung über die Grundsätze des Staatsrechts?
Eine Antwort darauf findet sich bereits auf den ersten Seiten des Gesellschaftsvertrags. „Der Mensch“, so heißt es im ersten Kapitel des ersten Buches, „wird frei geboren, und überall ist er in Ketten. Mancher hält sich für den Herrn seiner Mitmenschen und ist trotzdem mehr Sklave als sie. Wie hat sich diese Umwandlung zugetragen? Ich weiß es nicht. Was kann ihr Rechtmäßigkeit verleihen? Diese Frage glaube ich beantworten zu können.“viii Man sollte sich von der Formulierung nicht in die Irre führen lassen. Rousseaus Anliegen ist es keinesfalls, irgendwelche Formen personaler Abhängigkeit zu rechtfertigen – auch wenn es dem Anspruch nach durchaus um eine Legitimierung von Ketten geht. Aber welcher Art von Ketten? Das ist die Frage! Denn für Rousseau sind nicht alle Fesseln gleichermaßen akzeptabel. Solche jedenfalls sind es mit Sicherheit nicht, die einzelne Menschen der willkürlichen Verfügung durch andere unterwerfen. Man sollte das Wort ‚Ketten‘ vielleicht mit dem neutraleren Wort ‚Bindungen‘ übersetzen. Wenn wir eine Bindung miteinander eingehen, wie dies in gesellschaftlichen Verhältnissen stets der Fall ist, bedeutet dies, dass wir einen Teil unserer Unabhängigkeit aufgeben und etwas von unserer Autarkie preisgeben müssen. Die Frage lautet dann: Wie können wir uns so miteinander vereinigen, dass die konkrete Form dieser freiheitseinschränkenden Bindung zugleich als rechtmäßig angesehen werden kann? Welche sozialen und politischen Ketten sind hinnehmbar und akzeptabel?
Das Grundanliegen des Gesellschaftsvertrags ist damit ein normatives. Anders als noch in seinen berühmten kulturkritischen Schriftenix geht es Rousseau hier nicht um eine historische Erklärung der Entstehung von gesellschaftlichen bzw. politischen Abhängigkeitsverhältnissen; geschichtliche Beschreibungen dienen im Gesellschaftsvertrag allenfalls zur Veranschaulichung und nicht zur systematischen Begründung. Rousseaus eigentliche Absicht ist eine andere: Er fragt nicht danach, wie gesellschaftliche Verbindungen tatsächlich entstanden sind, sondern wie sie beschaffen sein müssten, um Legitimität beanspruchen zu können. Rousseau sucht also nach geeigneten Maßstäben, anhand deren sich beurteilen lässt, ob soziale Beziehungsformen anerkennenswürdig sind oder nicht. Wie sollte ein Gemeinwesen aufgebaut und institutionell verfasst sein, damit es die rational motivierte Zustimmung seiner Mitglieder verdient? Das ist die Grundfrage des Gesellschaftsvertrags.
Rousseau zielt dabei insbesondere auf eine Begründung angemessener politischer Institutionen. Solche Institutionen gehen in aller Regel mit hierarchischen Beziehungsmustern einher. Es gibt Regierende und Regierte. Damit sind Herrschaftsverhältnisse im Spiel. Aber aus welchem Grund bemüht sich der Verfasser des Gesellschaftsvertrags, politische Autoritätsstrukturen zu legitimieren, wenn doch der Mensch ein zur Freiheit geborenes Wesen ist? Wären nicht auch horizontalere Beziehungsformen möglich?
Eine Antwort auf diese Fragen lässt sich im Sinne Rousseaus wie folgt umreißen: Zwar sind die Menschen in der Tat frei geboren. Allerdings sind sie, jedenfalls unter normalen Umständen, gezwungen, in gesellschaftlichen Beziehungen zu leben, die ihnen ein kooperatives Verhalten abverlangen. In einer Gesellschaft kann nicht jeder und jede einfach immer das tun, wonach ihm oder ihr gerade der Sinn stehen mag. Er oder sie muss vielmehr Rücksicht auf die Wünsche und Nöte der anderen nehmen. Wären Menschen vollkommene moralische Geschöpfe, so würden sie bei allen ihren individuellen Entscheidungen stets von sich aus das Wohl aller anderen im Auge behalten – vorausgesetzt, dass sie sich über sämtliche Konsequenzen ihres Handelns im Klaren sein können. Eine solche Annahme ist aber unrealistisch. Menschen sind zwar durchaus zu moralischen Rücksichten in der Lage. Sie sind aber ebenso egoistische Wesen, die in vielen Situationen primär auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind, der nicht immer automatisch im Einklang mit den Forderungen der Moral zu stehen braucht. Deshalb bedarf es anderer als moralischer Garantien, um ein kooperatives Miteinander zu gewährleisten, das auch unter Bedingungen von Interessenkonkurrenz aufrechterhalten werden kann.
Dies ist exakt der Punkt, an dem für Rousseau die Politik ins Spiel kommt: „Gäbe es keine verschiedenen Interessen“, heißt es in einer Fußnote des Gesellschaftsvertrags, „würde [alles] ganz von selbst gehen, und die Politik aufhören, eine Kunst zu sein.“x Da die Menschen aber, wie beschrieben, oftmals dazu tendieren, eher ihren partikularen Neigungen als allgemeinen Grundsätzen der Moral zu folgen, bedarf es nach Rousseau der Kunst der Politik. Diese erzwingt, machtgestützt und sanktionsbasiert, kooperatives Verhalten auch in solchen Fällen, in denen die moralischen Ressourcen der Individuen dafür nicht ausreichend wären. Ihre Aufgabe ist es, kollektiv bindende Regeln des Miteinanders festzulegen und diese, wenn nötig unter Androhung von Strafe, gegenüber den Einzelnen durchzusetzen, damit diese von ihren Freiheiten keinen missbräuchlichen Gebrauch machen. Wie aber muss Politik institutionalisiert und organisiert werden, damit sie ihrerseits die ihr zukommende Macht und Autorität nicht ausnutzt – indem etwa Gesetze verabschiedet werden, die ausschließlich den partikularen Interessen der Herrschenden zugute kommen? Das führt uns wieder zur Ausgangsfrage des Gesellschaftsvertrags zurück. Was sind die Grundzüge eines rechtmäßigen Gemeinwesens?
Natürlich ist diese Frage alles andere als neu. Die Suche nach der guten und gerechten Ordnung beschäftigt das europäische Politikdenken mindestens seit Platon.xi Rousseau zeichnet sich allerdings dadurch aus, dass er beinahe alle bisherigen Überlegungen seiner Vorläufer als fehlerhaft zurückweist. Seine Kritik verfolgt dabei im Wesentlichen zwei Stoßrichtungen: Einerseits kritisiert er die grundbegrifflichen Fundamente, von denen ausgehend politische Autorität in vielen Fällen abgeleitet wurde. Andererseits verwirft er die Institutionalisierungsvorschläge seiner Vorgänger. In Abgrenzung dazu entwickelt Rousseau seine eigenen Grundsätze des Staatsrechts – die zugleich auf die von ihm favorisierte Einrichtung von Politik vorausweisen. Das ist das hauptsächliche Thema des ersten Buchs des Gesellschaftsvertrags, um das es nun zunächst gehen soll.
Wir fangen mit dem ersten Punkt von Rousseaus Kritik an seinen Vorgängern an: den fehlerhaften grundbegrifflichen Fundamenten, die zur Rechtfertigung politischer Autoritätsansprüche herangezogen wurden. Rousseau weist hier insbesondere alle Versuche zurück, die Legitimität politischer Herrschaft in irgendeiner Weise von der Natur abzuleiten. So lässt sich eine Berechtigung zur Ausübung politischer Autorität seiner Ansicht nach zum Beispiel nicht auf ein ursprüngliches Recht des Stärkeren zurückführen. Das ist eine Begründungsstrategie, wie sie etwa in der Antike von dem griechischen Sophisten Thrasymachos vertreten wurde.xii Was ist daran falsch? Nun, es mag zwar sein, dass in der Geschichte tatsächlich oftmals die Stärksten die Geschicke der Politik bestimmen konnten. Aber wir erinnern uns: Rousseau fragt nicht danach, wie politische Autorität de facto zustande gekommen ist, sondern wie sie beschaffen sein muss, um Legitimität beanspruchen zu können. Tatsachen schaffen kein Recht; und Stärke vermag dies ebenso wenig. „Die Stärke ist ein physisches Vermögen; ich begreife nicht, welche sittliche Verpflichtung sie bewirken könnte. […] Muss man aus Zwang gehorchen, so braucht man nicht aus Pflicht zu gehorchen, und wird man nicht mehr zum Gehorchen gezwungen, so ist man dazu auch nicht mehr verpflichtet. Man sieht also, dass das Wort ‚Recht‘ der Stärke nichts verleiht; es ist hier vollkommen bedeutungslos.“xiii
Physische Gewalt stiftet keine sittliche Verpflichtung, ihr Folge zu leisten. Die Berechtigung zu politischer Machtausübung ergibt sich daher nicht aus dem schieren Faktum körperlicher Überlegenheit. Sie lässt sich aber auch nicht aus anderen als ‚natürlich‘ aufgefassten Qualitäten und Beziehungsformen ableiten. Weder gibt es naturhaft zur Herrschaft und zur Sklaverei geborene Menschen, wie es die Ansicht von Aristoteles war;xiv noch kann politische Autorität auf eine vermeintlich ‚natürliche‘ Autorität des Vaters über seine Kinder zurückgeführt werden, wie es die Verteidiger der Erbmonarchie, allen voran Robert ...