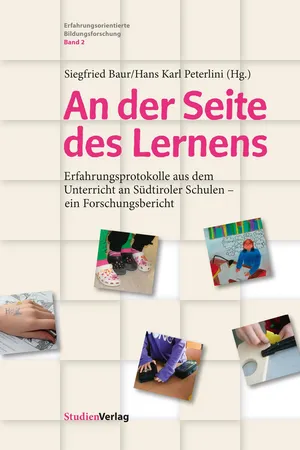![]()
Evi Agostini42
Lektüre von Vignetten
Reflexive Zugriffe auf Erfahrungsvollzüge des Lernens
„Gewöhnlich meint man, das Ich sei jemand, der aus den eigenen Augen herausschaut wie aus einem Fenster, um die Welt zu betrachten, die sich in ihrer ganzen Weite vor ihm erstreckt. Also gibt es ein Fenster, das sich zur Welt auftut. Draußen ist die Welt. Und drinnen? Auch die Welt, was denn sonst?“
(„Herr Palomar“ von Italo Calvino)
Wie Gilbert, Protagonist einer Vignette (in diesem Buch), während des Unterrichts immer wieder neugierige Blicke aus dem Fenster wirft und dabei die regelmäßige Wiederkehr einer Gruppe von Elstern um die Mittagszeit feststellt, ist auch Herr Palomar aus der Erzählung von Italo Calvino (1985) ein ebenso eifriger Beobachter. Auch er versucht, Blicke aus dem Fenster zu werfen, wenn auch in einem übertragenen Sinn des Wortes. In der Hoffnung, die Dinge in ihrer Komplexität zu (be-)greifen und ihnen dadurch wahre Erkenntnis abzuringen, hat Herr Palomar es sich zum Ziel gesetzt, die Welt mit der richtigen Einstellung und durch exakte Wahrnehmung von außen zu ordnen und verstehbar zu machen. „Leicht kurzsichtig, wie er ist, zerstreut und introvertiert, scheint er vom Temperament her nicht gerade der Typ zu sein, den man gewöhnlich für einen Beobachter hält. Dennoch passiert es ihm immer wieder, daß sich bestimmte Dinge – eine Mauer, eine Muschelschale, ein Blatt, eine Teekanne – in sein Blickfeld drängen, als bäten sie ihn um eine längere und minutiöse Aufmerksamkeit“ (ebd., 131). Nachdem sich Herr Palomars begieriger Blick jedoch immer wieder in den Rätselhaftigkeiten und Unergründlichkeiten seiner gelebten Welt verfängt und dem auch nicht mit der Bemühung, „dabei das eigene Ich aus dem Spiel zu lassen“ (ebd., 132) beizukommen ist, kommt er schließlich zu dem Schluss, dass vom „betrachteten Ding […] die Linie ausgehen [muss], die es mit dem betrachtenden Ding verbindet. Aus dem stummen Haufen der Dinge muß etwas kommen: ein Zeichen, ein Anruf, ein Wink. Ein Ding tritt aus der Masse der anderen Dinge hervor, um etwas zu bedeuten… Aber was?“ (ebd., 133).
Die Erzählung rund um Herrn Palomar wirft die Frage nach dem Akt der Wahrnehmung als Unterschied zwischen dem Wahrnehmen als Bewusstseinsakt und der Welt als Gegenstand der Wahrnehmung auf, in der Phänomenologie als Differenz zwischen Noesis und Noema bzw. Zugangsart und Sachgehalt bezeichnet (vgl. Husserl 1950, 179ff.). Mit dieser „signifikativen Differenz“ (Waldenfels 2002, 29) im Etwas-als-Etwas-Wahrnehmen wird die Genese der Wahrnehmung einer Reflexion zugänglich und die strikte Trennung zwischen „Subjekt“ und „Objekt“, „Drinnen“ und „Draußen“ (vgl. Calvino 1985, 110) und damit der Welt, wie sie uns erscheint, und der Welt, wie sie an sich ist, vermieden. Stattdessen wird der Blick auf die Art und Weise gerichtet, in der sich ein Phänomen als eine mögliche Erscheinungsweise eines Gegenstandes von sich selbst her für den Wahrnehmenden zeigt (vgl. Heidegger 1994, 64). Die Frage, was sich zwischen uns als Wahrnehmende und dem wahrgenommenen Gegenstand im Wie der Wahrnehmung abspielt, soll hier dazu dienen, um dem näher zu kommen, was Lektüren sind. Die Vorgehensweise ist dabei mit jener zu vergleichen, die auch beim Lesen einer Vignette selbst zur Anwendung kommt. Den in der Vignette verkörperten Erfahrungen des Lernens soll in Suchbewegungen immer nähergekommen werden, ohne das aus den Augen zu verlieren, was sich dem ersten und auch dem zweiten Blick verschließt und sich vielleicht auch nicht einem dritten Blick öffnet. Bereits Herr Palomar macht die eigentümliche Erfahrung, dass die Dinge ihm in dem Maße fremd werden, wie er ihnen scheinbar näherkommt.
Vignetten können uns darauf aufmerksam machen, dass Menschen als „Erfahrungstiere“ (vgl. Foucault 1996) stets mehr tun, als lediglich neutrale Fensterblicke auf eine unbewegliche und wohlgeordnete Wirklichkeit zu werfen. Als leibliche Wesen sind wir keineswegs nur Subjekte, die einer vermeintlich objektiven Welt frontal gegenüberstehen. Vielmehr finden wir uns vor in einer Welt, die wir hören, riechen, berühren, sehen und schmecken, in der wir, kurz gesagt, Erfahrungen machen, aus denen wir verändert hervorgehen (vgl. ebd., 24). Stets nehmen wir im handelnden Umgang mit der Welt etwas als ein bestimmtes Etwas wahr, sodass wahrgenommener Gegenstand (Sachverhalt) und unsere Wahrnehmung davon (Zugangsart) nicht voneinander zu trennen sind (vgl. Waldenfels 1992, 19). Ein einfaches Beispiel, das einen Gegenstand in den Vordergrund stellt, der zweckgemäß in seiner Funktion als Schlüsselanhänger Verwendung findet, mag diesen Gedankengang veranschaulichen: So gerät dieser in seinem sachgemäßen Gebrauch lediglich als ein Schlüsselanhänger in den Blick. Je nach Situation, nach früheren Erfahrungen oder augenblicklichen Interessen kann er jedoch auch als Wurfgeschoss oder als Spielgegenstand wahrgenommen werden (vgl. Agostini 2015, 146). „Anders wahrnehmen ist Anderes wahrnehmen“, bemerkt der französisch-litauische Philosoph Emmanuel Lévinas (1983, 156). Indem ein Gegenstand in einer bestimmten Art und Weise wahrgenommen wird, tritt er in unserer Erfahrung als ein ganz bestimmter Gegenstand auf. Dass ein Gegenstand als ein bestimmter Gegenstand erscheint, meint nicht, dass er ein bestimmter Gegenstand ist, sondern dass er zu einem bestimmten Gegenstand wird, indem er einen Sinn gewinnt und sich damit überhaupt erst als ein bestimmter Gegenstand zeigen kann. Diesem Gegenstand haftet eine unabdingbare Perspektivität an, denn „schattenlos erkennt allein der Gott“ (Fink 1976, 203). Gerade als leiblich Wahrnehmende können wir niemals einen absoluten Beobachterstandpunkt einnehmen, sondern die Erfahrungsgegenstände lediglich in ihren Grenzen, beispielsweise vor einem bestimmten (theoretischen) Hintergrund, in einem bestimmten Kontext und mit einem bestimmten Sinn zum Erscheinen bringen. Wir, die wir eine konstitutive Bedeutung für die jeweilige Erscheinungsweise des wahrgenommenen Gegenstandes haben, müssen damit zugleich mit der Kränkung leben, dass die Gegenstände auch ohne unsere Beteiligung existieren. Genauso wie der Schüler Gilbert intuitiv ahnt, dass sich die Elstern vor dem Fenster auch ohne seinen aufmerksamen Blick auf dem Schulhof versammeln, macht Herr Palomar die Erfahrung, dass der ganz plötzlich auftauchende Nachmittagsmond als visuelle Erscheinung auf seine Perzeption nicht angewiesen ist (vgl. Calvino 1985, 46).
Lektüre ist, vereinfacht ausgedrückt, der Versuch zu verstehen, was sich zwischen Menschen und Welt, Wahrnehmenden und Wahrgenommenem ereignet. Notwendigerweise geht mit diesem Versuch, eine bestimmte Erscheinungsweise eines Gegenstandes zu begreifen und die Sinnstrukturen reflexiv zu untersuchen, keine Vereinfachung, sondern eine Steigerung von Komplexität einher (vgl. Merleau-Ponty, 1976). Nicht nur in den Vignetten, auch in den Lektüren sind die Forschenden „einem höchst fragilen Ereignis, nämlich dem Moment, in dem Sinn entsteht“ (Meyer-Drawe 2010, 7), auf der Spur. Diese Genesis von Sinn, beispielsweise im Übergang von einem „lebensweltliche[n] Auskennen“ zu einem „wissenschaftliche[n] Erkennen“ (Meyer-Drawe 1996, 88), in Worte zu kleiden und somit für die sinnlich-leiblichen und jeglicher Reflexion vorausgehenden Expressionen einen sprachlichen Ausdruck zu finden, ist das Anliegen der Lektüre. In den Vignetten werden durch die sprachlichen Verdichtungen die Bedeutungen des Wahrgenommenen mitkonstituiert. Durch diese gezielte Komposition und Darstellung wird der Wahrnehmungsfokus in der Lektüre bereits auf eine bestimmte Auswahl von Erfahrungselementen gerichtet. Obgleich Vignetten somit in eine bestimmte Richtung deuten, generieren sie in ihrer „anschauliche[n] Dichte“ (Gabriel 2010, 379), aufgrund ihrer leiblichen und vorreflexiven Elemente, spürbare Sinn- und Bedeutungsüberschüsse für die Lesenden. Damit zeigen Vignetten im Sinne der ursprünglichen Bedeutung des Wortes ‚deuten‘ „in eine Richtung […], d. h. aber in ein Offenes, das sich verschieden ausfüllen kann“ (Gadamer 1967, 10f.). Wenn also auf dieser elementaren Ebene von Deutung gesprochen wird, so muss diese im Sinne einer produktiven Deutung, als Antwort auf den Sinnüberschuss, der Prägnanz des Wahrgenommenen verstanden werden, die von der explikativen Deutung vorliegender Sinn- und Textbestände zu unterscheiden ist (vgl. Waldenfels 2004b, 813). Damit steht in der Lektüre weniger das Geben von abschließenden Antworten in Form von Erklärungen, von Zuschreibungen oder Festschreibungen im Vordergrund, als vielmehr das Aufwerfen von Fragen, die dazu einladen, sich auf die niemals eindeutigen Spuren des Lernens zu begeben.
Die sprachlich minutiösen Beschreibungen der leiblichen Expressionen, angezeigt durch die Blicke, die zwischen den Lehrenden, den Lernenden und den Forschenden hin und her wandern, und ihre Bewegungen in Zeit und Raum lassen einen bedeutungsschwangeren Resonanzraum entstehen und bringen die Vignette zum Klingen. Diese klingende Bedeutungsvielfalt einer Vignette ermutigt, diesen Klang „als Fortsetzung einer Artikulation […], die ihren Anfang in der gelebten Welt selbst nimmt“ (Meyer-Drawe 2010, 7) in der Lektüre der Vignette aufzunehmen und mit eigenen Bedeutungen zu versehen. Um dem Klang der Vignette in all seinen Tonvariationen und Bewegungsnuancen angemessen nachspüren zu können, ist ein Einstellungswechsel bei uns als Wahrnehmende erforderlich. So muss in der phänomenologischen Grundhaltung der „Epoché“43 durch die Möglichkeit zur Distanzierung die vorreflexive Wahrnehmungswelt suspendiert werden, in der wir von vermeintlich objektiven Gegenständen ausgehen (vgl. Husserl 1962, 260). In der phänomenologischen Reduktion wird anschließend skeptisch die Beziehung zwischen Gegenstand der Wahrnehmung und uns als Wahrnehmende reflektiert (vgl. Husserl 1973, 61). Da die Lektüre ihren Ausgangspunkt bei unseren eigenen Erfahrungen nimmt, versuchen wir, die Vignette von unserer Lebenswelt her zu verstehen, im erkundenden Modus unserer vorwissenschaftlichen Welterfahrung als selbstverständliche, unbefragte Basis unseres alltäglichen Denkens und Handelns. Allerdings dürfen wir nicht vollständig in diesen Erfahrungswelten aufgehen, da wir sonst die in den Vignetten verdichteten Erfahrungsspuren nicht mehr angemessen reflektieren können. Konkret ist damit eine Suspendierung der lebensweltlichen Formen des Wissens und Meinens gemeint, sodass vage Vormeinungen und Vorverständnisse, mit denen schulisches Lernen, beispielsweise aufgrund der eigenen Schulerfahrungen, behaftet ist, zum Vorschein kommen, aber ebenso suspendiert sind. Zugleich bedeutet dies einen methodischen Bruch mit der Befangenheit in unseren Erfahrungsvollzügen, der es uns erlaubt, in einem ersten Schritt zu ihnen auf Distanz zu gehen, um in einem zweiten umso deutlicher unserer Verstrickung mit ihnen gewahr zu werden sowie diese Vollzüge im Modus des Etwas-als-Etwas beschreiben zu können. Damit wird die phänomenologische Reduktion, welche in den Vignetten beginnt, in der Lektüre fortgesetzt: Der Unterschied zwischen Thema und Deutung bzw. Sachverhalt und Zugangsart wird in den Blick genommen und das, „was sich zeigt, auf die Art und Weise zurückgeführt, wie es sich zeigt“ (Waldenfels 1992, 15).
Fragen, die in der Lektüre im Vordergrund stehen, sind die folgenden: Als was zeigt sich in der Vignette ein ganz bestimmter Gegenstand? Wie zeigt sich dieser? So gerät beispielsweise ein Gummiband in seinem zweckmäßigen Gebrauch lediglich als elastisches Band in den Blick. Aufgrund der produktiven Vieldeutigkeit der Dinge kann das Gummiband je nach Situation jedoch auch als Kaugummi oder als Gegenstand zur Veranschaulichung eines didaktischen Sachverhaltes wahrgenommen werden (vgl. die Lektüre „Die produktive Kluft zwischen Lehren und Lernen. Oder: Spannung liegt in der Luft“ von Agostini in diesem Buch). Als was zeigt sich in der Vignette ein ganz bestimmtes Phänomen? Wie zeigt sich dieses? So affiziert uns in einer anderen Vignette zum Beispiel der Satz der Schülerin Sara: „Du und du und du – ihr dürft auch nicht singen.“ In der Lektüre von Hans Karl Peterlini wird deutlich, dass je nach Zugangsart dieses Nicht-Dürfen auch als Nicht-Wollen oder als Nicht-Können gedeutet werden kann. Wenn wir etwas aufgrund seines Auftretens in unserer Erfahrung als ein bestimmtes Etwas deuten, dann weist dieses „als“ unweigerlich auf einen Bruch hin, der jeglicher Wahrnehmung immanent ist. Die Form der Deutung, die in der Lektüre zur Anwendung kommt, entspricht dabei im Sinne des deutschen Philosophen Hans-Georg Gadamer (1967, 10f.) dem „pointing to“ (Finlay 2009, 11), das sich ganz klar von einem „pointing out the meaning of something by imposing an external framework“ (ebd.) abgrenzt. Die erstgenannte Art der Deutung ist im Gegensatz zur zweitgenannten nicht ein Herauslesen von Bedeutungen aufgrund einer externen Bedeutungszuschreibung, welche mit dem Überstülpen eines fremden Theorierahmens einhergeht, sondern ein Hindeuten auf etwas, sodass sich, je nach Zugangsart, etwas zuallererst als ein bestimmtes Etwas zeigen kann. Im Verlauf der Lektüre kommt es darauf an, dieses „als“, das einen Spalt zwischen dem gegebenen Gegenstand als solchem und dem Gegenstand unserer Wahrnehmung auftut und damit überhaupt erst Sinn oder Bedeutung entstehen lässt (vgl. Waldenfels 2002, 378), so genau wie möglich zu beschreiben. Dies geschieht im responsiven Antworten auf jene Erfahrungen in den Vignetten, welche die Lesenden ansprechen und betroffen machen. „Diese Polyphonie ruft Resonanzen hervor, die zum schreibenden Erläutern drängen, das sich in den Lektüren niederschlägt oder festsetzt, die verschriftlichte Schatten der eigenen Erfahrung, Stellungnahmen oder eines Standortes im Rahmen eines gegebenen Horizontes sein können“ (Baur & Schratz 2015, 172). Da eine Aufforderung immer eine Aufforderung von etwas für jemanden darstellt, kommt je nach Lesendem/Lesender anderes zum Vorschein und in den Blick. Wichtig ist, dass die (theoretische) Herkunft der Lesarten aufgezeigt und für andere transparent gemacht wird (vgl. Schratz, Schwarz & Westfall-Greiter 2012, 39). Die Mitglieder der Forschungsgruppe versuchen daher diese in den Vignetten verdichteten Erfahrungen aufzugreifen und in der Lektüre als jene zur Sprache zu bringen, als welche sie sich den Lesenden ausgehend von den Erfahrungen der Lernenden zeigen. In der Lektüre wird damit ein Reflexionsraum eröffnet, indem die in der Vignette dargestellten und in der Lebenswelt der Schüler/innen und der Forschenden verwurzelten prä-reflexiven und vor-bewussten Zusammenhänge mit spezifischen (theoretischen) Bezügen als eine bestimmte Erfahrung expliziert und diese somit zugänglich und verstehbar gemacht werden. Denn, wie Beekmann (1987, 23) meint, werden diese Zusammenhänge „im Erleben und im Tun nicht immer als solche erkannt und thematisch“. Wie die Pädagogin und Phänomenologin Käte Meyer-Drawe (2011, 24) betont, besteht die „paradoxe Aufgabe des sprachlichen Ausdrucks […] in diesem Kontext darin, das zur Erscheinung zu bringen, was, um zu existieren, seiner nicht bedarf, das aber, um verstanden zu werden, auf ihn angewiesen ist“.
Während sich das Schreiben der Vignette am Konzept des Beispiel-Gebens orientiert, richtet sich die Lektüre einer Vignette am Beispiel-Verstehen aus. In dem skizzierten Erfahrungsreichtum, den Vignetten artikulieren, verweisen sie ebenso wie Beispiele auf intersubjektive und damit relationale Erfahrungen, welche intuitiv nachvollzogen und deshalb wieder erkannt werden können. Der Sinn einer Vignette als Beispiel erschließt sich nämlich „nicht als Objektivierung und Generalisierung einer allgemeinen Regel, sondern er stellt sich im intuitiven Nachvollzug ein“ (Brinkmann, 2012b, 44). Damit machen wir als Lesende anhand der Vignette und der in ihr dargestellten Erfahrung eine eigentümliche Evidenz-Erfahrung, in welcher das Phänomen, um das es in dem konkreten Beispiel geht, vor Augen gebracht wird. Dabei transzendiert die eigentümliche Struktur des Beispiels seine eigene Absicht, sodass gezeigt und nicht gesagt wird, wie das Beispiel verstanden werden soll. Günther Buck (vgl. 1989, 97ff.), ein deutscher Philosoph und Pädagoge, hat das Beispiel unter Bezugnahme auf die Epagoge, das heißt bei Aristoteles den Weg der „Hinführung“ eines Einzelnen und Besonderen zum Allgemeinen, als eine wichtige Möglichkeit der Verständigung, des Verstehens sowie des Lernens wiederentdeckt. Er nimmt eine genaue Analyse der reflexiven „Zirkelstruktur“ (Buck 1989, 158) des intuitiven Verstehensprozesses vor, der durch das Beispiel in Gang kommt. Diese Struktur der Reflexivität eröffnet Bedeutungszusammenhänge und ermöglicht es, dass „Beispiele […] über sich hinaus[weisen], indem sie auf etwas zurückweisen“ (ebd., 157). Damit ermöglicht die spezifische Struktur des Beispiels, dass die konkrete und besondere Erfahrung, die am Beispiel zur Darstellung kommt, auf eigene vergangene Erfahrungen verweist. Zugleich wird durch das Beispiel die Möglichkeit der zukünftigen Erkenntnis für eine Vielzahl von Erfahrungen von gleicher oder analoger Natur eröffnet (vgl. ebd., 40). Indem das Beispiel auf uns als Nachvollziehende zielt, müssen wir die Erfahrungsvollzüge, welche Vignetten verkörpern, immer schon in einer gewissen Art und Weise selbst unausdrücklich vorverstanden haben. Im Lesen des Beispiels wird dieses unausgedrückte, unbestimmte und naive Erfahrungswissen aufgrund von eigenen Erwartungen als unreflektiertes Verständnis eines besonderen Falles thematisch und ein allgemeiner Sinn wird explizit. Mit der Absicht, jemanden zum Nachdenken zu bewegen, vergegenwärtigen Beispiele somit einen bestimmten Erfahrungsvollzug, der widerfährt und sich aufdrängt. Ausgehend von eigenen vorreflexiven Erfahrungen erfolgt in einer reflexiven Rückwendung auf unser Vorverständnis eine Konfrontation mit dem in unseren Erfahrungen wirksamen Vorwissen sowie mit uns selbst als Lernenden. Nur weil wir vertraute Erfahrungen gemacht haben, verweisen Beispiele damit auf frühere Erfahrungen, sodass wir, werden Erwartungen nicht erfüllt, eine neue Erfahrung machen, aufgrund derer das eigene Vorwissen über eine Sache und uns selbst als Lernende umstrukturiert werden muss – und wir dabei selbst lernen (vgl. Meyer-Drawe 2012b, 15; vgl. auch Buck 1989, 80). Die alte Erfahrung und ihr Gegenstand des Wissens werden – wie dies insbesondere neurobiologische Diskurse vermuten lassen könnten – jedoch nicht einfach ersetzt, sondern lediglich in ihrer alleinigen Gültigkeit in Frage gestellt sowie neu indiziert. Alte Meinungen und Auffassungen gelangen zu Bewusstsein, ohne dass sie aufgelöst werden (vgl. Meyer-Drawe 1996, 89).
Im Gegensatz zu einem interpretativen, hermeneutischen Verstehenszugang, so wie er von Günther Buck (1989) angestrebt wird, und der sich vorwiegend auf sprachliche Akte und schriftliche Zeugnisse konzentriert, wird bei einer phänomenologischen Betrachtungsweise die in den Vignetten verkörperte „Leibhaftigkeit der Wahrnehmung“ (Brinkmann 2014, 216) ernst genommen und die für uns fremde Erfahrung im Zwischenfeld von Skepsis und Naivität nicht lediglich als Defizit im Sinne einer noch-nicht verstandenen Erfahrung angesehen, sondern als Widerständiges und Unbestimmtes, das sich einem radikalen Verstehen entzieht (vgl. Meyer-Drawe 2003, 505; Agostini 2016, 81). Nur dadurch ist es möglich, das in der Vignette zur Darstellung kommende Fremde und Andere in der Lektüre nicht zu assimilieren und damit einhergehend vorgefundenen Sinn lediglich zu rekonstruieren, sondern aus dem Bestehenden etwas Neues und aus dem Vorhandenen einen Vorgriff auf etwas Nichtvorhandenes zu generieren (vgl. Brinkmann, 2014, 200ff.). „Eine unmittelbare Sicht auf Lernen ist uns versagt“, so Käte Meyer-Drawe (1996, 89). Einerseits entfernen wir uns in der Lektüre von den lebendigen Erfahrungsvollzügen, die in der Vignette anhand von konkreten Handlungen beschrieben werden, andererseits kann erst in der Distanz zu diesen, in der nachträglichen und perspektivistischen Reflexion des Geschehens, ein neuer Sinn gestiftet werden. Es sind gerade diese Grenzen pädagogischen Verstehens, welche einen Überschuss freisetzen und damit die Produktivität und Revision von le...