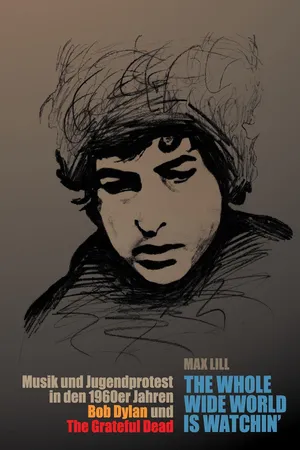
eBook - ePub
the whole wide world is watchin'
Musik und Jugendprotest in den 1960er Jahren - Bob Dylan und The Grateful Dead
- 364 pages
- English
- ePUB (mobile friendly)
- Available on iOS & Android
eBook - ePub
the whole wide world is watchin'
Musik und Jugendprotest in den 1960er Jahren - Bob Dylan und The Grateful Dead
About this book
An den Wendepunkten der Geschichte werdenMythen geboren. Leidenschaft und Verwirrungsind meist so groß, dass erst später, wennder Staub sich gelegt hat, sichtbar wird, wasgeschah. Vorausgesetzt, wir erinnern uns noch.Dieses Buch führt zurück an einige der Orte, an denen die Jugendrevolte begann — langevor 1968: in die Kellergewölbe des New YorkerGreenwich Village und die viktorianischenVillen von Haight Ashbury. Es wandert durchdie Geschichte sozialer Bewegungen undPopulärkulturen, um einer Frage nachzuspüren: Wie war es möglich, dass Musik ins Zentrumeiner gesellschaftlichen Umwälzung rückte —und mit ihr ein schattenhafter junger Künstler, der vieles war und sein wollte, nur keinSprecher einer Bewegung oder Generation.
Frequently asked questions
Yes, you can cancel anytime from the Subscription tab in your account settings on the Perlego website. Your subscription will stay active until the end of your current billing period. Learn how to cancel your subscription.
No, books cannot be downloaded as external files, such as PDFs, for use outside of Perlego. However, you can download books within the Perlego app for offline reading on mobile or tablet. Learn more here.
Perlego offers two plans: Essential and Complete
- Essential is ideal for learners and professionals who enjoy exploring a wide range of subjects. Access the Essential Library with 800,000+ trusted titles and best-sellers across business, personal growth, and the humanities. Includes unlimited reading time and Standard Read Aloud voice.
- Complete: Perfect for advanced learners and researchers needing full, unrestricted access. Unlock 1.4M+ books across hundreds of subjects, including academic and specialized titles. The Complete Plan also includes advanced features like Premium Read Aloud and Research Assistant.
We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.
Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.
Yes! You can use the Perlego app on both iOS or Android devices to read anytime, anywhere — even offline. Perfect for commutes or when you’re on the go.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Yes, you can access the whole wide world is watchin' by Max Lill in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in Politics & International Relations & Political Freedom. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.
Information
1 EINLEITUNG
There’s a time when the operation of the machine becomes so odious, makes you so sick at heart, that you can’t take part. You can’t even passively take part. And you’ve got to put your bodies upon the gears and upon the wheels, upon the levers, upon all the apparatus, and you’ve got to make it stop. And you’ve got to indicate to the people who run it, to the people who own it, that unless you’re free, the machine will be prevented from working at all! Mario Savio (Berkeley 1964)1
FOLK- UND ROCKMUSIK: KRISTALLISATIONSPUNKT DER „GROSSEN WEIGERUNG“
Versetzen wir uns zu Beginn einen Moment zurück ins Jahr 1967: Das Monterey-Festival nahe San Francisco hat soeben den „Summer of Love“ eingeläutet. Die Studentenbewegung gewinnt seit mindestens drei Jahren kontinuierlich an Kraft – nicht nur im nahe gelegenen Berkeley, wo sie mit den „Freedom Rides“ gegen die „Rassensegregation“ im Süden und dem „Free Speech Movement“ ihren Anfang genommen hatte. Ein großer Teil der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung schließt sich unter Martin Luther King den Vietnamkriegs-Protesten an und kämpft im Bündnis mit Gewerkschafter_innen nun auch für höhere Löhne und eine grundlegende Umwälzung der Eigentumsverhältnisse. Nachdem die meisten Kolonialregime bereits unter dem Druck der Befreiungsbewegungen gefallen sind, attackiert eine jüngere Generation schwarzer Aktivist_innen unter dem Slogan „Black is beautiful!“ und der Forderung nach „Black Power“ die rassistischen Imaginationen der Mehrheitsgesellschaft und schüttelt so, wenigstens für einen historischen Augenblick, die kollektive Erfahrung Jahrhunderte währender Erniedrigungen ab. Der Funke der Revolte springt nach Europa über. In Berlin löst der tödliche Schuss auf den Studenten Benno Ohnesorg eine rasche Ausweitung und Radikalisierung der Proteste aus. Auch jenseits des „eisernen Vorhangs“ gärt es: In der Tschechoslowakei brechen Studentenproteste los, erste Vorboten des „Prager Frühlings“. Noch sind die Hoffnungen auf fundamentalen Wandel lebendig. Erst im darauf folgenden Jahr, dem für den Westen turbulentesten in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, werden die sozialen Bewegungen schwere Rückschläge erleiden – u. a. durch politische Morde, Repression und wachsende Militanz, in den USA auch durch einen politischen Rechtsruck infolge der Wahl von Richard Nixon. Die von Nationalgarden blutig niedergeschlagenen Unruhen in den vorwiegend von Schwarzen bewohnten Ghettos der US-Metropolen lassen diese Perspektive eines neokonservativen und schließlich neoliberalen Rollbacks nur erahnen. Erst im Verlauf der 1970er Jahre wird sich dieser Entwicklungspfad, über zahlreiche Kämpfe und alternative Suchbewegungen hinweg, allmählich verfestigen.
In jenem Jahr 1967, auf dem Höhe- und Umschlagspunkt der sozialen Bewegungen in den USA, erscheint die erste Ausgabe des Rolling Stone – damals noch ein gemäßigtes Organ der Alternativöffentlichkeit der Gegenkulturen. In dessen programmatischem Editorial schreibt Jann S. Wenner:
Die Rockmusik ist das Energiezentrum aller Arten von Veränderung, die sich rapide um uns entfalten: sozial, politisch, kulturell und wie immer man es beschreiben will. Tatsache ist, dass für viele von uns, die nach dem zweiten Weltkrieg aufwuchsen, der Rock den ersten revolutionären Einblick in uns selbst lieferte. (Zitiert nach Wicke 2004, S. 129)
Man mag den euphorischen Überschwang und das Pathos dieser Huldigung des Rock heute, wo dieses leicht angestaubte Genre zum Mainstream gehört und nicht selten mit narzisstischem, männlichem Potenzgehabe assoziiert wird, belächeln. Und doch fängt das Zitat die enorme symbolische Aufladung dieser damals noch sehr jungen Musik treffend ein. Rockmusik erscheint nicht nur als markantester Ausdruck des kollektiven Bedürfnisses nach radikaler Veränderung sowohl der Gesellschaft als auch der eigenen Person. Sie vermittelt vielmehr „Einblick“, gilt als elementare Form der Erkenntnis und Kristallisationspunkt der „großen Weigerung“ (Marcuse).
Auch innerhalb der Bewegungsforschung wird mit Blick auf die, vor allem von jungen Menschen getragenen, Proteste der 1960er Jahre die zentrale Funktion der Musik für die Repräsentation geteilter Erfahrungen und damit die Konstruktion „kollektiver Protestidentitäten“ betont.2 So lautet etwa die, in diesem Falle allerdings vor allem auf das Folk-Revival3 bezogene, These von Ron Eyerman und Andrew Jamison:
During the early to mid-1960s the collective identity of what was later called The Movement was articulated not merely through organisations or even mass demonstrations, although there were plenty of both, but perhaps even more significantly through popular music. (Eyerman/Jamison 1995, S. 452)
Das Ausmaß, in dem in den 1960er Jahren Musik ins Zentrum einer gesellschaftlichen Umbruchkonstellation rückte, dürfte für die westlichen Gesellschaften historisch beispiellos sein. Norbert Frei stellt in seiner zum Jubiläumsjahr 2008 erschienen Studie über „1968“ sogar fest: Musik war „die ohne jeden Zweifel wichtigste kulturelle Artikulationsform und Antriebskraft des Jahrzehnts“ (Frei 2008, S. 63).
Dies wirft weit reichende Fragen zum Charakter und historischen Stellenwert der Jugendrevolten der 1960er Jahre und der sie repräsentierenden Musik auf. Einigen dieser Fragen geht die vorliegende Arbeit nach.
Parallelen und Verknüpfungen zwischen der Entstehung des Folk-Revivals und der Rockmusik einerseits und politisch-kulturellen Orientierungen und Aktionen der sozialen Bewegungen andererseits sind vielfach herausgearbeitet worden – vor allem durch den Nachweis inhaltlicher und personeller Überschneidungen.4 Dabei wird immer wieder auf die Rolle der Musik als Verbreitungsmedium der „kognitiven Praxisformen“ der sozialen Bewegungen hingewiesen. Zunächst der sozialkritische Folk und ab Mitte des Jahrzehnts vor allem die Rockmusik wirkten demnach als Katalysatoren der Proteste, akustische „Brandbeschleuniger“, welche die verbindenden Leitideen und Erzählungen der sozialen Bewegungen in eine hoch emotionalisierte musikalische Form übersetzten und sie damit weit über den harten Kern der politisch Aktiven hinaus popularisierten. Entsprechende Analysen konzentrieren sich in der Regel auf die explizite Artikulation von normativ gehaltvollen Deutungsweisen und Forderungen der sozialen Bewegungen durch Musiker_innen. Zugleich zeigen sie, inwieweit letztere in- und außerhalb der Bewegungsöffentlichkeiten als herausragende Repräsentant_innen etwa des Kampfes gegen Rassismus und den Vietnamkrieg oder als Personifikation von Ausstiegsphantasien wahrgenommen wurden. Songtexte, Aufführungs- und Rezeptionskontexte oder verbalisierte Deutungsweisen in der Alternativ- oder Mainstreamöffentlichkeit geraten damit ins Blickfeld der Forschung. Auf diese Weise lässt sich empirisch nachweisen, dass die Musik der aufbegehrenden Jugendlichen damals als unmittelbar politisch empfunden wurde und zentral war für die Ausgestaltung kollektiver Protestidentitäten.
Die weitergehende Frage, wieso gerade Musik (und wieso gerade diese Musik) vor vierzig Jahren eine symbolische Bedeutung erlangen konnte, die heutzutage selbst hoch politisierte Liebhaber_innen der Rock- und Folkmusik zu irritieren vermag, kann auf diesem Wege jedoch nicht wirklich geklärt werden. Genauso wenig lässt sich bestimmen, in welcher Weise die Fokussierung auf spezifische musikvermittelte Vergemeinschaftungsformen die sozialen Bewegungen und Gegenkulturen prägte und damit den Lauf der Geschichte nachhaltig beeinflusste. Der Nachweis, dass die Songs populärer Bands faktisch als Mittel des Aufbegehrens eingesetzt und wahrgenommen wurden, müsste ergänzt werden durch den Versuch einer historisch und theoretisch weiter ausgreifenden und zugleich exemplarisch in die Tiefe gehenden Deutung des Verhältnisses von Musik und politisch-kulturellem Protest. Hierzu einen Beitrag zu leisten, ist eine Hauptintention der vorliegenden Arbeit.
ZEITENWENDE DAMALS UND HEUTE: DAS GEGENWÄRTIGE IM ERINNERTEN UND DER „TRAUM VON EINER SACHE“
Meine Untersuchung zielt zugleich auf eine, als dezidiert politisch verstandene, Erinnerungsarbeit. Das im kollektiven Gedächtnis tradierte Bild der Gegenkulturen der 1960er Jahre ist Gegenstand anhaltender Deutungskämpfe. Nachträgliche Entwicklungen, Konflikte und Ideologien der Gegenwart filtern unseren Blick auf das Vergangene, geben ihm eine je spezifische, meist unreflektierte Tönung. Das ist immer so. Aber nur selten tritt das Gegenwärtige im Erinnerten so scharf hervor, macht sich in so hitzigen Kontroversen geltend, wie in diesem Fall. Die 1960er Jahre und ihre Musik sind uns auf eigentümliche Weise nah – vielleicht zu nah, um sie nüchtern zu betrachten. Das gilt auch für Nachgeborene wie mich, zumindest dann, wenn sie im Umfeld der Neuen Sozialen Bewegungen und der aus ihnen hervorgegangenen Milieus sozialisiert wurden, wenn sie die Klänge der Revolte schon als Kind aus der Stereoanlage der Eltern gehört haben.
Mit diesem Hinweis soll mein wissenschaftlicher Anspruch nicht relativiert werden. Vielmehr denke ich, dass die Suche nach einer quasi unparteiischen Diagnose, mit der die vergangenen Kämpfe „zu den Akten gelegt“ werden könnten, eine falsche Zielstellung wäre. Die Arbeit des Verstandes muss das eigene emotionale involviert Sein und den unauflöslichen Konfliktcharakter der Geschichtsschreibung transparent machen, ihre normativen Maßstäbe hinterfragen und ggf. neu justieren, statt sie zu verwerfen bzw. schlechterdings zu leugnen. Für mich heißt das vor allem: Der emanzipatorische Gehalt der damaligen Bewegungen soll ein Stück weit freigelegt und zugleich in seinen historischen Grenzen reflektiert werden.
Das scheint mir heute, mitten in einer neuerlichen großen Krise und Transformation des Kapitalismus, in besonderem Maße geboten (vgl. hierzu insbesondere Kapitel 5.1). Die sozialen Bewegungen stellen wieder unüberhörbar die Systemfrage, sie fordern einen radikalen Bruch mit den etablierten Institutionen, um „echte Demokratie“ möglich zu machen. Sie beginnen, ihre Zeit wieder als eine zu begreifen, in der die Weichen neu gestellt werden. Als die Aktivist_innen von Occupy Wallstreet im Herbst 2011 die Brooklyn Bridge blockierten und ihre Massenverhaftung eine globale Welle der Solidarität auslöste, da riefen sie einen Slogan, der schon 1968 zu hören war. Damals ging er von den gewaltsam niedergeschlagenen Protesten anlässlich des Demokratischen Parteitages in Chicago aus. Nach der Ermordung des Präsidentschaftskandidaten Robert Kennedy wurden dort die Hoffnungen auf politischen Wandel begraben. Seiter hat sich dieser Slogan in die Protestgeschichte eingeschrieben. Er war auch 1999, als die globalisierungskritische Bewegung mit der Blockade der WTO-Konferenz in Seattle ihren Durchbruch erreichte, zu hören. Er lautet: „The whole world is watching“.
Dieser Ausruf drückte in der Geschichte der sozialen Bewegungen immer wieder das Bewusstsein für einen historischen Moment aus, jenen Augenblick, in dem sich viele Menschen gemeinsam und zugleich als je Einzelne entschieden, ihre Körper in einem Akt des zivilen Ungehorsams der Gewalt der Herrschenden entgegenzustellen, eben weil sie wussten oder wenigstens hofften, dass die Blicke der Welt auf sie gerichtet waren und ihr Beispiel so etwas wie einen ethisch-moralischen Schock auszulösen vermochte. Den wenigsten jungen Aktivist_innen unserer Tage dürfte bewusst sein, dass es sich bei diesem Slogan um die Abwandlung der Zeile aus einem Folk-Song handelt, einem Lied, das ein junger, der größeren Öffentlichkeit noch kaum bekannter Sänger beim Marsch auf Washington 1963, dem Höhepunkt der Bürgerrechtsbewegung, vortrug, direkt neben Martin Luther King, der an selber Stelle seine historische Rede unter dem Titel I Have A Dream hielt. Der Name dieses Sängers war Bob Dylan.
Anders als die damaligen Bewegungen, die die Zeit auf ihrer Seite wähnten, stehen die Aktivist_innen von heute (wenigstens in Europa und den USA) mehr oder weniger bewusst mit dem Rücken zur Wand – politisch, aber auch kulturell: Ihr revolutionäres Selbstverständnis wirkt nicht nur angesichts der faktischen Kräfteverhältnisse etwas tollkühn. Problematischer noch erscheint mir, dass diesem radikalen politischen Anspruch auf der Ebene des Alltagsbewusstseins oft nur ein schwacher Sinn für das entspricht, was einmal als „konkrete Utopie“ bezeichnet wurde: Die in Ansätzen schon gelebte, statt bloß abstrakt postulierte Überzeugung, dass eine ganz andere Art des Zusammenlebens, des Denkens und Fühlens, wirklich möglich ist – eine Gesellschaft, in der die je besonderen Handlungs- und Empfindungsweisen eines jeden Menschen bedeutsam sind und die nicht als fernes Paradies oder beschauliches Ökodorf erscheint, sondern als der „Traum von einer Sache“, die bei allem Irrsinn der kapitalistischen Moderne erstmals in der Menschheitsgeschichte zum Greifen nahe liegt und von der die Welt, wie der junge Marx einst schrieb, „nur das Bewusstsein besitzen muß, um sie wirklich zu besitzen.“ (Marx 1976, S. 346)
Träumen heißt immer, sich erinnern. Oder genauer: Das Erlebte in der Phantasie neu zusammenfügen. Das geschieht oft scheinbar willkürlich, dient aber immer der Verarbeitung und Integration auseinanderstrebender Erfahrungen. Manchmal helfen Träume, Verdrängtes zu Bewusstsein zu bringen oder die eigenen Wünsche und Bedürfnisse zu klären. Sie können dazu beitragen, etwas in Zukunft vielleicht Mögliches vorzustellen. Um Erkenntnisse und Veränderungen in der Welt der Wirklichkeit zu bewirken, bedürfen Träume allerdings der nachträglichen Reflexion. Ohne die rückblickende Analyse des wachen Verstandes bleibt der erträumte Möglichkeitssinn diffus und irrational. Umgekehrt wird noch der klügste Geist, dem die Fähigkeit zu träumen verloren gegangen ist, krank und destruktiv. Den Schleier zwischen beiden Welten zu lüften, das Vergessen nach dem schweren Erwachen im Morgengrauen zu überbrücken bleibt ein schwieriges, aber gerade in der Krise heilend wirkendes Projekt – das gilt auch für die Träume und Reflexionen in der Geschichte sozialer Bewegungen.
In einer Zeit, die trotz neuer Massenproteste durch verbreitete Gefühle der Ohnmacht und Entfremdung geprägt ist, gilt es, sich eine verschüttete Erinnerung an vergangene Kämpfe neu anzueignen. Dazu müssen wir uns nicht nur historische Ereignisse, Strukturen und Ideen vergegenwärtigen, sondern vor allem eine spezifische kollektive Erfahrung. Und diese Erfahrung ist in der Musik der rebellischen Jugendkulturen vermutlich auf präzisere und subtilere Weise eingefangen als in jedem anderen Medium. Die damals überkochenden Gefühle und ihre historischen Gründe klingen im kollektiven Unterbewussten nach. Sie können durch gedankliche und emotionale Grabungsarbeiten wenigstens teilweise als noch heiße Glut unter den verhärteten Schichten der hegemonialen Erinnerungskultur freigelegt werden. Die nur partiell realisierte und (vorläufig) wieder verlorene Ahnung einer reicheren menschlichen Existenzform, die ganz wesentlich in der Musik kristallisiert ist, soll durch eine historische Deutung neu angeeignet werden. Das ist der politische – und wenn man so will auch ästhetische – Sinn dieses Buches.
Ein erster Schritt zur Erinnerung dieses Erbes besteht darin, dem eigenen wie dem kollektiven Gedächtnis zu misstrauen, sich also bewusst mit den klischeebehafteten Bildern, die heute in den hegemonialen Diskursen von den Gegenkulturen der 1960er Jahre kursieren, auseinanderzusetzen. Denn mit Blick auf die so genannte 68er-Bewegung und dabei im Speziellen die Rockmusik und andere kulturelle Artikulationsformen der Jugendrevolte dominiert in Sozialwissenschaften und Öffentlichkeit eine affirmative Perspektive: Demnach bildeten die Gegenkulturen letztlich nicht mehr als eine Art Stoßtrupp für die Durchsetzung individualistischer und hedonistischer Werte. Dies wurde in den 1980er und 1990er Jahren in der Soziologie zunächst überwiegend als Ausdruck einer schönen neuen „Erlebnisgesellschaft“ (Schulze) begrüßt.5 In den massenmedialen und alltagskulturellen Sechziger-Jahre-Revivals findet sich diese Sicht häufig in Form einer banalisierenden Rekonstruktion von Fragmenten der Gegenkulturen, die als Lifestyle-Accessoires angeboten werden: Lange Haare, Batik-Klamotten, Drogen und sexuelle Befreiung, allgemein eine Liberalisierung der Umgangsformen und eine Ästhetisierung des Alltagslebens: Alles wird „schön bunt und irgendwie lockerer“. War da – abgesehen von K-Gruppen-Orthodoxie und natürlich den Gewaltexzessen der RAF – sonst noch etwas?
In der Soziologie, den Geschichtswissenschaften und der (vor allem biographisch-subjektiv geprägten) Publizistik erscheinen die mit „1968“ assoziierten Liberalisierungstendenzen des „Wertewandels“ heute – nach der exzessiven Ökonomisierung kreativer Entfaltungsbedürfnisse und im Angesicht einer Systemkrise des deregulierten Kapitalismus – nicht selten in einem anderen, weniger freundlichen Licht: Abgesehen von mystifizierten Vorst...
Table of contents
- Cover
- Titel
- Impressum
- INHALT
- Vorwort
- 1 Einleitung
- 2 Eingrenzungen
- 3 Kulturtheoretische Ausgangspunkte
- 4 Thesen und Perspektiven zu „1968“ und Rockmusik: Eine kritische Rekapitulation
- 5 Subjektivität und Öffentlichkeit: Historische Entwicklungslinien
- 6 Rock- und Folkmusik als Gegenöffentlichkeit in den 1960er Jahren: Kontroverse Annäherungen
- 7 The Grateful Dead: „…allowing us to meld our consciousnesses together“
- 8 Bob Dylan und das authentische Spiel mit Masken
- 9 Fazit
- Literatur- und Quellenverzeichnis