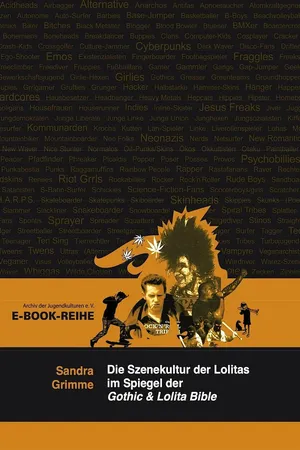![]()
1. Einleitung
Wer schon einmal einen Tōkyō-Reiseführer zur Hand genommen hat, kennt das als 'schrilles' Modeviertel beworbene Harajuku. Mit einer nahezu professionellen Fotoausrüstung, ohne die heutzutage kaum ein Reisender1 auszukommen scheint, begibt sich der Tourist auf die Jagd nach ebenso bunten Bildern, wie er ihnen bereits zuvor in seinen Recherchen begegnet ist. Am Ziel stellt er fest, dass die Takeshita Dōri von Ausländern in Turnschuhen und kurzen Hosen bevölkert wird; und die Brücke, an der sich vermeintlich jeden Sonntag die 'verrückt' gekleideten Jugendlichen treffen, scheint – sehen wir von den Touristen selbst ab – ebenfalls leer. Der Tourist ist auf der Suche nach Motiven, die er aber nicht kennt und nicht zu deuten weiß. Deshalb begnügt er sich mit dem Hello Kitty-Handyanhänger im Lolita-Look. Er ahnt nicht, dass sich die von ihm gesuchte Szene nur wenige Fußminuten weiter trifft, im Schutz des großen Kaufhauses La Foret oder in einem der vielen Läden in den schmalen Seitengassen. Auf der Omote Sandō posieren Lolitas und andere 'aufgebrezelte' Jugendliche vor großen Kameralinsen, doch diese Fotos landen nicht in irgendeinem der Flickr-Accounts2 fündig gewordener Touristen. Die Mädchen posieren für Modemagazine, um die sich weltweit Trendscouts reißen. Harajuku ist zum Inbegriff der Street Fashion geworden. Japan hat dieses Phänomen erkannt und reagiert: Das Auslandsministerium benannte am 25. Februar 2009 drei junge Damen aus dem Modeumfeld zu „Kawaii Ambassadors“ [niedliche Botschafterinnen], um für Japans stetig wachsende Popkultur weltweit zu werben. Auserkoren wurde u. a. Aoki Misako, ein bekanntes Model der Gothic & Lolita Bible (im Folgendem: G&LB),3 der führenden Zeitschrift für Liebhaberinnen der Gothic- und Lolita-Mode, die inzwischen Jahresumsätze von 20 Mrd. Yen (ca. 180 Mio. Euro) erzielt.4 Im Gegenzug zu den Botschafterinnen, die die Street Fashion im Ausland vertreten sollen, präsentieren sich internationale Popstars wie Katy Perry und Lady Gaga bei ihren Japanbesuchen von Kopf bis Fuß im Lolita-Stil. Die Mode ist damit nicht nur eine Randerscheinung, die als eine weitere Kuriosität aus Japan gelten könnte – nein, sie erreicht ein weltweites Publikum und internationale Beachtung.
Es sind Frauen, die aussehen wie Porzellanpuppen und in ihren üppig berüschten, zugeknöpften Kleidern fast alterslos erscheinen. Voreilige Schlüsse über eine frauenfeindliche, unemanzipierte Mode und Realitätsflucht lägen verlockend nahe, doch was verrät uns die größte Szenezeitschrift Gothic & Lolita Bible über diese Menschen?
Die Zeitschrift ist ein Medium, welches sich besonders zur Analyse von Mode und Szenekultur eignet. Sie ermöglicht es, verschiedene Ebenen zu betrachten, die bei einer Untersuchung berücksichtigt werden können. Werbeanzeigen zeigen und erzeugen Bedürfnisse, Models geben Leitbilder ab, Artikel wecken das Interesse für bestimmte Themen, Anleitungen lehren, wie was richtig gemacht wird, und Sprache zeigt, wer wie angesprochen wird. Was diese Mode ist, was sie zum Ausdruck bringt, was die dazugehörige Szene ausmacht und was das für Menschen sind, sind die Fragen, die mich in dieser Arbeit beschäftigen und die ich am Ende beantworten werde.
1.1 Untersuchungsgegenstand und Fragestellung
Gegenstand dieser Arbeit ist die Szenekultur der Lolitas, wie sie im japanischen Printmedium G&LB dargestellt wird. Zunächst wird der Begriff „Szenekultur“ genauer untersucht und definiert. Anhand wiederkehrender Thematik, Bildinszenierung und sprachlicher Besonderheiten in der G&LB soll eine Landkarte des Lebensstils und -inhalts der Lolita-Szene erstellt werden, um das Phänomen greifbar und verständlich zu machen. Mein Ziel ist es, zukünftige Forscher für die ausgeprägte Symbolwelt zu sensibilisieren, die diese Szene prägt, um einer der Wirklichkeit nicht gerecht werdenden Trivialisierung – speziell dieser – japanischen Ausprägung der Popkultur entgegenzuwirken. Hieraus erschließt sich meine Fragestellung: Wie sieht die Szenekultur der Lolitas nach Auffassung der Gothic & Lolita Bible aus?
1.2 Forschungsstand
Die Fachliteratur zum Phänomen der Lolita-Mode ist, gelinde gesagt, überschaubar. Es gibt durchaus Modetheoretiker, die sich dem Thema angenähert haben, jedoch ist die Datenlage, auf die sie sich beziehen, dürftig. Dr. Noriko Onohara, Dozentin an der Hyōgo Universität in Japan, schreibt derzeit an einem Buch über Vivienne Westwood, Gothic Lolita und Unterwäsche. Einige ihrer Aufsätze über dieses Thema finden sich auch auf ihrer Internetseite. Es zeigt sich, dass ihre Quelle aus einigen befreundeten Trägerinnen von Lolita-Mode besteht. Untersuchungen der Szene, die über die Feldforschung hinausgehen, wurden bisher nicht von ihr vorgenommen. Über ihre Faszination für die britische Designerin Vivienne Westwood ist sie auf die Lolita-Mode aufmerksam geworden, jedoch interessiert sie sich mehr für die Bekleidungsgegenstände und deren Herkunft als für die dazugehörige Szene (ONOHARA 2006a).5 Ihr Vortrag „Romantic European Nostalgia and Japanese ‘Gosurori’ Fashion“, welchen sie am 27. September 2009 auf der 1st Global Conference: Fashions – Exploring Critical Issues in Manchester hielt,6 bietet dennoch einige nützliche Erkenntnisse aus ihren bisherigen Forschungen. Sie behauptet zwar, dass sich die Lolita-Mode im Westen bereits als Forschungsobjekt etabliert hätte,7 jedoch sind diese westlichen Forschungsbeiträge bisher sehr eingeschränkt und fokussieren auf die Beschreibung des Phänomens und dessen Verbreitung im Westen.
Die G&LB blieb bisher nur genannt und wurde selbst noch nicht untersucht. Matsuura Momo, die ihr Pädagogikstudium an der Yokohama National University absolviert hat, ist dagegen selber bereits seit 2002 dem Reiz der Lolita-Mode verfallen und präsentierte 2007 ihr Buch sekai to watashi to rorītafasshon [Die Welt, Ich und Lolita-Mode], welches sich vor allem mit der Entstehungsgeschichte und Entwicklung der Lolita-Mode befasst. Dabei stützt sie sich stets auf den Schriftsteller Takemoto Nobara, der diverse Romane zum Thema Lolita geschrieben hat. Auch Ueda Yūko, die als freie Schriftstellerin und Redakteurin an diversen Projekten arbeitet, befasste sich mit den zahlreichen 'Regeln', welche mit der Lolita-Mode verbunden sind. Daraus resultierten ihre beiden lexikonähnlichen Werke rorīta ishōdōraku – Lolita Fashion Fancier I und II, die jeweils 2005 bzw. 2006 erschienen. Mit der Repräsentation von Lolita-Mode in den Medien befasst sich nur Matsuura peripher, wobei er sich dabei lediglich auf die Nennung einiger Medien, wie der G&LB, beschränkt.
Die Analyse von Mode und Darstellungen in Zeitschriften ist freilich nicht neu. Auf diesem Feld finden sich viele wissenschaftliche Aufsätze, die Inhalte, Werbung, Schönheitsideale und Rollenstereotype der Frau untersucht haben. Ochiai Emiko, Professorin für Soziologie an der Graduate School of Letters der Kyōto Universität, untersuchte Darstellungen von Frauen in japanischen Zeitschriften verschiedener Epochen in ihrem Aufsatz „Decent Housewives and sensual white women – representations of women in postwar japanese magazines“ (1997). Auch Tanaka Keiko, ebenfalls Professorin für Soziologie an der University of Kentucky, präsentierte im Jahr 2000 eine Abhandlung zum gleichen Thema: „Japanese Women's Magazines – the language of aspiration“. Beide waren für meine Analysearbeiten ausschlaggebend. In ihrem 2006 erschienenen Buch Beauty Up: Exploring Contemporary Japanese Body Aesthetics beschreibt die Professorin für Anthropologie Laura Miller u. a., wie die japanische Kosmetikindustrie funktioniert und wie welche Schönheitsideale entstanden sind. Dabei geht sie auch auf mädchenhafte Szenen ein, die in den 1990er Jahren aufkeimten.
Darüber hinaus gibt es Forschungen, die sich mit der in Japan verbreiteten, niedlichen Ästhetik in vielen Bereichen befassen, aber nicht in Bezug auf Lolita-Mode oder andere speziell japanische, modische Ausprägungen. Mit meiner Diplomarbeit beschreite ich demnach aus wissenschaftlicher Sicht neue Wege, was sich letztlich auch in einem hohen Anteil an Eigenleistung niederschlägt. Werke, die für meine Methodik und mein Vorgehen grundlegend sind, möchte ich im Folgenden vorstellen.
1.3 Methode
Bevor ich mich mit dem Begriff der Szenekultur auseinandersetze, habe ich untersucht, was Lebensstil bedeutet und aus welchen Komponenten er besteht. Pierre Bourdieu beschreibt in seinem Werk Die feinen Unterschiede – Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft verschiedene Merkmale zur Bestimmung von Geschmack und Lebensstil. Neben Bildung und Einkommen spielen dabei Mode, Wohnungseinrichtung, Kunst, Musik, Literatur, Freizeitgestaltung und Essen eine Rolle (BOURDIEU 1987: 212-213). Anhand dieser Merkmale werde auch ich ein genaues Bild vom Geschmack und Lebensstil der Lolitas erstellen können.
Um meine Untersuchung der G&LB zu unterstützen, benutze ich neben Bourdieus Lebensstilkonzept auch Vorgehensweisen, Methoden und Ergebnisse aus den Bereichen der visuellen Soziologie und der Marktforschung, wie sie in Bezug auf (japanische) Zeitschriften u. a. von Tanaka Keiko, Ochiai Emiko und Helen Kopnina – die sich selbst mit der Analyse von kulturellen Inhalten beschäftigt haben – veröffentlicht wurden. Für die Bildanalyse verwende ich die von Erving Goffman – und später auch von Ueno Chizuko in sekushi gyaru no daikenkyū [Die große Studie der Sexy Girls] (1. Auflage 1981) – in Gender Advertisement (1. Auflage 1976) angewandten Methoden.
Doch wie kommen Bekleidung und Lebensstil zusammen? Die Modeindustrie hat unbestreitbar einen gewaltigen Einfluss auf die Ausbildung der Persönlichkeit. Sie schafft die Möglichkeit, in eine andere Hülle zu schlüpfen, mit der wir uns dann von anderen Stilen unterscheiden können (KOPNINA 2005: 378). Mode bestimmt sogar, wie diese Stile auszusehen haben. Und zwar dadurch, dass sie durch die Medien allgegenwärtig unsere Sinne stimuliert. Modezeitschriften gelten als die Stimme der Modeindustrie. Neben der Oberfläche, die aus Werbung und Neuheiten besteht, sind sie auch kulturelle Objekte, die den kulturellen Zeitgeist sowohl visuell als auch textlich widerspiegeln (KOPNINA 2005: 369).
Für Joanne Entwistle, promovierte Modesoziologin am London College of Fashion, besitzt Kleidung sowohl die Fähigkeit, die eigene Identität zu zeigen, als auch die Möglichkeit sie zu verhüllen. Dahinter stehen einerseits das Verlangen, sich selbst treu zu sein sowie die Suche nach Authentizität, andererseits das Spiel mit dem Künstlichen und der eigenen Optik. Das, was mit der Bekleidung letztendlich nach außen getragen wird, ist sowohl eine Mischung aus natürlichen und authentischen als auch konstruierten und (selbst) stilisierten Elementen (ENTWISTLE 2000: 112-113). Goffman unterscheidet in seinem 1959 verfassten Werk Wir alle spielen Theater – Die Selbstdarstellung im Alltag zwischen Erscheinung und Verhalten, und spricht sogar von einer Maske, die einen Menschen erst zu einer Person werden lässt (GOFFMAN 2010: 21; 25) Diese Erscheinung kann, ähnlich wie die konstruierten Elemente bei Entwistle, strategisch eingesetzt werden. Welchen Inhalt wir unserer Projektionsfläche, die die Bekleidung ausmacht, geben, steht uns frei. Es gibt viele mögliche Ausprägungen und Inspirationsquellen: Eine Quelle, die uns einen Blick in die Seele einer bestimmten Szenekultur8 gewährt, ist die Szenezeitschrift, in diesem Falle die G&LB. Allein an dem von den Machern kreierten Namen zeigt sich schon, wie wichtig diese Zeitschrift für Anhängerinnen dieses Stils ist: Sie ist die Bibel der Lolitas.
Um ein möglichst vollständiges Bild der Szenekultur der Lolitas erschließen zu können, unterscheide ich verschiedene Ebenen, die untersucht, kategorisiert und analysiert werden. Da es sich um eine Zeitschrift handelt, die zum Zeitpunkt dieser Arbeit bereits 38 Ausgaben und diverse Sonderausgaben zählt, beschränke ich mich auf die Ausgaben 01, 06, 11, 16, 21, 26, 31 und 36. So erhalte ich einen guten Inhaltsquerschnitt und kann mögliche Veränderungen, die sich über einen längeren Zeitraum ergeben haben, besser verfolgen. Meine Datengrundlage formen die Artikel, Fotostrecken und Textpassagen, sodass es mir optimal möglich ist, jeden Aspekt der Szenekultur untersuchen zu können. Anhand der Ergebnisse, die mir durch die Sammlung von Merkmalen aus diesen verschiedenen Ebenen zur Verfügung stehen, ist es mir möglich, eine präzise Aussage bezüglich meiner Fragestellung zu treffen. Hierfür verwende ich die qualitative Analyse, gestützt auf quantitative Betrachtungen.
1.3.1 Inhaltsanalyse
Eine genaue Analyse der verschiedenen Themenbereiche, die in den Artikeln zur Geltung kommen sowie des inhaltlichen Aufbaus der Zeitschrift soll zeigen, an welchen Stellen identitätsstiftende Inhalte vermittelt werden und auf welchem Wege das Lebensstil-Konzept vermarktet wird. In Kapitel 4.1 „Inhalt“ wird zunäch...