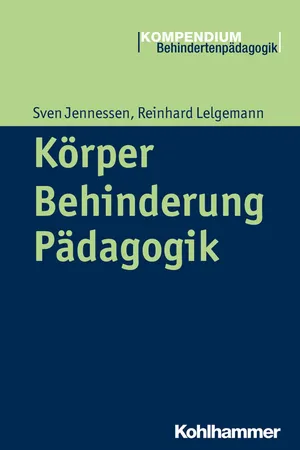![]()
III LEBENSPHASEN UND LEBENSSITUATIONEN
![]()
1 INSTITUTIONEN UND DE-INSTITUTIONALISIERUNG
Sven Jennessen
Die Frage nach den Institutionen, in denen Menschen mit Körperbehinderungen im Laufe ihres Lebens eine angemessene und selbstbestimmte Begleitung, Förderung, Beratung und Bildung erhalten, ist in den vergangenen Jahren eine hochdifferenzierte und komplexe geworden. So sind die lange Zeit unhinterfragten Prozesse, bei denen ein spezifischer Förder- und Begleitungsbedarf scheinbar alternativlose institutionelle Konsequenzen zur Folge hatte, zunehmend einer Dynamik gewichen, bei der der Ort und die Zuständigkeit eben jener Unterstützung möglichst im Einzelfall zu verhandeln und zu entscheiden ist. Die Perlenkette Medizinische Diagnose – Feststellung des Förderbedarfs – Hinzuziehung der auf diesen Bedarf spezialisierten Institution existiert so nicht mehr. Sie ist aufgebrochen zugunsten eines auf Individualität und Selbstbestimmung ausgerichteten Systems, das die jeweils erforderlichen Hilfen in unterschiedlichen Settings, in individuell ausgestalteter und angepasster Form und durch verschiedene Anbieter, aus deren Angebotsspektrum das jeweils passende individuelle Angebot auszuwählen ist, vorhält. Aus diesem Grund trägt dieses Kapitel den Titel Lebensphasen und Lebenssituationen, für die aus verschiedenen Perspektiven einige für die jeweilige Lebensphase zentrale Themen bearbeitet werden.
Hintergrund dieser Situation, die in der Regel als De-Institutionalisierung beschrieben wird, sind verschiedene Impulse und Entwicklungen im Kontext der Sonderpädagogik, die an dieser Stelle überblicksartig dargestellt werden. Weber präferiert im Gegensatz zum Begriff der De-Institutionalisierung, Dezentralisierung oder Enthospitalisierung den Begriff des De-Institutionalisierens, da dieser zum einen als Imperativ zu verstehen sei und zum anderen die Prozesshaftigkeit betone, „die in allen Konzeptionen des De-Institutionalisierens auszumachen ist“ (Weber 2008, 15). Brachmann spricht in diesem Zusammenhang von Re-Institutionalisierung als „Gegenentwurf zur Auflösung der Institutionen des Wohnens durch radikale De-Institutionalisierungsmaßnahmen“ (2011, 327), die als offener Lern- und Umgestaltungsprozess „auf die Schaffung von Anerkennungsverhältnissen innerhalb der Wohneinrichtungen und ihre Umgestaltung zu ‚Enabling-Räumen‘ abzielt“ (ebd., 323). Er legt den Fokus hier stärker auf die innerinstitutionellen Prozesse, durch die Anforderungen an Selbstbestimmung und Teilhabe umgesetzt werden sollen. Letztendlich sind diese in der institutionellen Praxis meist Ausgangspunkt von Überlegungen bezüglich veränderter Konzeptionen und erweiterter Angebote. Die tatsächliche Auflösung im Sinne einer Abschaffung von auf die Bedarfe körperbehinderter Menschen spezialisierter Institutionen ist bislang lediglich punktuell im schulischen Bereich realisiert. Weber stellt zu dieser Begriffsdiskussion fest, dass die Terminologie eher sekundär sei und es letztendlich darum gehe, die Schaffung institutioneller Strukturen daran auszurichten, „ob sie den Kriterien, die aus einer erweiterten Konzeption des De-Institutionalisierens ableitbar sind […,] genügen oder nicht“ (Weber 2008, 220).
Historischer und fachlicher Hintergrund dieser zwar begrifflich und zum Teil auch partiell intentional divergierenden, aber inhaltlich jeweils auf Selbstbestimmung und Teilhabe abzielenden Prozesse des systematischen Infragestellens der Sinnhaftigkeit gewordener Institutionen stellen die zentralen Entwicklungslinien des Lebens mit Behinderung in unserer Gesellschaft dar, die Theunissen und Schwalb (2009) in Anlehnung an Bürli (2007) in folgende Phasen einteilen:
1. Phase der Exklusion: Menschen mit Behinderung wird die Teilhabe an der gesellschaftlichen Regelversorgung verwehrt.
2. Phase der Segregation: Auf dem Hintergrund des Fürsorgegedankens werden Menschen mit Behinderung in separaten Institutionen gefördert und betreut.
3. Phase der Integration: Die Defizite behinderter Menschen werden als so weit reduzierbar interpretiert, dass diejenigen an die regulären Lebensbedingungen herangeführt werden können, die die dort geltenden Spielregeln einhalten können.
4. Phase der Inklusion: Menschen mit Behinderung werden als ExpertInnen in eigener Sache anerkannt, die über das Maß, die Bereiche und die Art ihrer Teilhabe am gesellschaftlichen Leben selbst entscheiden dürfen.
„Das Paradigma der Inklusion geht davon aus, dass Menschen mit Behinderung sehr wohl in der Lage sind, trotz ihrer Behinderung, aber auch mit daraus erwachsenden spezifischen Fähigkeiten an normalen Lebensbedingungen in den gesellschaftlichen Regelsystemen teilzuhaben, dass sie ein Recht haben auf ein selbständiges und selbst verantwortetes Leben in der Gesellschaft.“ (Theunissen/Schwalb 2009, 12)
Durch die Ratifizierung der UN-Konvention zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung ist dieses Recht nun international geltendes Menschenrecht, was die Diskurse über und Prozesse der De-Institutionalisierung in der Behinderten- und Benachteiligtenhilfe erheblich forciert und die schrittweise Umgestaltung des Systems unumgänglich werden lässt. Dieses System erfährt dadurch eine wachsende Infrage-Stellung grundlegender Art, sodass „von einer beginnenden Legitimationskrise mit einem Verlust gesellschaftlicher Legitimation gesprochen werden muss“ (Brachmann 2011, 13). Gründe hierfür seien:
1. „die sich verändernden normativen gesellschaftlichen Erwartungen,
2. die sich verändernden sozialpolitischen, sozialrechtlichen und sozioökonomischen Rahmenbedingungen und
3. die zunehmende Kritik an seinen [des Hilfesystems] Leistungen und Institutionalformen.“ (ebd.)
Diese Legitimationskrise ist Ausdruck gravierender Entwicklungen des Verständnisses von Behinderung und des gesellschaftlichen Umgangs mit und des Wirkens von Menschen mit Behinderung und ihren Familien mit dem Ziel einer umfassenden Teilhabe an allen gesellschaftlichen Bezügen. Wissenschaftlich sind die Disability Studies der wohl eindeutigste und radikalste Ausdruck dieses veränderten Behinderungsverständnisses, der Behinderung vorrangig als kulturelles denn als individuelles Phänomen begreift (vgl. Kap. 1.2). Zweifelsohne hat hier die ICF mit der deutlichen Perspektiverweiterung auf systembedingte Barrieren und Einschränkungen der Aktivitäten eine bedeutende terminologische und inhaltliche Grundlage geschaffen. Dennoch liegt es auf der Hand, dass Fragen der De-Institutionalisierung nicht unhinterfragt ihre Praxisentsprechung finden können, sondern diese Forderungen und Prozesse äußerst kontrovers diskutiert werden. Brachmann fasst diesen Diskurs wie folgt zusammen:
„Während die großen Wohlfahrtsverbände und die Träger der Einrichtungen und Dienste das Bestehende weitgehend rechtfertigen und verteidigen, ‚moderate Kritiker‘ positive Entwicklungstendenzen würdigen und das System der deutschen Behindertenhilfe zumindest vom Grundsatz her für reformfähig halten, vertreten im Gegensatz dazu ‚radikalere‘ Kritiker eine grundsätzlich andere Position. Die Legitimation sonderpädagogischer Einrichtungen wird durch diese Vertreter einer ‚De-Institutionalisierung‘ generell in Frage gestellt, da aus ihrer Sicht diesen Institutionen und Organisationen immanente separierende und stigmatisierende Wirkung von vorneherein die Verwirklichung von Integrations-, Inklusions- und Teilhabekonzeptionen verhindere.“ (Brachmann 2011, 17)
Mit zunehmender Dauer dieser Diskurse verändern sich die hier etwas schablonenhaft aufgeführten Positionen – und zwar in der Regel in Abhängigkeit von dem jeweiligen Zuständigkeitsbereich der Institutionen. So sind auch Großeinrichtungen und Wohlfahrtsverbände – z. T. durchaus aufgrund des Innovationsdrucks der UN-Konvention und den daraus folgenden gesellschaftlichen Erwartungen – zunehmend mit Prozessen der Entwicklung von Alternativen und Modifizierungen bisheriger Institutionen beschäftigt. Auf der anderen Seite führen Erfahrungen mit aus den unterschiedlichsten Gründen schwierigen und zum Teil gescheiterten De-Institutionalisierungsprozessen zu Widerständen und Protesten auf Seiten von Betroffenengruppen und ExpertInnen. Hierbei ist Scheitern nicht als das Scheitern von Personen mit Behinderung in bestimmten Kontexten zu verstehen, sondern als Scheitern von Institutionen, den Bedürfnissen (körper)behinderter Menschen und ihren Teilhaberechten und -forderungen angemessen begegnen zu können. Diese Prozesse lassen sich anhand verschiedener Lebensbereiche konkretisieren, die letztendlich alle – wenn auch in äußerst unterschiedlicher Weise – von den hier skizzierten Entwicklungen tangiert sind.
Da der Bereich Frühförderung im nachfolgenden Abschnitt thematisiert wird, kann dieser an dieser Stelle vernachlässigt werden. Schulische Bildung und die Frage, wo diese für Kinder und Jugendliche mit Körperbehinderung stattfinden soll, ist eines der wohl kontroversesten Themen im Kontext von De-Institutionalisierungsprozessen. Legt die UN-Konvention zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung in § 24 eindeutig ein Recht auf inklusive Bildung fest, ist dies in der Praxis bei weitem (noch) nicht eingelöst. Hierbei zeigen die Forschungsergebnisse aus dem deutschsprachigen Raum, dass sich mit zunehmendem Pflege- und Unterstützungsbedarf auch die Wahrscheinlichkeit des Besuchs einer Förderschule erhöht (vgl. Lelgemann et al. 2012; Haupt & Wieczorek 2012). Auch die Metaanalyse von Walter-Klose zeigt, dass Schulen multidimensionale Anpassungsleistungen erbringen müssen, um den umfassenden Unterstützungsbedarfen und Bildungsbedürfnissen körperbehinderter Schülerinnen und Schüler adäquat entsprechen zu können (vgl. Walter-Klose 2015). Hierbei ist festzustellen, dass die Gruppe körperbehinderter Kinder und Jugendlicher in sich derart heterogen in Bezug auf die Ausprägungen der individuellen Körperbehinderungen und ihrer Auswirkungen auf das Lernen, die psychosoziale Situation und die darauf bezogenen Unterstützungsbedarfe ist, dass sich die themenbezogenen Diskurse über die „richtige Bildungsinstitution“ immer entweder auf einer eher abstrakten Ebene oder der Ebene des individuellen Einzelfalls abspielen müssen. Zweifelsohne spiegeln die (derzeit noch wenigen) verfügbaren empirischen Erkenntnisse eine Tendenz wider, nach der immer mehr Schülerinnen und Schüler mit eher geringem Unterstützungsbedarf und der Möglichkeit, zielgleich unterrichtet zu werden, allgemeine Schulen besuchen. Dies hat zum Teil Schülerrückgänge an den Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung zur Folge, auf die die Schulen in unterschiedlicher Weise reagieren – beispielweise mit der Öffnung für SchülerInnen ohne sonderpädagogischen Förderbedarf (vgl. Venth 2015). Fest steht, dass die Re- bzw. De-Institutionalisierung im Kontext schulischer Bildung für körperbehinderte Kinder und Jugendliche umfassender Umstrukturierungsmaßnahmen bedarf: Um inklusive Bildung für diese Personengruppe zu erfolgreichen Bildungswegen werden zu lassen, sind „auf administrativer Ebene (Bildungspolitik), institutioneller Ebene (Schule) und individueller Ebene (Lehrkraft) inklusive Prozesse zu initiieren und zu unterstützen, die dann gewinnbringend zu werden versprechen, wenn jedes körperbehinderte Kind und jeder Jugendliche als Bereicherung für das Lernen und Leben aller verstanden wird“ (Jennessen 2010, 132).
Wohnen als zentraler Bereich der individuellen Lebensgestaltung ist in seiner Dynamik in ähnlichen Prozessen strukturiert wie dies für die schulische Bildung bereits skizziert wurde: Je höher die Unterstützungsleistungen sind, die für die selbstbestimmte Teilhabe des einzelnen Menschen zu erbringen sind, umso differenzierter und oftmals umstrittener gestalten sich die Veränderungsprozesse in den beteiligten Institutionen. Dabei ist davon auszugehen, dass Wohnen immer zugleich Ausdruck individueller Lebensgestaltung und gesellschaftlicher Rahmenbedingungen ist, deren Verflechtungen der einzelne Mensch ausgesetzt ist:
„Ein körperbehinderter Jugendlicher, der eine Schule für Körperbehinderte besucht, die auf demselben Gelände untergebracht ist wie ein Berufsbildungswerk und das Wohnheim für erwachsene Menschen desselben Trägers, wird beispielsweise mit hoher Wahrscheinlichkeit seine Wünsche und Zukunftsperspektiven auf das Berufsbildungswerk und das Wohnheim als die ‚biographische Normalperspektive‘ richten. Ein körperbehinderter Jugendlicher dagegen, dessen ebenfalls körperbehinderte Mutter als peer counselerin tätig ist, wird wahrscheinlich eine an der Selbsthilfebewegung orientierte biografische Ausrichtung entwickeln.“ (Lindmeier 2008, 140)
Ein gravierender Meilenstein auf dem Weg von dem hier beschriebenen ersten Fall, der lange Zeit als unhinterfragte Regelbiographie körperbehinderter Menschen in Komplexeinrichtungen galt, hin zu einer institutionenunabhängigen Lebensführung ist die Einführung des Persönlichen Budgets, mit dessen Hilfe der einzelne Mensch die für seine Lebensführung erforderlichen Unterstützungsleistungen selbstbestimmt einkaufen kann (vgl. hierzu den Beitrag von Fassbender in diesem Band). Auch hier gelten die oben bereits skizzierten Herausforderungen in Bezug auf eine höhere Abhängigkeit von den traditionellen Strukturen der Behindertenhilfe bei hohem und komplexem Unterstützungsbedarf. Die bislang verfügbaren Erkenntnisse zur Lebensqualität von Menschen mit Behinderung, die in de-institutionalisierten Wohnformen leben, zeigen insgesamt weitgehend positive Effekte im Bezug auf den Zugewinn von Selbstbestimmungsmöglichkeiten in den Bereichen Gestaltung des Tagesablaufes, des Freizeitverhaltens und der persönlichen Ausgestaltung des individuellen Wohnraumes (vgl. z. B. Hentschke 2009, 80) sowie der Entwicklung von Kompetenzen in den Bereichen Kommunikation und Sozialverhalten bei Menschen mit Autismus (vgl. Klauß 2007). Beispiele alternativer Modellprojekte im Bereich Wohnen sowie Erfahrungsberichte zum Erleben und den Wirkungen dieser neuen Konzepte finden sich zusammenfassend im Themenheft der Zeitschrift des Bundesverbandes für körper- und mehrfachbehinderte Menschen (Das Band 4/2015). Faßbender fasst die Forderung nach de-institutionalisierten Wohnformen folgendermaßen zusammen:
„Es muss selbstverständlich werden, dass generell Menschen mit Behinderungen im normalen Wohnumfeld in ihrer eigenen Wohnung beziehungswiese in ihrem eigenen Zimmer mit der Unterstützung, die sie benötigen, leben können. Sie müssen endlich zur Nachbarschaft gehören!“ (Faßbender 2010, 144)
Thesing weist darauf hin, dass die ausschließliche Beachtung des direkten Lebensbereichs Wohnen jedoch nicht ausreichend ist, wenn intendiert ist, eine umfassende Teilhabe an allen gesellschaftlichen Bereichen durch eine De-Institutionalisierung des Wohnraumes zu erreichen: So erfordert dieser Anspruch auch strukturelle Maßnahmen wie „barrierefreie gesellschaftliche Einrichtungen (Bildung, Verwaltung u. a.), Familien ergänzende Hilfen und Öffnung des Gemeinwesens […]. Konzepte der Inklusion und des Community Care erfordern die Entwicklung einer Bürgergesellschaft, die bereit ist zu lernen, Menschen mit Behinderung als gleichwertige Bürger zu akzeptieren und zu integrieren“ (Thesing 2009, 215).
Diese Einbeziehung des mittelbaren und unmittelbaren Wohnumfeldes im Sinne der Sozialraumorientierung hat direkte Auswirkungen auf den Freizeitbereich von Menschen mit Körperbehinderung. Hierbei ist zunächst grundlegend festzustellen, dass „die Freizeitbedürfnisse und das Freizeitverhalten von behinderten und nichtbehinderten Menschen nahezu identisch sind“ (Markowetz 2008, 65). Dies kann zunächst als hilfreiche Grundbedingung für die Gestaltung inklusiver Freizeitangebote interpretiert werden. Für die gleichberechtigte Teilhabe scheint Freizeitassistenz der Schlüssel zu sein, der ein sinnerfülltes und selbstbestimmtes, inklusives Freizeiterleben körperbehinderter Menschen ermöglicht, wenn Assistenz als diejenige Unterstützungsform fungiert, die die Berücksichtigung und Umsetzung individueller Bed...