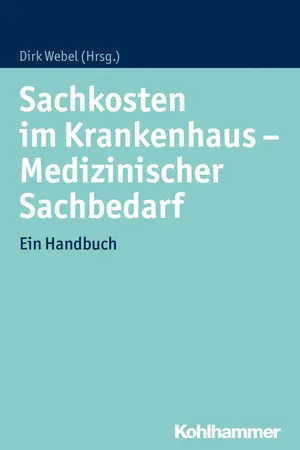![]()
II Rechtliche Aspekte
![]()
1 Sachkostenmanagement und Einsatz von medizinischem Sachbedarf – Recht der Arzneimittel und Medizinprodukte für Krankenhäuser
Dr. Dirk Webel, LL.M.
1.1 Sachkostenmanagement und Einsatz von medizinischem Sachbedarf
Effizienz und Effektivität der Umsetzung eines strukturierten Sachkostenmanagements im konkreten Krankenhausbetrieb werden von diversen Faktoren beeinflusst; so ist bei der Bewertung von Sachkosten u. a. zu prüfen, wie sich der Einsatz von medizinischem Sachbedarf im Gesamtkontext der Strukturen und Prozesse eines Krankenhauses darstellt.1 Entscheidungen zum Materialeinsatz und zur Produktauswahl erfordern dabei einen intensiven Austausch der Beteiligten2 in Kenntnis sämtlicher Einflussfaktoren, etwa medizinischer, aber vor allem auch rechtlicher Provenienz.3
Die Einordung der sich hinter dem »medizinischen Sachbedarf« verbergenden Produkte in den regulatorischen Rahmen der einschlägigen (Spezial-)Gesetze ermöglicht es, diese Einflussfaktoren zu identifizieren und in den Regelungskontext einzusortieren. Bereits auf den ersten Blick lässt sich dabei feststellen, dass der medizinische Sachbedarf nicht nur eine beachtliche, überaus heterogene Produktpalette umfasst, sondern auch ein ebenso vielfältiges Spektrum rechtlicher Themen gänzlich unterschiedlicher Couleur erzeugt. Bei näherer Betrachtung lassen sich dazu einige Schwerpunkthemen identifizieren, die nachfolgend, insbesondere in den gesonderten Kapiteln durch die jeweiligen Spezialisten eingehend und praxisnah behandelt werden. Richtungweisend ist die Einsortierung des »medizinischen Sachbedarfs« in das »Recht der Arzneimittel und Medizinprodukte für Krankenhäuser«.
1.2 Recht der Arzneimittel und Medizinprodukte für Krankenhäuser – Aktuelle Entwicklungen
Krankenhäuser als der »Innovationsmotor im Gesundheitswesen«4 werden weiter dazu beitragen, dass sich der medizinische Alltag zum Wohle einer sich wandelnden Gesellschaft verändern kann. Der viel zitierte demographische Wandel wird, wie im Beitrag von Kischkewitz5 anschaulich beschrieben, nicht nur eine Mengenausweitung, sondern zugleich signifikante medizinische wie technische Innovationen einfordern. Die Ergebnisse der »Inside 3-D-Printing«-Konferenz in New York mit den Vorstellungen der Princeton University und der John Hopkins University über die Möglichkeiten gedruckter Organe lassen bereits erahnen, wie sich die medizinischen Möglichkeiten erweitern könnten. Die »technisierte Gesundheitsvorsorge für jedermann« in Gestalt von (Medical) Apps und derlei Gleichem kann indes wie freilich die »Medizinisierung der Gesellschaft«6 durch das Internet getrost schon heute als gesellschaftliches Phänomen wahrgenommen werden. Im Ergebnis wird sich »das Krankenhaus der Zukunft«, um im Wettbewerb Erfolg zu haben, zunehmend auf innovative Technologien einstellen müssen, und zwar sowohl bei der unmittelbaren medizinischen Versorgung als auch im allgemeinen Betriebsablauf sowie schließlich im gesamten Umgang mit seinen Patienten.7
Die zunehmende Digitalisierung im laufenden Krankenhausbetrieb erzeugt jedoch schon heute originäre Rechtsprobleme. Bereits die simple und zumeist als Service-Leistung8 angebotene Nutzung des hauseigenen WLAN hat Fragen zur Verantwortlichkeit für mögliche Urheberrechtverletzungen ausgelöst.9 Soweit (Medizin-)Technik vernetzt wird, birgt dies eine – unlängst Realität gewordene – Bedrohung durch Cyberangriffe. Datenschutz und Patientensicherheit stellen die IT-Verantwortlichen dabei vor sensible Herausforderungen, die angesichts nicht selten veralteter Krankenhaus-IT in aller Regel nicht von heute auf morgen zu lösen sind.10 Die rasante Entwicklung bei Smartphones, Tablet-PCs und Apps belastet u. a. die tradierten Rechtsunsicherheiten im Umgang mit den sog. »patienteneigenen Medizinprodukten«.11 Aber auch die Ärzteschaft sieht sich zusehends mit der Notwendigkeit konfrontiert, nicht nur mit dem Stand der medizinischen Wissenschaft, sondern auch mit dem »Stand der Technik« Schritt halten zu müssen; der Stand des technischen Fortschritts definiert schon heute Diagnose- und Behandlungsstandards. Der Patient wiederum kann von dem behandelnden Arzt verlangen, dass er die modernsten vorhandenen12 Geräte einsetzt13 – ein vielschichtiges Problemfeld, das kulminiert, wenn die betroffenen Ärzte im Beschaffungsprozess, insbesondere freilich bei der Auswahl der Produkte, nicht beteiligt sind.14 So klar es den Beteiligten dabei auch sein mag, dass der Arzt qua professione weder heute noch in der Zukunft ein »Techniker im Arztkittel« sein kann, umso häufiger wird er gefordert, hochkomplexe (Hightech-)Produkte bedienen zu müssen – und so gleichbleibend scheint gleichwohl seine persönliche Verantwortlichkeit für die sachgerechte Handhabung sein zu sollen.15
Aus diesem polyvalenten Geflecht erwachsen – über die vielschichtigen Fragen kulturell-ethischer, biologischer, theologischer, philosophischer, anthropologischer und sozialer Provenienz hinaus16 – unweigerlich Spannungsfelder, grundlegend bereits hinsichtlich der regulatorischen Spielräume zwischen Innovationsoffenheit und Innovationsverantwortung.17 Welche Herausforderungen darin für den Gesetzgeber liegen, verdeutlicht alleine der Umstand, dass bei der vermeintlichen Entwicklung hin zu einer »Apparatemedizin« ein höchst innovativer Entwicklungsbereich betroffen ist, dessen Risiken schon seit den 1970er Jahren maßgeblich gerade in Form defizitärer Bedienungskompetenz nachgewiesen werden.18
Die normativen Antworten des Gesetzgebers erfolgen vermeintlich sicht- und spürbarer im allgegenwärtigen Zeichen wachsenden Wettbewerbsdrucks, mithin zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit des nationalen Krankenhausmarktes mit einer ökonomischen Steuerungsmethodik und damit vornehmlich im Krankenhausfinanzierungsrecht. Die praktischen Fragen des laufenden Krankenhausbetriebes nimmt der Gesetzgeber jedoch gerade in der jüngeren Vergangenheit ebenfalls ins Visier. Festzustellen ist allerdings, dass die Entwicklungen der produktbezogenen Spezialgesetze im praktischen Alltag mitunter keine gleichwertig hohe Aufmerksamkeit genießen. Gerade an dieser Stelle schließt sich jedoch nicht selten der dynamische Wirkungskreis zwischen betriebswirtschaftlichen Zielen, wissenschaftlicher Reputation, medizinischen Standards und den stets korrelierenden Anforderungen an die Patientensicherheit.
Diese, zumeist spezialgesetzlichen Implikationen bergen für die maßgeblichen Akteure des Krankenhausbetriebes eo ipso Limitierungen wie Gestaltungsspielräume. Die produktbezogenen Anforderungen werden dabei maßgeblich durch das Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln (Arzneimittelgesetz – AMG)19 einerseits sowie das Gesetz über Medizinprodukte (Medizinproduktegesetz – MPG)20 andererseits bestimmt, zwei rechtlichen Sondermaterien, die unter dem Einfluss eines forcierten europäischen Harmonisierungsbestrebens stehen.
Von besonderer Bedeutung für den laufenden Krankenhausbetrieb ist überdies die Verordnung über das Errichten, Betreiben und Anwenden von Medizinprodukten (Medizinprodukte-Betreiberverordnung – MPBetreibV)21, mit welcher der nationale Gesetzgeber zur Gewährleistung eines besonderen Schutzniveaus über die europäischen Richtlinienvorgaben hinausgegangen ist.22 Die MPBetreibV beschreibt für den Krankenhausbetrieb zum einen die Pflichten zur dauerhaften Aufrechterhaltung der Leistungsparameter der eingesetzten Medizinprodukte, zum anderen die Pflichten zur Sicherstellung der hinreichenden Bedienungskompetenz.23 Diese Pflichten wiederum werden adressiert an die »Betreiber« und »Anwender« der Medizinprodukte.24 Nicht wenige der derzeit eindringlich diskutierten Rechtsfragen aus dem Praxisalltag des laufenden Krankenhausbetriebes spielen daher im Regelungsbereich der MPBetreibV, so u. a. die tradierten Fragen zur ordnungsgemäßen Aufbereitung (auch von sog. Einmalprodukten)25 oder der bereits erwähnte Umgang mit patienteneigenen Medizinprodukten.26
Mit der Zweiten Verordnung zur Änderung medizinprodukterechtlicher Vorschriften (2. MPG-ÄndV)27, die mehrheitlich bereits am 01.01.2017 in Kraft getreten ist, hat sich der Gesetzgeber nun einiger dieser teils langjährigen Rechtsfragen angenommen. Erstmals seit dem Jahr 2002 wurde dazu eine nicht nur partielle, sondern umfassende Änderung der MPBetreibV vorgenommen, die sich schwerpunktmäßig auf den Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen, die damit einhergehenden Konkretisierungen insbesondere der Betreiberpflichten, die Einweisung der Anwender sowie die Regelungen zur Bestimmung eines Beauftragten für Medizinproduktesicherheit in Gesundheitseinrichtungen konzentriert.28
Parallel dazu ist festzustellen, dass die klinische Forschung, die im AMG29 wie im MPG30 dezidierten Regelungen unterliegt, unter zunehmender Beobachtung steht.31 In diesem Bereich sind grundlegende Kenntnisse über die Arbeit der Ethikkommissionen32 wie insbesondere auch der vielschichtigen rechtlichen Anforderungen an die Vertragsgestaltung (gerade bei internationalen Forschungsprojekten)33 unabdingbar. Dies gilt umso mehr, als die klinischen Prüfungen von Arzneimitteln auf europäischer Ebene unlängst erhebliche Novellierungen erfahren haben, die bereits zu zahlreichen Veränderungen im...