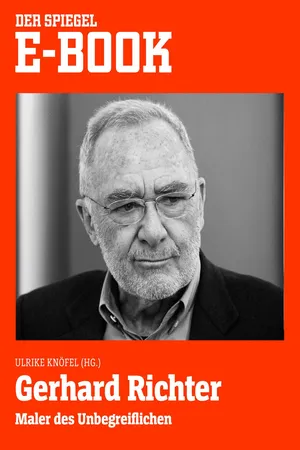![]()
Annäherungen an Gerhard Richter
DER SPIEGEL 34/1968
Wenn's knallt
Die Arbeitsweise des deutschen Mal-Avantgardisten Gerhard Richter
Alle vier Wochen schickt Tante Lenchen aus Oldenburg dem Künstler ein Bündel alte Illustrierte.
Die Drucksachen-Sendung braucht der Düsseldorfer Maler Gerhard Richter, 36, als Arbeitsvorlage; denn er mißtraut der Phantasie und auch dem Studium der Natur. „Glaubwürdiger“ erscheint es ihm, nach Presse-Photos und eigenen Lichtbildern zu malen, die er vergrößert und verwischt in Öl auf Leinwand imitiert.
Mit dieser unscharfen Dokumentar-Kunst hat sich Richter einen eigenen Stil in Pop-Nähe und einen Vorderplatz in der deutschen Mal-Avantgarde reserviert. Seine besten Bilder - darunter das 1965 gemalte lebensgroße Konterfei eines Küchenstuhls - steigern die Effekte der Augentäuschung zu einer unheimlichen Ding-Gegenwart.
Für den Stuhl bekam der Photo-Kopist 1967 den bedeutenden Recklinghauser Kunstpreis „Junger Westen“; nun, ein Jahr später, wird sein Werk in breiten Retrospektiven gezeigt. Nachdem im Frühling die Baden-Badener Kunsthalde ihre Ausstellungsreihe junger Deutscher mit Richter-Arbeiten eröffnet hatte, dokumentiert derzeit die Kölner Galerie Zwirner mit einer Einzelschau die Produktion des Malers seit 1963.
Es ist ein Potpourri disparater Motive, das Richter, unkontrollierten Reizen folgend, aus Tante Lenchens Bilderblättern („Scheich mit Frau“), aus Zeitungen („Prinz Sturdza“ mit dem gemalten Photovermerk „dpa“), der eigenen Kamera („Dolomiten“) und neuerdings auch aus dänischen Pornographie-Heften („Osterakte“) entnommen hat.
Bunt jedoch ist nur die Themenauswahl; die Bilder selbst sind meistens grau. Schwarzweiß-Vorlagen nämlich beläßt der Künstler auch in der Reproduktion ohne Farben, und selbst Farbphotos setzt er manchmal auf diese Weise um - so „fasziniert“ ihn die Entdeckung, „daß Bilder grau sein dürfen“.
Mit der Farbigkeit hat Richter außer der erdachten Komposition noch ein - ihm unerwünschtes - subjektives Element aus seinen Bildern ausgetrieben. Dem dritten, dem persönlichen Pinselduktus, entgeht er mit seiner Spezial-Technik: Die Photo-Motive, per Bildwerfer auf die Leinwand projiziert und dann säuberlich nachgemalt, werden, noch feucht, durch Wischer mit dem Schwamm oder durch kreisende Pinselbewegungen verfremdet. Das Resultat gleicht Aufnahmen einer falsch eingestellten Kamera.
Der Umgang mit Photo-Material ist Richter seit langem vertraut. Mit 16 mußte er als Laborant daheim in der Lausitz die Urlaubsfilme von Amateuren entwickeln - noch heute schätzt er derlei Liebhaber-Bildwerk höher als das „ästhetische Gefummel“ der Kunst-Photographie.
Nach dem Labor-Dienst malte Richter dann in VEB-Auftrag Reklameschriften und lieferte dem Stadttheater Zittau auch den Dekor für verschiedene Bühnenwerke, so für den „Faust“, für „Tiefland“ und „Gräfin Mariza“. 1951 bezog er die Dresdner Kunstakademie, wo er fünf Jahre später diplomierte - mit „Szenen aus dem gesunden Leben“, einem 25 Quadratmeter großen Wandbild im Hygiene-Museum der Sachsen-Metropole.
Das Studium nahm der Diplom-Maler nach der Republikflucht 1961 für zwei Jahre in Düsseldorf noch einmal auf. Beim duldsamen Tachisten Karl Otto Goetz arbeitete er gegenständlich, doch in zunehmend glatter Stilisierung, bis er „abrupt“ sein angemessenes Verfahren entdeckte: Er kam auf die Idee, ein Zeitungs-Photo abzumalen, das den Entertainer Vico Torriani im Kreis von Partygästen zeigte.
Die Photo-Imitation war dem Studenten noch nicht Kunst genug: Deshalb versah er sie noch mit Messerschnitten und Klecksen aus rotem Lack. Doch bald erkannte er, daß solche Manipulationen überflüssig waren. Er verließ sich fortan auf seine unpersönliche Maltechnik, die „nicht so sehr nach Malerei aussieht“, und auf den Dokument-Charakter der Motive, den er bisweilen noch durch mitgemalte Unterschriften betonte.
Über diesen Wirklichkeitswert hinaus soll das Gemalte wenig besagen. Ein Bomber-Bild zum Beispiel, den Super-Comics Roy Lichtensteins verwandt, zeugt nicht von kritischem Engagement, sondern allenfalls von unbeschwerter Lust an - Explosionen. Richter: „Das hat mich immer interessiert, wenn's knallt.“
So unbeteiligt ist der Künstler auch, wenn er fremde Auftraggeber porträtiert - er will die Kunden gar nicht sehen, ein Photo aus dem Familienalbum genügt ihm. Selbst seine Frau darf ihm nicht sitzen. Auch sie malte er nach einer Vorlage - und zwar als erstes Modell nach einer eigenen Aufnahme. Titel des ausnahmsweise bunten Bildes: „Akt, eine Treppe herabsteigend“.
Von eigenen Photos wagte sich Richter, der ein Drittel seiner Werke als mißlungen zu vernichten pflegt, dann auch gelegentlich zu simplen Motiven vor, die zwar photoähnlich jedoch erfunden sind: so zu einem gleichmäßig gewellten „Vorhang“ und einer Folge von fünf angelehnten Türen. Auf anderen Wegen allerdings, auf denen er dem Schematismus entfliehen wollte (mit geometrischen „Farbtafeln“ und neuerdings mit Landschaften in Corinth-Manier), geriet er unter sein Niveau.
Richters Türen und sein Treppen-Akt jedoch kommen ins Museum. Der Schokolade-Fabrikant und Kunst-Sammler Peter Ludwig hat die sechs Spitzenwerke zu Preisen zwischen 1000 und 4000 Mark für das Suermondt-Museum in Aachen erstanden.
![]()
Annäherungen an Gerhard Richter
DER SPIEGEL 24/1980
Strich am Bau
Für eine westfälische Berufsschule liefert der Maler Gerhard Richter zwei paradoxe Riesenbilder: abstrakt und photorealistisch zugleich.
Dick und breit unterstreicht Gerhard Richter, daß Malerei noch immer möglich ist. Oder wird sie am Ende durchgestrichen?
Der Strich jedenfalls ist nicht zu übersehen. Er ist 20 Meter lang und auch noch doppelt vorhanden. Zweimal zieht sich's wie eine gelbe Pinselspur von Riesenhand über je vier Leinwände im Format 1,90 mal 5 Meter, von denen also jede schon für sich ein ziemlich großes Bild abgeben würde, die aber erst aneinandergereiht das ganze karge Motiv vor Augen führen. Richter hat für die beiden Striche ein halbes Jahr Arbeitszeit und dazu noch Fleiß und Talent eines Gehilfen eingesetzt.
Auf Richter, 48, kommt in Deutschland die Rede unausbleiblich, sobald die Chancen und Schwierigkeiten einer zeitgenössischen Malerei zur Diskussion stehen. Den Widerspruch zwischen der Lust am Malen (ihm ein Beweis für dessen Notwendigkeit) und der Bilderflut einer photographisch überversorgten Welt hat der Düsseldorfer Künstler konsequenter als jeder andere ausgekostet und vorgeführt.
Wie in immer neuen Experiment-Ansätzen wechselte Richter, seit er 1960 aus Dresden ins Rheinland umgezogen war, phasenweise seine Malart und machte einen Strich durch jedes ihm angehängte Stil-Etikett.
Östlichen Kunst-Lehren war er noch mit einem fünf mal 15 Meter großen Bild zum Thema des gesunden Lebens gerecht geworden, das er, als Diplomarbeit, an eine Wand des Dresdner Hygiene-Museums malte. Der sozialistischen Doktrin entflohen, verfiel er dann ins krasse Gegenteil.
Zusammen mit seinem damaligen Kollegen und heutigen Galeristen Konrad Fischer-Lueg arrangierte Richter 1963 in einem Düsseldorfer Einrichtungshaus eine Ausstellung durchschnittlicher, aber ironisch auf Sockel gestellter Alltagsmöbel. Die Künstler setzten sich selber in dieses Interieur und nannten das Ganze „kapitalistischen Realismus“.
Später, als Pop Art ins allgemeine Gerede kam, wurde Richter dafür in Anspruch genommen, bei Erscheinen des sogenannten Hyperrealismus nahm er sich wie ein Vorläufer dieser Richtung aus - und schlug dann prompt einen Haken.
Er produzierte weich-verschwommene Schwarzweißgemälde nach banalen Photovorlagen und setzte durch Zufall festgelegte Farbtöne in große Rasterbilder ein. Er kopierte Städte-Luftbildaufnahmen mit breitem Pinsel und stellte graue Flächen aus, die sich durch nichts als die Strukturen ihrer Oberflächen unterschieden. Er legte wilde Knäuel von Pinselkrakeln über die Leinwand und ahmte dann wieder mit Landschafts- und Wolkenbildern den Schmelz von Coloraufnahmen nach.
Als Richter 1972 allein den deutschen Biennale-Beitrag in Venedig bestritt, war die Schau trotzdem so abwechslungsreich, als hätten sich mindestens drei Künstler ins Zeug gelegt.
Malen als Gegenstand der Malerei, Mißtrauen gegen jedes Bild von Wirklichkeit, Brechung des optischen Eindrucks durch die Medien - das sind auch Themen jüngerer, „abstrakter“ Richter-Gemälde. Schlieren im Farbeimer oder spontan gemalte Skizzen sind da auf dem Umweg über photographische Reproduktion in räumlich wirkende bunte Schemen verwandelt worden. Und natürlich geht Richter auch mit dem großen Doppel-Strich seinen Dauerfragestellungen nach.
Er tut das, ausnahmsweise, in öffentlichem Auftrag. Das zweifache Kolossalwerk ist vom westfälischen Landkreis Soest für eine Berufsschule bestellt worden, die Ende des Sommers eingeweiht wird. Eine zweigeschossige Mehrzweckhalle des Neubaus hat in Höhe des ersten Stockwerks zwei Wandstreifen parat, an denen die Bilder - geschützt, aber von einem Umgang aus auch in nahen Augenschein zu nehmen - einander gegenüber hängen sollen.
Richter, der „die Idee, daß eine öffentliche Institution Verantwortung für ein Kunstwerk nimmt, sehr schön“ findet, hält dennoch Distanz zu der realen Architektur. Die Soester Kunst-am-Bau-Stelle hat er nie aufgesucht, sondern sich nur nach den Plänen orientiert. Auch für einen bestimmten Platz gemalt, bleiben seine Werke Tafelbilder, die ohne Schwierigkeit wieder abgehängt und anderswo ausgestellt werden könnten.
Mit den zuständigen Kreispolitikern war der Künstler durch den Architekten, den Essener Wolfgang Schwartz, ins Gespräch gekommen. Er hatte zunächst an vielteilige Kompositionen gedacht, besann sich aber bald auf das elementare Mal-Motiv.
Zwei bescheidene, nur knapp einen Meter lange Pinselstriche über je zwei Schichten farbigem Grund genügten den Auftraggebern als Modell und dem Maler selbst als Vorlage - ein laut Richter relativ „gemütlicher“ Strich, bei dem ein mattes Grün durchschimmert, und ein „aggressiver“ auf blauroter Fläche.
Mit Bildwerfern vergrößert auf die Leinwand projiziert, wurden die Striche dann photorealistisch abgemalt, ein paradoxer Vorgang: Die expressive malerische Geste ist nur in der Skizze echt, im ausgeführten Werk aber ein mühsam herbeigeführter Augentrug. Denn Richters Methode, den „Anschein von Malerei“ zu erwecken, ist selbst durchaus nicht „malerisch“, sondern, wie er sagt, „ökonomisch, technisch, unsensibel“.
Und so enthüllt sich, was von weitem wie der Inbegriff einer flotten Peinture aussieht, als „schrecklich im Detail“. Wenn man nämlich näher hinschaut, erblickt man ein Chaos pingelig abgegrenzter Puzzle-Formen.
Eine - unfreiwillige - Illusionsbrechung zusätzlich muß diese „Antimalerei“ (Richter) gegenwärtig, bei ihrer öffentlichen Premiere, verkraften: Noch vor der Soester Schuleinweihung stellt von dieser Woche an das Essener Museum Folkwang die acht großen Tafeln aus.
Weil aber keine Wand im Schausaal 20 Meter lang ist, gehen die Striche notgedrungen um die Ecke.
![]()
Annäherungen an Gerhard Richter
DER SPIEGEL 4/1986
Einfach ein Bild
Expedition an die Grenzen der Malerei: In Düsseldorf wird das Werk Gerhard Richters im Überblick gezeigt. Von Jürgen Hohmeyer
Er bemalt große Leinwände in bunten Farben und mit heftig ausfahrenden abstrakten Pinselzügen. Außerdem malt er, bescheidener im Format, in gedämpften Tönen und mit altmeisterlich glatter Oberfläche, Landschaftsmotive von Photographien ab.
Aber einen krassen Unterschied oder gar einen Widerspruch zwischen den beiden Malarten kann der Maler Gerhard Richter so wenig entdecken wie etwa zwischen Symphonien und Liedern von ein und demselben Komponisten. So oder so, sagt er, gehe es ihm immer um die „richtige Organisation“ der Bild-Bestandteile. Und die „gleiche Struktur“, die er - beispielsweise beim Blick aus dem Atelierfenster auf einen Kölner Bahndamm - in der Außenwirklichkeit schon vorfinde, die gelte es in der gegenstandslosen Malerei eben „künstlich zu erzeugen“ .
Tatsächlich schwächt sich der Kontrast zwischen solchen und solchen Richter-Gemälden schon ab, wenn man nur eine Weile genauer hinsieht. Auf einigen der auch vom Künstler selbst „abstrakt“ genannten Bilder tauchen sogar angedeutete Gegenstände wie ein „Tisch“ oder eine „Mauer“ auf. Und schimmert nicht ein verschwimmender Tiefenraum wie photographiert durch die hart-dynamische Maler-Handschrift?
Hinter und unter der Malerei ist wieder Malerei. In Richters Werk überlappen sich ihre Erscheinungsformen, aber sie fächern sich auch vielfältig auf - als wäre es zum Beweis, daß mancherlei Wege zu gleichen Zielen führen können.
Das wird seit dem letzten Wochenende öffentlich und in aller Breite dargelegt - mit einer umfassenden Richter-Ausstellung, fast 180 Bildern seit 1962, in der Düsseldorfer Kunsthalle (dort bis 23. März, später noch in Berlin, Bern und Wien). Die Groß-Unternehmung signalisiert, daß Richter, demnächst 54, unter deutschen Malern einen Spitzenrang einnimmt, und sie macht anschaulich, wieso: Derart kühl-engagiert und intelligent, derart hartnäckig und experimentbereit wie er hat wohl keiner sonst die Möglichkeiten von Malerei im Zeitalter der Massenphotographie erprobt.
Seine Versuchsergebnisse seit 1962 zählt der Künstler säuberlich in einer Werkliste auf. Zur Ausstellung ist das Verzeichnis nun, fast lückenlos illustriert und mit einem Text des Kunsthallendirektors Jürgen Harten, als opulentes Katalogbuch erschienen*.
Es weist aus: Rund die Hälfte der 587 Katalognummern bis 1985, die häufig etliche - im Extremfall sogar 48 - Einzelbilder zusammenfassen, betrifft abstrakte Malerei. Und gegenstandslose Großformate, die in ihrer satten Farbigkeit ein hinreißend kaltes Pathos ausstrahlen umgeben triumphal schließlich auch den Besucher in der Düsseldorfer Kunsthalle.
Doch jenen Wechsel der Stile, der innerhalb solcher Bilder das Verhältnis der Malschichten zueinander kennzeichnet, zeigt die Ausstellung zugleich als eine zeitliche Staffelung: Richters abstrakte Malerei von heute hat nicht nur eine ständige Alternative in realistischen Landschaften. Sie verarbeitet auch und vor allem eine stationenreiche Vorgeschichte.
Richter, der aus Dresden stammt und 1961, knapp vor dem Berliner Mauerbau, in den Westen kam, der schon ein sozialistisches Akademiestudium hinter sich hatte, bevor er in Düsseldorf ein zweitesmal zur Schule ging, trat hier anfangs als ein deutscher Pop-Protagonist hervor. Vom akademischen Tachismus ebenso abgestoßen wie vom linientreuen DDR-Realismus, kopierte er malend Schwarzweißphotos aus Zeitungen und Illustrierten.
Allerdings: Nicht etwa um die Ikonen der Konsumgesellschaft, wie Andy Warhol sie plakatierte, ging es ihm, sondern um ein freies, noch nicht beackertes Terrain für Malerei. Die konnte denn auch unversehens in Gestalt grauer Farbwolken oder weißer Spritzer über die „polemisch, bewußt unkünstlerisch“ zitierten Gelegenheitsmotive wie zwei namenlose „Fußgänger“ (1963) hereinbrechen.
Immer, so versichert Richter, habe er die Behauptung für „gelogen“ gehalten, er hole planvoll eine Welt aus zweiter Hand ins Bild. Vielmehr seien Photos für ihn nützliche Hilfsmittel, weiter nichts. Und „im Grunde“ gebe es ja gar keinen Unterschied zwischen Öl- und Lichtbild. Nur habe das dann doch wieder nicht die unentbehrliche „Präsenz“ .
Die Verstrickung ist nicht aufzulösen, beim Gang durch die Düsseldorfer Retrospektive stellt sich im Kopf des Betrachters...