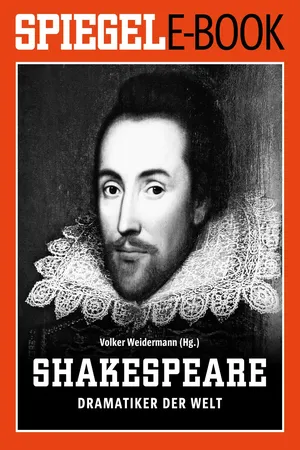
- 170 pages
- English
- ePUB (mobile friendly)
- Available on iOS & Android
eBook - ePub
About this book
Das Leben des erfolgreichsten, wirkungsmächtigsten Dramatikers der Welt ist ein Geheimnis: Wir wissen fast nichts über William Shakespeare. Er ist ein Phantom und seine Stücke, die jeder kennt, sind ein Kulturerbe der Welt. Vor 400 Jahren starb er und ist dafür immer noch erstaunlich lebendig. Und jeder neuen Zeit stehen seine Stücke neu gegenüber. Das verdeutlicht dieses E-Book, das mehr als fünfzig Jahre Shakespeare-Rezeption, Shakespeare-Spurensuche und -Deutung umfasst – in über 40 Porträts, Theater- und Filmkritiken sowie Interviews aus dem SPIEGEL.
Frequently asked questions
Yes, you can cancel anytime from the Subscription tab in your account settings on the Perlego website. Your subscription will stay active until the end of your current billing period. Learn how to cancel your subscription.
No, books cannot be downloaded as external files, such as PDFs, for use outside of Perlego. However, you can download books within the Perlego app for offline reading on mobile or tablet. Learn more here.
Perlego offers two plans: Essential and Complete
- Essential is ideal for learners and professionals who enjoy exploring a wide range of subjects. Access the Essential Library with 800,000+ trusted titles and best-sellers across business, personal growth, and the humanities. Includes unlimited reading time and Standard Read Aloud voice.
- Complete: Perfect for advanced learners and researchers needing full, unrestricted access. Unlock 1.4M+ books across hundreds of subjects, including academic and specialized titles. The Complete Plan also includes advanced features like Premium Read Aloud and Research Assistant.
We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.
Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.
Yes! You can use the Perlego app on both iOS or Android devices to read anytime, anywhere — even offline. Perfect for commutes or when you’re on the go.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Yes, you can access William Shakespeare - Dramatiker der Welt by Volker Weidermann in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in Literature & Shakespeare Drama. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.
Information
Shakespeare-Inszenierungen
SPIEGEL 9/1964
König Jedermann
Akustisch darf der Sturm, der im dritten Akt von William Shakespeares „König Lear“ über die Heide rasen soll, noch vorkommen, aber optisch ist Heide nicht mehr vorhanden, und das Sturmgeräusch wird auch nur verfremdet dargeboten: Es wird von rostigen Metallplatten erzeugt, die als Teile der Dekoration auf die Bühne herabhängen und von einem Elektromotor in Schwingung versetzt werden.
Die Donnerbleche, in mehrwöchiger Werkstattarbeit kunstvoll zum Rosten gebracht, gehören zu den wenigen und wesentlichen Requisiten der ungewöhnlichen „King Lear“-Inszenierung des englischen Regie-Neuerers Peter Brook, die zum Haupt-Exportartikel der britibritischen Shakespeare-Produktion im Shakespeare-Jahr 1964 geworden ist:
Anfang letzter Woche begann die „Royal Shakespeare Company“ mit Brooks „Lear“ im Westberliner Schiller-Theater eine Welttournee, die das berühmte Ensemble unter anderem nach Prag, Budapest, Warschau, Helsinki, Moskau, Tokio, Washington, Toronto und New York führen wird.
Brooks „Lear“-Inszenierung, Ende 1962 in Stratford-on-Avon erstaufgeführt und im vergangenen Jahr beim Pariser Festival „Theater der Nationen“ preisgekrönt, spielt – vier Stunden lang – auf einer fast leeren Bühne, vor der kein Vorhang fällt, und läßt Shakespeares Tragödie des verblendeten, verstoßenen, mißhandelten und wahnsinnigen Königsgreises Lear, die viele moderne Regisseure für schwer spielbar und nicht wenige Theaterbesucher für ungenießbar hielten, wie das Werk eines Vorläufers von Samuel Beckett („Endspiel“) und Eugène Ionesco („Der König stirbt“) erscheinen: als Parabel des Zerfalls, als ein Endspiel ohne Sinn und Trost.
Bei Brook wirkt Lear nicht mehr – wie häufig in konventionell naturalistischen, historisierenden oder romantisierenden Aufführungen – als ein absonderlicher Greis, der, ganz unverständlich, die Liebe seiner jüngsten Tochter nicht zu erkennen und die Heuchelei seiner beiden anderen Töchter nicht zu durchschauen vermag und schaurig dafür büßen muß.
Brook zeigt ihn vielmehr ohne jedes Schicksalspathos als eine Art zeitlosmodernen Jedermann, als ein Beispiel für den Menschen in einer absurden Welt ohne Größe und Glanz.
Auf die Idee, den „Lear“ so zu interpretieren, war der Engländer Brook nicht allein verfallen. Anregung kam aus Polen: Der Warschauer Literaturprofessor und Theaterkritiker Jan Kott, der vor dem Krieg surrealistische Lyrik schrieb und nach 1945 Dramen von Sartre, Ionesco und Camus ins Polnische übersetzte, hatte 1962 ein Buch über Shakespeare veröffentlicht und darin Parallelen zwischen „Lear“ und dem absurden Theater Becketts und Ionescos aufgezeigt.
„König Lear“, schrieb Kott, „ist ein tragischer Spott über jegliche Eschatologie, über den Himmel, der auf Erden verheißen wird, und über den Himmel, der nach dem Tode anheben soll... Am Schluß dieser gewaltigen Pantomime bleibt nur die blutige und leere Erde zurück. Auf dieser Erde, über die ein Sturm gegangen ist, der nichts als Steine hinterlassen hat, führen ein König, ein Narr, ein Blinder und ein Verrückter ihren rasenden Dialog.“
Und: „Hier wurde ein philosophisches Narrenspiel ausgetragen. Es ist dasselbe Narrenspiel, dem wir im modernen Theater begegnen.“
Unter dem Eindruck des Kott-Buches, zu dessen englischer Ausgabe er ein Vorwort schrieb – eine deutsche Übersetzung erscheint in diesem Frühjahr unter dem Titel „Shakespeare heute“ im Verlag Langen-Müller –, erarbeitete Peter Brook 1952 in Stratford seinen neuen „Lear“, für den er auch das karge Bühnenbild entwarf. Die Aufführung machte Sensation und wurde von Kritikern innerhalb und außerhalb Englands als vorbildlich für eine zeitgemäße „Lear“- und Shakespeare-Deutung auf dem Theater gepriesen.
In Berlin wiederholte sich jetzt der Erfolg der Brook-Inszenierung, die mit Shakespeares Welt der Könige, Schurken und Narren ähnlich abstrahierend verfährt, wie Wieland Wagner – Gast der Berliner Aufführung – mit den Nibelungen-Helden seines Großvaters im neuen Bayreuth zu verfahren pflegt.
Das Publikum im Schiller-Theater, das zu Beginn die englische und die deutsche Nationalhymne angehört hatte, dankte für den modernisierten Shakespeare laut und lange. Friedrich Luft über Brooks „Lear“ nach Beckett-Muster: „Man sieht das alte Gewitterstück wie zum erstenmal.“
Die Grenzen der Beckettisierung waren freilich immer dann aufgefallen, wenn König Lear um seiner Ehre willen etwas verlangte oder tat, wenn von seiner Autorität die Rede war, wenn seine Worte und die Handlungen seiner Partner nicht verbergen konnten, daß Shakespeare im „Lear“ eine ständische Gesellschaftsordnung und nicht ein absurdes Niemandsland gezeichnet hat.
Shakespeares „Lear“, so hatte Professor Kott geschrieben, sei „wie ein riesiger Berg, der zwar von allen bewundert, seltener aber bestiegen wird“.
Auf dem Weg zum Gipfel, so sagte Peter Brook, sehe man „überall verstreut die zerschmetterten Leichen anderer Bergsteiger herumliegen. Hier Olivier, dort Laughton; es ist erschreckend“.
Offenbar war es diesen Kollegen von Peter Brook nicht vergönnt, auf dem „Lear“-Berg Samuel Beckett zu entdecken.
Shakespeare-Inszenierungen
SPIEGEL 40/1967
Großer Angriff
Auf kahler Bühne tollt eine Riege junger Leute in Blue jeans und Miniröcken. Sie gackern und krähen, heulen wie Wölfe, stellen sich auf den Kopf, zucken orgiastisch, legen Hand an primäre und sekundäre Geschlechtsmerkmale und spielen Koitus.
Peter Zadek, der Bremer Klassiker-Herostrat, hat wieder zugeschlagen: Shakespeares „Maß für Maß“, von seiner Hand getroffen, ist nicht mehr zu erkennen.
Keß und kregel wie keine andere deutsche Bühne stürzt Bremens Theater gern das Alte und lockt neues Leben aus den Ruinen. Zadek, 41, und sein Bühnenbildner Wilfried Minks, 37, traben der Truppe voran.
Die beiden hatten Anfang 1964 schon Shakespeares Historien-Gobelin „Heinrich V.“ der Gegenwart genähert. „Held Henry“, so der neue Titel, demontierte Heroentum in Weltkrieg-I-Monturen und mit den Pop-Gags aus Joan Littlewoods Antikriegs-Varieté „Oh, what a lovely war“.
Noch forscher notzüchtigten sie den deutschen Dichter Friedrich Schiller. „Die Räuber“ waren knollige, borstige Buschklepper, die nicht aus den böhmischen Wäldern, sondern aus einem grellen Comic strip traten.
Beide Inszenierungen machten noch starke Konzessionen an bürgerliche Kunstbedürfnisse: Die Worte waren verständlich, und der Gang der Dinge blieb durchschaubar. Jetzt warf Zadek solche Fesseln ab: Die „Maß für Maß“-Dialoge steigerten sich in kreischende Paroxysmen, und die Handlung zerbarst in burleske und brutale Szenen-Scherben.
Denn Zadek inszenierte „rücksichtslos nur das, was beim Lesen von 'Maß für Maß' in der Phantasie geschieht“. Es ist häufig das gleiche, was andernorts schon auf der Bühne geschah – die Verbal-Räusche und terroristischen Rituale des ambulanten amerikanischen „Living Theatre“ oder Peter Brooks Londoner Sex-Exerzitien im „Theater der Grausamkeit“.
„Maß für Maß“-Lektüre kann freilich Erinnerungen an diese Bühnen-Neuerer wecken, denn Shakespeares Drama, eines seiner obskursten, handelt umständlich von Willkür, Köpfen und Fleischesgier: Der Herzog eines sittenlosen Wien setzt einen Stellvertreter ein, der Gesetz und Moral wieder Achtung verschaffen soll; während der Herzog, als Mönch verkleidet, durch Wien wandelt, züchtigt der neue Herr mit scharfem Schwert, verfällt aber selbst sinnlichen Anfechtungen.
Für die Aufführung hatten die Bremer beim bayrischen Jungdramatiker Martin Sperr („Jagdszenen aus Niederbayern“) eine Neufassung bestellt. Sperr schrieb sie in knochentrockener Prosa, als „ernsthafte Übersetzung für eine ernsthafte Aufführung“, Zadek „fing ernsthaft an zu proben, aber dann habe ich alles umgeschmissen“.
Unzufrieden mit der „Kleinpsychologie“, geplagt vom Problem, „Naivität zu übersetzen“, suchte er nach „theatralischer Vergrößerung“. Aus diesem Ringen erwuchs das exzentrische Spektakel, das am vorletzten Wochenende Premiere hatte und der „Welt“ als „neues Stadium totaler Bühnenkunst“ imponierte.
Zadeks Wiener kommen schlenkernd auf die leere Bühne, die Minks nur mit einem bunten Glühlampen-Fries verziert hat. Sie hocken sich, wie zu einem Box-Match, im Kreise nieder, ein Dicker stellt sich als Herzog vor, zieht das Hemd aus, streift eine Kutte über und warnt die Nonne Isabella, „weil die Unsittlichkeit große Angriffe auf gutgebaute Körper macht“.
„Auf dem Theater können Dinge passieren“, sagt Zadek, „die sonst nicht passieren können“ – auf einem Stuhl krakeelen zwei Darsteller wie zwei Hähne auf dem Mist, der Herzog wird an der Nase umhergeführt, und wenn Isabella den Stellvertreter überreden will, klettert sie ihm auf die Schulter.
Zadek läßt gegen den Text spielen, Pathos parodieren, Parterre-Akrobatik treiben, er führt Köpfen als Clownerie vor und komische Einlagen als bitterernste Tragödien. Er pendelt zwischen Brillanz und Billigkeit und schert schließlich völlig aus dem Shakespeare-Stück aus: Der Herzog wird umgebracht, eine Puff-Mutter namens Meier hüllt sich in seine Kutte, und in einer anarchistischen Schluß-Orgie flattert sie wie ein Vampir mordend umher.
Buhrufe und Beifall gingen paritätisch auf Zadek nieder. Applaus brandete auch während der Vorstellung – so nach dem Satz: „Das alles kommt mir sehr wirr vor und sieht dem Schwachsinn sehr ähnlich.“
Shakespeare-Inszenierungen
SPIEGEL 44/1967
Süßes Tun
Beim Soupieren in einer Londoner Trattoria warf Sir Laurence Olivier, Intendant des britischen National Theatre, eine heikle Frage auf: „Sollten die Herren nicht Brüste tragen?“
Die Herren, Schauspieler des National Theatre, kamen in der jüngsten Premiere des Olivier-Hauses ohne Brüste auf die Bühne; sie trugen nur Lockenperücken, silbrig fließende Abendroben oder kesse Miniröcke.
Sie spielten so die Damenrollen in Shakespeares Komödie „Wie es euch gefällt“ – Ronald Pickup, 27, die holde Rosalinde; Charles Kay, 37, die zarte Celia; Richard Kay, 28, die Schäferin Phöbe und Anthony Hopkins, 29, das bäurische Käthchen.
Die Künstler sprachen im gewohnten Baß, und aus ihren Röcken ragten haarige Waden. Nur wenn sie miteinander scherzten – Celia zu Rosalinde: „So kannst du dir einen Mann in den Bauch stecken“ –, gemahnten sie an schäkernde Mädchen.
Der Nur-Herren-Shakespeare ist die Bühnen-Sensation der Londoner Herbst-Saison. Selbst der einflußreiche Kritiker Harold Hobson („The Sunday Times“), der vorher Skepsis hegte, genoß die Aufführung und lobte ihre „süße Schicklichkeit“.
Den Anstoß zum süßen Tun hatte die „Graue Eminenz der modernen Shakespeare-Interpretation“ („The Times“) gegeben – der polnische Literaturprofessor Jan Kott, 53. Der Pole deutet den Barden als Zeitgenossen.
Im „König Lear“ entdeckte Kott Züge eines absurden Beckett-Dramas, „Hamlet“ war ihm eine hochpolitische Affäre, und im „Sommernachtstraum“ stieß er auf eine düstere Sexualität nach Art Genets. Die Modernität von „Wie es euch gefällt“ ging ihm unter jungen Schweden auf: An einer Stockholmer Straßenecke beobachtete er ein küssendes Paar – beide trugen Hosen und das Blondhaar lang, und Kott konnte nicht unterscheiden, wer der Knabe und wer das Mädchen war.
Mit dem Bild vor Augen studierte Kott „Wie es euch gefällt“. Eine Traumwelt tat sich auf, „durch die ein Mädchenjunge wandert“; der „Mythos des Hermaphroditen“ beschwor ihm „das Bild eines verlorenen Paradieses“. Jünglinge sollten deshalb die Mädchenrollen spielen, damit „die Universalität der Begierde“ dargestellt werde, „die sich nicht auf ein Geschlecht beschränken läßt“.
Sir Laurence las Kotts Hymnik und beschloß, die Herrenpartie zu wagen. Er belebte damit einen versunkenen Brauch: In Shakespeares Tagen, um 1600, wurde jedwede Weiber-Rolle von männlichen Künstlern vorgeführt – allerdings von Knaben vor dem Stimmbruch. Die Minderjährigen dienten als „Lehrlinge“ den Meistern, die ihre Theater-Truppe wie eine Aktien-Gesellschaft führten.
Die frauenlose Bühne blieb Briten-Tradition bis zum Jahre 1660; die gleichzeitige Aktricen-Wirtschaft auf dem Kontinent erregte Verwunderung. Ein reisender Engländer, Thomas Coryate, der 1608 Venedig anschiffte, notierte: „Ich sah Frauen auf der Bühne, ein Ding, das ich nie vorher sah.“
Die Briten hielten Damen-Rollen offensichtlich für ein Schauspieler-Fach wie jedes andere – wie schwerer Held oder Komiker. Zweihundert Jahre später konnte Goethe der Spiel-Art Reiz abgewinnen: Als er in Rom Jünglinge in Mädchen-Rollen sah, überfiel ihn ein bislang „unbekanntes Vergnügen“ – nämlich darüber, „nicht die Sache selbst, sondern ihre Nachahmung zu sehen“.
Bei den Proben zu „Wie es euch gefällt“ hatte der Regisseur Clifford Williams allerdings gelegentlich Mühe. Anthony Hopkins, der eine Bauerntochter sein sollte, klagte: „Ich schaffe den sexuellen Sprung nicht.“ Rock und Perücke halfen ihm hinüber.
Besonderen Effekt versprach sich Kott, der den Proben beisaß, von der Rosalinde-Rolle: Sie ist ein erotisches Vexierspiel.
Rosalinde, Tochter eines exilierten Herzogs, verkleidet sich als Mann und folgt dem Alten in den Ardenner Wald. Dort irrt auch liebeskrank ihr Geliebter umher; im Männerdreß erkennt er Rosalinde nicht wieder und geht mit ihr einen Handel ein – er nennt sie Rosalinde, und sie will ihn dafür vom Liebeskummer kurieren.
Rosalinde-Darsteller Ronald Pickup hatte somit ein Mädchen zu spielen, das einen Mann spielt, der von einem Mann als Mädchen behandelt werden will. „Erotische Ambiguität“ (Kott) stellte sich indes nicht ein – Kritiker Hobson: „Überhaupt keine Erotik.“
Williams Inszenierung, in skurrilen Carnaby-Street-Kostümen, abstrakten Glasfaser-Dekorationen und zu Beat-Musik, erinnerte andere Kritiker eher an die Transvestiten-Klamotte „Charleys Tante“; der „Observer“ betrachtete das Herren-Spiel gar als Höhepunkt eines „Transvestiten-Monats“ im Schaugewerbe: „Wo man hinblickt, ziehen sich Männer als Frauen an.“
Den Drang deutet der Londoner Psychologe Robert Shields so: Wie die Atombombe „exzessiven Pazifismus“ verursache, so rufe die gegenwärtige „Aggressivität der Frau“ beim Manne „Angst“ hervor; er sucht „Erleichterung in Transvestiten-Phantasien“.
Den „Wie es euch gefällt“-Regisseur Clifford Williams leiteten andere Motive zum Herren-Abend: Die „unglaubliche weißglühende Reinheit der Gefühle“, sagt Williams, „die ist irgendwie bei den Männern am reinsten“.
Shakespeare-Inszenierungen
SPIEGEL 2/1973
Ein Shylock wie aus Hitlers Zeiten
Shakespeares „Kaufmann von Venedig“, einst der Nazis liebstes Metz-Stück, schafft Deutschen immer noch Verwirrung: In Bochum tritt jetzt ein Shylock wie aus dem „Stürmer“ auf die Bühne. Peter Zadeks Inszenierung will „das Juden-Urbild von vielen Menschen treffen“ und Anstoß geben zu einer „wirklichen Auseinandersetzung“.
Das ist ein schlimmer Jude. Sabbel tropft ihm vom Maul, Dreck und Fett bedecken seine Kutte, geduckt und krötig watschelt er dahin, begeifert grell die Christen oder mampft ein dumpfes Kauderwelsch aus sich heraus.
Wollüstig wetzt er das Messer an der hornigen Fußsohle, streckt mordgeil die Zunge, und mit Krallenhand setzt er das Eisen dann an die Brust des edlen Christen Antonio, um sich das Pfund Fleisch, sein Recht, zu holen. Ein „Stürmer“-Shylock?
In Bochum hatte, am vorletzten Wochenende, Shakespeares „Kaufmann von Venedig“ Premiere. Intendant Peter Zadek, 46, Kind emigrierter deutscher Juden, führte Regie und brachte, wie es seine Art ist, seine Zuschauer wieder in heftige Verwirrung.
Denn einen Shylock wie diesen hatte es seit großdeutschen Tagen nicht mehr gegeben. Edel leidend allenfalls, wie Ernst Deutsch, war der Jude umgegangen, oder als zürnender Jahwe, wie Fritz Kortner in einer Fernseh-Fassung.
Doch Zadek hat seinen Schock-Shylock nicht als blinde Provokation gemeint – vielmehr als listige: Der „böse, geile, dreckige Jude“ soll „genau das Juden-Urbild von vielen Menschen treffen“ und so Anstoß geben zu einer „wirklichen Auseinandersetzung“.
Ob Zadeks Strategie Wirkung zeigt, bleibt fraglich. Im Land antisemitischer Exzesse, in Deutschland, hat Shakespeares Shylock-Drama stetig Anstoß gegeben; kein anderes Stück wurde, je nach Lage, so brutal mißbraucht oder so heikel gehätschelt.
Fritz Kortner, ...
Table of contents
- Shakespeare - Dramatiker der Welt
- Shakespeare - Dramatiker der Welt
- Porträts
- Shakespeares Bedeutung
- Wer war Shakespeare wirklich?
- Shakespeare-Inszenierungen
- Shakespeare im Film
- Shakespeares Sonette
- Anhang