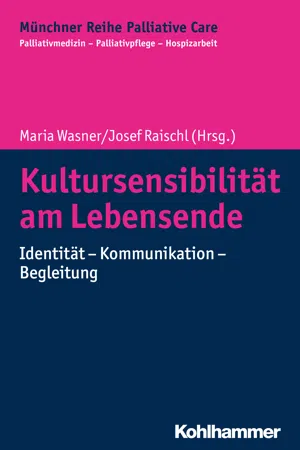
eBook - ePub
Kultursensibilität am Lebensende
Identität - Kommunikation - Begleitung
Maria Wasner, Josef Raischl, Gian Domenico Borasio, Monika Führer, Maria Wasner, Ralf J. Jox, Maria Wasner, Josef Raischl
This is a test
Share book
- 288 pages
- German
- ePUB (mobile friendly)
- Available on iOS & Android
eBook - ePub
Kultursensibilität am Lebensende
Identität - Kommunikation - Begleitung
Maria Wasner, Josef Raischl, Gian Domenico Borasio, Monika Führer, Maria Wasner, Ralf J. Jox, Maria Wasner, Josef Raischl
Book details
Book preview
Table of contents
Citations
About This Book
Die soziokulturelle Diversität in Deutschland ist so groß wie nie zuvor. Um allen Menschen eine gute Versorgung am Lebensende zu ermöglichen, ist daher Kultursensibilität in Palliative Care und Hospizarbeit von großer Bedeutung. Der Frage, was Kultursensibilität genau bedeutet und wie eine kultursensible Begleitung aussehen kann, haben sich zahlreiche Experten in diesem Buch gewidmet. Dabei bildet ein weites Kulturverständnis die Grundlage. Kulturen werden als Lebenswelten verstanden. Darum werden nicht nur Migrantinnen und Migranten in den Blick genommen, sondern auch andere uns "fremd" erscheinende Kulturen wie beispielsweise geistig behinderte Menschen, Strafgefangene oder Wohnungslose.
Frequently asked questions
How do I cancel my subscription?
Can/how do I download books?
At the moment all of our mobile-responsive ePub books are available to download via the app. Most of our PDFs are also available to download and we're working on making the final remaining ones downloadable now. Learn more here.
What is the difference between the pricing plans?
Both plans give you full access to the library and all of Perlego’s features. The only differences are the price and subscription period: With the annual plan you’ll save around 30% compared to 12 months on the monthly plan.
What is Perlego?
We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.
Do you support text-to-speech?
Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.
Is Kultursensibilität am Lebensende an online PDF/ePUB?
Yes, you can access Kultursensibilität am Lebensende by Maria Wasner, Josef Raischl, Gian Domenico Borasio, Monika Führer, Maria Wasner, Ralf J. Jox, Maria Wasner, Josef Raischl in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in Sozialwissenschaften & Tod in der Soziologie. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.
Information
III Herausforderungen in der kultursensiblen Begleitung
13 Kultursensible Palliative Care und Hospizarbeit: Zur Frage nach der Zugangsgerechtigkeit
Sarah Peuten und Werner Schneider
13.1 Sterben als Gestaltungsproblem
Das gesellschaftliche Handlungs- und Deutungsproblem zum Sterben, sofern es nicht unerwartet z. B. infolge eines Unfalls erfolgt, sondern gleichsam als Regelfall bspw. den alten, kranken Menschen am Ende seines Lebens betrifft, lautet heute: Sterben geschieht nicht mehr einfach so, weil und nachdem die Heilkunst der modernen Medizin, welche sich an Kranke richtet, um »gesund zu machen«, an ihr Ende gekommen ist. Vielmehr ruft das »ans Ende des Lebens kommen« jeder einzelnen Person nun jenen Bereich rund um Palliativmedizin/ pflege und hospizliche Begleitung auf, welcher sich dem »Sterben Machen« (Schneider 2014, S. 77) unter seinen eigenen Vorzeichen widmet, wie es folgender Buchtitel treffend zum Ausdruck bringt: »Wenn nichts mehr zu machen ist, ist noch viel zu tun: Wie alte Menschen würdig sterben können« (Husebö et al. 2007).
Wenn nicht mehr »gesund gemacht« werden kann, gibt es für das »Sterben Machen« umso mehr zu tun, je weniger das Sterben in der kollektiven Deutung als bloßes schicksalhaftes Geschehen gesehen wird. Unter den normativen Bedingungen des »guten«, d. h. würdigen, weil möglichst selbstbestimmten, schmerzfreien, gut versorgten und individuell begleiteten Sterbens wird heute – in Anlehnung an Andreas Lob-Hüdepohl (2014) formuliert – das Sterben schlechthin zum Machsal bzw. zum »riskanten Gestaltsal«. Damit ist gemeint: Sterben wird keineswegs mehr als schicksalhaftes Geschehen gedeutet, sondern unterliegt immer mehr der Anforderung von Organisation, Wahl und Entscheidung zwischen verschiedenen (z. B. Versorgungs-)Optionen und gezielter Gestaltung. Hierfür gewinnen palliativ-hospizliche Versorgungs- und Unterstützungsangebote umso mehr an Bedeutung, je mehr dem Individuum in der individualisierten Gesellschaft über die gesamte Lebensspanne hinweg die Gestaltung seines je eigenen Lebens ermöglicht, zuerkannt bzw. gar auferlegt wird, und je mehr diese Gestaltungsoptionen und -zwänge sich auch auf das Lebensende, auf sein Sterben als letzte Lebensphase erstrecken (Stadelbacher und Schneider 2017).
Vor diesem Hintergrund wird in unserer zunehmend heterogenen und individualisierten Gesellschaft immer deutlicher gefragt, inwieweit jener unbefragbare und unhintergehbare »Basissatz« von Palliative Care bzw. Hospizarbeit als ›gutes Sterben für möglichst alle‹ gewährleistet werden kann. Denn prinzipiell gilt: Palliative Care und hospizliche Begleitung richten sich als Angebot vorbehaltlos an jede Person in der existenziellen Krise von Schwerstkrankheit und Sterben. Und genauso kann jede Person – mittels ehrenamtlichen Engagements und entsprechender Haltung – Teil dieses Angebots werden. Im Blick auf unterschiedliche lebensweltlich-biographische Bezüge, kulturelle Zurechnungen oder ethnische Zugehörigkeiten erfahren mittlerweile aus unterschiedlichen kulturellen Kontexten geprägte, plurale Perspektiven auf Gesundheit, Krankheit, Leiden und Sterben zunehmend Beachtung, gehen damit doch divergierende Bedürfnisse, Anforderungen und Herausforderungen gerade auch am Lebensende einher. Die wachsende Präsenz dieser Problematik findet ihren Ausdruck und ihre Bearbeitung z. B. in einer steigenden Anzahl von Publikationen, Forschungsprojekten, Informationsveranstaltungen, berufspraktischen Handlungsempfehlungen und Leitlinien. Vielfältig sind die Bemühungen, Kultursensibilitäten zu schärfen und »diversitätssensible Versorgungsstrategien« (Brzoska et al. 2017, S. 1) zu etablieren, um den Zugang zu und die Inanspruchnahme von hospizlich-palliativen Versorgungsleistungen und Hilfen zu verbessern.
So einleuchtend diese zunehmende Sensibilisierung erscheinen mag, ist dabei zu fragen, inwieweit jenes oben skizzierte Verständnis vom »guten Sterben« als solches auf kulturspezifische Vorstellungen und Deutungen verweist: zum Verhältnis von Individuum und Gemeinschaft, zu Würde und Selbstbestimmung, zu Leiden und mögliche Kommunikation darüber und vor allem zu dem, was hierbei alles zu tun oder zu lassen sei. Folglich ist auch zu fragen, inwieweit jener Basissatz von Palliative Care bzw. Hospizarbeit selbst die Frage nach bzw. besser mögliche Antworten zur Zugangsgerechtigkeit – im Rahmen der Charta-Handlungsempfehlungen als zentrales Prinzip benannt – zu solchen Angeboten verstellt. Denn ist nicht bereits das Reden von einem Selbst, welches selbstbestimmt über sein Schicksal verfügen kann, darf, ja muss, kulturell höchst voraussetzungsvoll? Und schließlich ist auch und gerade das, was noch alles zu tun ist, wenn aus medizinischer Sicht nichts mehr gemacht werden kann, als Frage nach den institutionalisierten Praktiken an der Grenze des Lebens nicht nur kulturspezifisch, sondern ein Effekt von Machtrelationen und Herrschaftsstrukturen in jenen Institutionen, die »Sterben machen«.
Der vorliegende Beitrag setzt bei diesen Fragen an und erörtert mittels eines exemplarischen, diskursanalytisch orientierten Blicks in praxisrelevante Materialien, inwieweit bereits die mittlerweile verbreiteten Rhetoriken vom allseits gewünschten selbstbestimmten, professionell gut versorgten und umfassend begleiteten Sterben nicht nur die Frage nach der Zugangsgerechtigkeit aufwerfen, sondern sie gleichsam bereits kulturselektiv beantworten. Kurzum: Wie kultursensibel ist das Reden von der Kultursensibilität am Lebensende und wie anschlussfähig für welche Praktiken des Versorgens und Begleitens sind normative Bestandteile im Leitbild des »guten« Sterbens?
13.2 Würde und Selbstbestimmung als Frage nach dem Selbst (im Leben und) im Sterben
Würde erscheint in Verbindung mit Selbstbestimmung und möglichst weitgehender Leidfreiheit (Vermeidung von Schmerzen) als der entscheidende Bewertungsmaßstab, an dem gutes, individuelles Sterben gemessen wird (Müller et al. 2016). Würdig sterben kann nur der, der möglichst selbstbestimmt (und sei es in der selbstbestimmten Übergabe von Verantwortung an andere) sowie frei von vermeidbarem Leid (z. B. in Form von behandelbaren Schmerzen) sein Lebensende gestaltend in die eigenen Hände nimmt. Dies reicht z. B. von der Patientenverfügung über das Testament bzw. dem verantwortlichen »Regeln der letzten Dinge« bis hin etwa zum selbstverfügten Setzen des eigenen Todeszeitpunkts, wie in der Debatte um Sterbehilfe diskutiert (Graefe 2007). Dementsprechend wird Selbstbestimmung am Lebensende vielfältig in Beschlag genommen und dient Befürwortenden und Dagegensprechenden ein und derselben Sache gleichermaßen als argumentatorisches Zugpferd. Ist sie für die einen die Errungenschaft der Moderne, gilt sie anderen als Indiz gesellschaftlicher Verrohung, bedeutungsgleich mit der Negierung menschlicher Abhängigkeiten und Unzulänglichkeiten – gar vom »Fetisch modernen Denkens« (Radtke 2011, S. 17) ist die Rede. Trotz oder gerade wegen der ganz unterschiedlichen Deutungen und inhaltlichen Zuschreibungen, die der Selbstbestimmungsbegriff erfährt, ist er – nicht zuletzt aufgrund seiner seit der Aufklärung unhintergehbaren Verknüpfung mit Freiheit und Würde – als universeller Bezugspunkt unumstößlich. Um den Anspruch auf Selbstbestimmung wird gewusst – mit Verweis auf sie werden Akzeptanzen geschaffen, Notwendigkeiten anerkannt, Reden und Handeln legitimiert (Krähnke 2007; Gerhardt 2006; Peuten im Druck). Die zum Paradigma verfestigte Lesart der Selbstbestimmung als Selbstverantwortung entspricht dabei einem Zeitgeist der fortgeschrittenen Moderne, dessen Ideal das »unternehmerische Selbst« (Bröckling 2007, S. 47) ist. Es gilt, aktiv am Gelingen der eigenen Lebens- und Sterbegeschichte mitzuwirken – aktiv nicht nur im Sinne aktiven freiwilligen Tuns, sondern auch verstanden als ein Sich Verhalten-Müssen – sich auseinandersetzen, informieren, abwägen, zustimmen, ablehnen, vorsorgen, besprechen, planen, organisieren. Der Wille – oder zumindest die unbefragbare Bereitschaft – zur Willensbildung wird dabei immer schon vorausgesetzt, und sie reicht hinein bis in die praktischen institutionellen Vorgaben von Advance Care Planning oder gesundheitlicher Versorgungsplanung für die letzte Lebensphase. Die Patientin wird heute als mündige, aufgeklärte, selbstbestimmte Person gedacht, die auch am Lebensende kompetent den individuellen Sterbeprozess gestalten und für dessen Gelingen Verantwortung übernehmen will. Die subtile Wirkmacht der Selbstbestimmungsrhetorik regt die subjektive Auseinandersetzung mit dem eigenen Lebensende nicht nur an, sondern strukturiert auch in erheblichem Maße vor, was als »normal« zu gelten hat – was Patientinnen wollen sollen. »Die Selbstbestimmung ist nie ›gereinigt‹ von Fremdbestimmung, sie ist immer erkämpft und wird häufig kolonisiert und instrumentalisiert.« (Feldmann 2015, S. 128). Dabei verkompliziert bzw. transformiert sich die hier zum Ausdruck gebrachte verschränkte Gegensätzlichkeit von Selbst- und Fremdbestimmung dort, wo sich die Machtasymmetrien in der sozialen Beziehung zwischen den verschiedenen ›Selbsten‹ aufgrund existenzieller Abhängigkeiten verändern. Wie bspw. pädagogische oder sozialarbeiterische Fachkräfte aus ihrer Praxis wissen, gilt dies immer dann, wenn die Voraussetzungen für Selbstbestimmung erst geschaffen werden müssen (z. B. in der Eltern-Kind-Beziehung) oder sie nur noch soweit möglich ist, wie sie durch die Unterstützung seitens anderer ermöglicht oder gewährt wird (z. B. in der Versorgungssituation bei Dementen und Sterbenden).
Bei der Vehemenz und Kontinuität, mit der selbstbestimmte, selbstverantwortliche Subjekte adressiert werden, bleibt allerdings zu fragen, ob diese »die ihnen jeweils zugewiesene ›autonome Subjektivität‹ […] tatsächlich erleben« (Graefe 2007, S. 16, Herv. i. O.). Den Anforderungen der Selbstbestimmung am Lebensende kann nur dann Genüge geleistet werden, wenn sie im eigenen Lebenskontext Relevanz besitzt, erfahrbar wird und als Recht wahrgenommen werden kann (Schneider 2012). Insofern kann den hegemonialen Deutungsperspektiven der Selbstbestimmung durchaus ein »nicht angemessener Rigorismus« (Salloch 2011) vorgeworfen werden, der menschliche Bedingtheiten und soziale Situiertheiten zu wenig im Auge hat. »Denn was geschieht mit einem gerade am Lebensende möglichen prinzipiellen Nicht-Wissen-Können oder vielleicht sogar einem Nicht-Wissen-Wollen?« (Schneider 2014, S. 131). Das fortwährend reproduzierte Wissen darüber, wie gutes, sprich selbstbestimmtes Sterben gelingen kann, kanalisiert den symbolischen Zugang zu verschiedenen Sinn- und Bedeutungswelten am Lebensende – und damit gleichsam auch den praktischen Zugang zu den entsprechenden Angeboten. Differierende Vorstellungen bzw. andere symbolische Ordnungen vom Lebensende geraten dabei in den Hintergrund bzw. stehen somit zwangsläufig vor höheren Zugangshürden. Vor diesem Hintergrund ist also nicht nur entscheidend, dass, sondern vor allem wie von Kultursensibilität am Lebensende gesprochen wird.
13.3 Zugangsrelevante Rhetoriken als diskursive Inklusions-/Exklusionspraktiken
Die folgenden Ausführungen konzentrieren sich auf Materialien, die sich mit der Begleitung und Versorgung von sogenannten Menschen mit Migrationshintergrund am Lebensende befassen. Die zunehmende Alterung der Migrationsgesellschaft und die Tatsache, dass Menschen mit Migrationshintergrund bestehende hospizlich-palliative Versorgungs- und Informationsangebote nur sehr begrenzt wahrnehmen (Jansky und Nauck 2015), verstärken die Brisanz der Thematik, erhöhen den Handlungsdruck entsprechend und dürften dazu beigetragen haben, dass hier bislang ein besonders großes Augenmerk der gesellschaftspolitischen Auseinandersetzung liegt. Meist richtet sich der Fokus auf Kommunikationsbarrieren, die Kulturbedingtheit von Werten, Wahrnehmungen und Verhaltensweisen, besondere Pflegebedürfnisse, den Umgang mit versorgungsrelevanten Aspekten wie Diagnose, Schmerz, Intimität und Trauer, mangelndes Patientenwissen oder Wissenslücken und fehlende Kompetenzen auf ärztlich-pflegerischer Seite. Begegnet wird der defizitären Lage mit dem Ausbau bedarfsorientierter Aus-, Weiter- und Fortbildungskonzepte, dem Bereitstellen von muttersprachlichen Informationen, Angeboten in einfacher Sprache sowie vermehrter Forschung und Öffentlichkeitsarbeit. Unter den Schlagworten Transkulturalität, Interkulturalität und Kultursensibilität wird mitunter höchst differenziert darauf aufmerksam gemacht, wie wichtig es sei, individuelle Bedürfnisse konsequent im Blick zu behalten und Wege zu finden, die ein möglichst vorbehaltsloses Miteinander ermöglichen (dazu exemplarisch z. B. Hach 2017; Urban 2011; Domenig 2007).
Dabei gilt: Sterben ist weniger individuell als vielmehr heterogen– und zwar auch innerhalb der ausgemachten Kulturen des Sterbens. Von dieser Annahme ausgehend sind auch die Leitvorstellungen und normativen Vorgaben eines guten Sterbens je sozial-, raum- und zeitbedingt und lassen sich nicht allein mit dem Selbstbestimmungskonzept, basierend auf Würde und in enger Verbindung mit Leidfreiheit samt weiteren subsumierten Prämissen (wie institutionelle Versorgung etc.), abbilden. Vermeintlich Selbstverständliches, immer schon Mitgedachtes, läuft dabei Gefahr, kulturell anderes Sterbewissen auszuschließen bzw. zu disqualifizieren. Wie solche eigenen Voraussetzungen sich ganz unterschiedlich äußern, an manchen Stellen offensichtlicher zutage treten als an anderen, an denen sie eher implizit bleiben, sollen die folgenden Hinweise exemplarisch illustrieren.
So heißt es bspw. in der vom Ethikkomitee der DRK Kliniken Berlin herausgegebenen Leitlinie Ethik am Lebensende unter 1.4 Weltanschauliche und kulturelle Aspekte:
»Menschen sollen besonders am Lebensende nicht nur in ihrer Selbstbestimmung über Behandlungsmaßnahmen, sondern als gesamte Person in ihrer psychophysischen Einheit respektiert werden. Für die Betreuenden ist es daher wichtig, auch die weltanschaulichen, re...