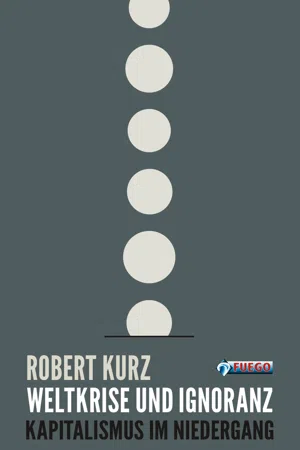
eBook - ePub
Weltkrise und Ignoranz
Kapitalismus im Niedergang - Ausgewählte Schriften
- 240 pages
- English
- ePUB (mobile friendly)
- Available on iOS & Android
eBook - ePub
Weltkrise und Ignoranz
Kapitalismus im Niedergang - Ausgewählte Schriften
About this book
Der Kapitalismus steuert auf eine Weltwirtschaftskrise zu. Damit gewinnen die bereits in den achtziger Jahren entwickelten krisentheoretischen Thesen und Analysen von Robert Kurz weit mehr als bisher an Bedeutung. Das angeblich Unmögliche beginnt wahr zu werden, auch wenn sich das herrschende Bewusstsein gegen die Einsicht sträubt, dass es um etwas anderes geht als um eine bloß zyklische Abwärtsbewegung, die nach ein paar Monaten oder höchstens einem Jahr glücklich überstanden sein wird.
Frequently asked questions
Yes, you can cancel anytime from the Subscription tab in your account settings on the Perlego website. Your subscription will stay active until the end of your current billing period. Learn how to cancel your subscription.
No, books cannot be downloaded as external files, such as PDFs, for use outside of Perlego. However, you can download books within the Perlego app for offline reading on mobile or tablet. Learn more here.
Perlego offers two plans: Essential and Complete
- Essential is ideal for learners and professionals who enjoy exploring a wide range of subjects. Access the Essential Library with 800,000+ trusted titles and best-sellers across business, personal growth, and the humanities. Includes unlimited reading time and Standard Read Aloud voice.
- Complete: Perfect for advanced learners and researchers needing full, unrestricted access. Unlock 1.4M+ books across hundreds of subjects, including academic and specialized titles. The Complete Plan also includes advanced features like Premium Read Aloud and Research Assistant.
We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.
Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.
Yes! You can use the Perlego app on both iOS or Android devices to read anytime, anywhere — even offline. Perfect for commutes or when you’re on the go.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Yes, you can access Weltkrise und Ignoranz by Robert Kurz, Roswitha Scholz, Claus Peter Ortlieb in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in Social Sciences & Political Philosophy. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.
Information
Der Knall der Moderne
Innovation durch Feuerwaffen, Expansion durch Krieg: Ein Blick in die Urgeschichte der abstrakten Arbeit
Hartnäckig hält sich das aufklärerische Gerücht, das Waren produzierende System der Moderne habe seinen Ursprung in einem »Prozess der Zivilisation« (Norbert Elias), es sei im Gegensatz zur Totschlägerkultur des so genannten Mittelalters ein Produkt friedlichen Handels und Wandels, bürgerlichen Fleißes, wissenschaftlicher Neugierde, wohlfahrtssteigernder Erfindungen und wagemutiger Entdeckungen gewesen. Und als Träger all dieser schönen Dinge könne das moderne »autonome Subjekt« gelten, das sich aus ständisch-agrarischen Bindungen zur »Freiheit des Individuums« emanzipiert habe. Nur zu dumm, dass die aus einer solch geballten Ladung von schieren Tugenden und Fortschritten hervorgegangene Produktionsweise von Massenarmut und globaler Verelendung, Weltkriegen, Weltkrisen und Weltzerstörung gekennzeichnet ist.
Die wirklichen destruktiven und mörderischen Resultate der Modernisierung verweisen auf einen anderen Anfang als den offiziellen aus der ideologischen Kinderfibel. Seitdem Max Weber auf den geistigen Zusammenhang von Protestantismus und Kapitalismus hingewiesen hat, ist die Urgeschichte der Moderne erst sehr grob und keineswegs kritisch klassifiziert worden.
Mit einer gewissen »bürgerlichen Schläue« hat man die Motive und Entwicklungen, von denen die moderne Welt hervorgebracht wurde, weitgehend ausgeblendet, um die Morgenröte der bürgerlichen Freiheit und der Entfesselung des Waren produzierenden Systems in falscher Reinheit erstrahlen zu lassen.
Es gibt allerdings einen zum offiziellen Geschichtsbild konträren historischen Ansatz, der erkennen lässt, dass die wirklichen Ursprünge des Kapitalismus in der frühen Neuzeit keineswegs einer friedlichen Ausdehnung der Märkte geschuldet, sondern wesentlich kriegsökonomischer Natur waren. Tatsächlich gab es Geld und Warenbeziehungen, Fernhandel und Märkte schon seit der Antike in manchmal kleinerem, manchmal größerem Umfang, ohne dass daraus aber jemals ein totalitäres System von Markt- und Geldwirtschaft wie in der Moderne entstanden wäre. Es handelte sich dabei immer nur, wie Marx festgestellt hat, um eine ökonomische »Nischenform« am Rande agrarischer Naturalwirtschaften. Dass der eigentliche take off eines Systems, in dem das Geld als »automatisches Subjekt« (Marx) auf sich selbst rückgekoppelt wird, nicht allein in der ideellen Revolution des Protestantismus, sondern auch in der Feuerwaffen-Innovation des frühmodernen Militärwesens zu suchen sein könnte, erscheint als Faktum und Gedanke durchaus bis zu einem gewissen Grad auch in Max Webers Untersuchungen.
Aber Weber hatte als notorischer Ideologe des alten deutschen Imperialismus offensichtlich kein Interesse, diesen Gedanken zuzuspitzen und zu systematisieren. Schon 1913 hatte der Sozial- und Wirtschaftshistoriker Werner Sombart in seinem Werk »Krieg und Kapitalismus« explizit auf die kriegsökonomischen Wurzeln der Moderne aufmerksam gemacht. Aber auch er führte diesen Ansatz nicht weiter, weil er schon kurze Zeit später selbst zu den führenden Kriegsideologen gehörte und anschließend als dezidierter Antisemit zu den Nazis überging. Es dauerte mehr als ein halbes Jahrhundert, bis der Zusammenhang von kapitalistischer Genesis und »politischer Ökonomie der Feuerwaffen« erneut aufgegriffen wurde, so vom Ökonomen Karl Georg Zinn (»Kanonen und Pest«, 1989) im deutschen und vom Neuhistoriker Geoffrey Parker (»Die militärische Revolution«, 1990) im englischen Sprachraum. Allerdings sind auch diese Untersuchungen nicht frei von apologetischen Zügen, obwohl sie vernichtendes Material enthalten. Das seit der Aufklärung tradierte schönfärberische Weltbild der Modernisierung darf weiter die Köpfe verkleistern.
Defizite des historischen Materialismus
Man sollte meinen, dass die radikale Gesellschaftskritik Marxscher Provenienz dafür prädestiniert gewesen wäre, den von der bürgerlichen Theorie liegen gelassenen Ansatz aufzugreifen und weiterzuentwickeln. Schließlich war es Marx, der nicht nur die destruktive Funktionslogik des »automatischen Subjekts« und die darin eingeschlossene, von den Bedürfnissen losgelöste Tätigkeitsform der »abstrakten Arbeit« analysiert, sondern auch – etwa im Kapitel über die »so genannte ursprüngliche Akkumulation« – die alles andere als zivilisatorische Vorgeschichte des Kapitalismus ungeschminkt dargestellt hat.
Freilich bleibt auch in dieser Darstellung der kriegsökonomische Ursprung der Kapitallogik unterbelichtet. Und der Marxismus nach Marx hat diesen Ansatz nicht wieder aufgenommen; die vorindustrielle Konstitutionsgeschichte des Waren produzierenden Systems war ihm unheimlich, weil seltsam uneindeutig im Sinne der eigenen Doktrin.
Es gibt nämlich in der Marxschen Theorie selbst einen Grund, warum auch der Marxismus den für die bürgerlichen Apologeten unangenehmen Zusammenhang verdrängen musste. Denn ein wesentliches Moment im Konstrukt des historischen Materialismus besteht darin, die Geschichte als eine Abfolge von »notwendigen« Entwicklungsstufen zu deuten, in der auch dem Kapitalismus sein Platz und sogar eine »zivilisatorische Mission« (Marx) zugestanden wird. Zu diesem von der bürgerlichen Aufklärungsphilosophie und von Hegel geerbten Konstrukt, das bloß materialistisch gewendet und sozialistisch verlängert wurde, passt aber äußerst schlecht eine völlig antizivilisatorische Gründungsgeschichte, in der das Kapital – wie Marx sagt – »aus allen Poren blut- und schmutztriefend« zur Welt gekommen ist.
Erst recht widerspricht es dem historischen Materialismus, wenn die Verwertungslogik und die abstrakte Arbeit nicht durch Produktivkraftentwicklung »aus dem Schoß« der vormodernen Agrargesellschaft geboren wurden, sondern ganz im Gegenteil als schiere »Destruktivkraftentwicklung«, die sich äußerlich als fremdes Prinzip erstickend über die agrarische Naturalwirtschaft legte, statt diese über ihre Beschränktheit hinaus weiterzuentwickeln.
Um das metatheoretische, geschichtsphilosophische Schema zu retten, haben auch die Marxisten die Vor- und Urgeschichte der kapitalistischen Konstitution im Dunkeln gelassen bzw. kontrafaktisch klassifiziert. Offensichtlich war dabei die Angst bestimmend, womöglich einem reaktionären Denken Vorschub zu leisten. Aber das ist eine falsche Alternative, wie sie stets von neuem aus den Widersprüchen bürgerlicher Ideologie hervorgeht. Aufklärerische Fortschrittsmythologie einerseits, reaktionärer Kulturpessimismus und Agrarromantik andererseits sind nur die beiden Seiten derselben Medaille. Beiden Denkweisen liegt das Bedürfnis nach einer positiven Ontologie zugrunde.
Wenn aber der negatorische Impuls durchgehalten wird, »alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes Wesen ist« (Marx), bedarf es keines ontologischen Konstrukts mehr. Daraus könnte gefolgert werden, dass die Essentials des historischen Materialismus im Grunde genommen nur für eine einzige Gesellschaftsformation gelten, nämlich die kapitalistische. Abgesehen davon stellt sich natürlich die Frage, wie eigentlich die kapitalistische Produktionsweise aus der »politischen Ökonomie der Feuerwaffen« hervorgegangen ist.
Unritterliche Waffen
Irgendwann im 14. Jahrhundert muss es irgendwo in einer südwestdeutschen Alchimistenküche einen gewaltigen Knall gegeben haben; eine unvorsichtig zusammengestellte Mischung aus Salpeter, Schwefel und anderen Chemikalien flog in die Luft. Der wissbegierige Mönch, der dieses Experiment veranstaltete, hieß Berthold Schwarz. Genaueres wissen wir nicht von ihm. Aber jene Explosion ist wahrscheinlich der eigentliche Urknall der Moderne gewesen. Die Chinesen kannten das Schießpulver übrigens schon lange vorher und nutzten es außer für prachtvolle Feuerwerke gelegentlich auch militärisch. Aber sie kamen nicht auf die Idee, mit Hilfe dieses Explosivstoffes weit tragende Distanzwaffen für Projektile herzustellen, deren Wirkung im wahrsten Sinne des Wortes durchschlagend war. Diese Anwendung blieb den frommen Christen Europas vorbehalten. Nachgewiesen ist der Einsatz eines Geschützes erstmals für das Jahr 1334, als Bischof Nikolaus I. von Konstanz damit die Stadt Meersburg verteidigen ließ.
Damit war die »Feuerwaffe« geboren, bis heute das allgemein gebräuchliche Mordwerkzeug. Diese Basisinnovation der Moderne zog zunächst jene »militärische Revolution« (Parker) nach sich, die den historischen Aufstieg des Westens kennzeichnen sollte. Schon im Mittelalter hatte man die Folgen von wirksamen Distanzwaffen für die traditionelle gesellschaftliche Ordnung geahnt. Einschlägige ideologische Vorbehalte wurden geltend gemacht, als um das Jahr 1000 aus dem Orient die Armbrust als neuartige Distanzwaffe auftauchte. Das zweite Lateranische Konzil verbot 1129 den Einsatz dieses Kriegsinstruments als »unritterliche Waffe«. Nicht umsonst wurde seither die Armbrust zur Hauptwaffe der Räuber, Outlaws und Rebellen.
Die Feuerwaffe machte das stolze gepanzerte Rittertum vollends militärisch lächerlich. Noch im Dreißigjährigen Krieg lässt Grimmelshausen seinen »Simplicissimus« über die eigene militärische Karriere vom Waldbauernkind zum Offizier sagen: »Aber diese Ursach macht mich so groß, dass jetziger Zeit der geringste Roßbub den allertapfersten Helden von der Welt totschießen kann, wäre aber das Pulver noch nit erfunden gewesen, so hätt ich die Pfeife wohl im Sack müssen stecken lassen.«
Allerdings befanden sich die »Feuerrohre« nicht mehr in den Händen von Außenseitern. Denn sobald sich die Möglichkeiten der neuen Waffentechnik abzeichneten, gab es kein Halten mehr. Aus Furcht, ins Hintertreffen zu geraten, rissen sich die großen und kleinen Herrscher um die explosiven Wunderwaffen. Da hätte kein Konzil mehr geholfen. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich das know how der neuen Vernichtungsmaschinen. Besonders in den oberitalienischen Städten der Renaissance mit ihrer relativ fortgeschrittenen handwerklichen Kunstfertigkeit schritt auch die Technologie der Feuerwaffen rascher als anderswo voran. Alle Leistungen und Entdeckungen in dieser Geburtsepoche der modernen Welt wurden überlagert von der Kunst, Kanonen zu bauen und einzusetzen.
Am Anfang des 16. Jahrhunderts beschreibt der norditalienische Theoretiker Antonio Cornazano diese alles entscheidende Rolle der Feuerwaffen, er besingt die Kanone geradezu und bezeichnet sie recht persönlich als »Madama la bombarda, die zum Sohn das Gewehr hat. Diese teuflische Kunst hat alle anderen ausgeschaltet und öffnet den Feinden die befestigten Städte und macht mit ihrem Dröhnen ganze Armeen erzittern.« (Zit. nach: zur Lippe 1988, 37)
Immer bessere Gewehre wurden gebaut und vor allem immer größere Kanonen, die immer weiter schießen konnten. Die größten Feldgeschütze bekamen sogar Eigennamen. Im Gegenzug entwickelte sich die Technik des Festungsbaus. So war der erste Schub der Modernisierung identisch mit einem Rüstungswettlauf und dieser Vorgang hat sich bis heute geradezu als Wesensmerkmal der Moderne periodisch wiederholt. Je größer und technologisch ausgereifter aber die Kanonen und Bollwerke wurden, desto deutlicher trat auch der gesellschaftsverändernde Charakter der »militärischen Revolution« zutage.
Die herausgelöste Militärmaschine
Es stellte sich sehr schnell heraus, dass die Innovation der Feuerwaffen keineswegs bloß auf eine Veränderung der militärischen Technologie beschränkt blieb. Die daraus folgende Umwälzung in der Organisation und Logistik des Krieges schnitt noch viel tiefer in die Verhältnisse ein. Bis dahin waren in fast allen agrarischen Gesellschaften die bürgerliche und die militärische Organisationsform der Gesellschaft weitgehend identisch gewesen. In der Regel war jeder freie Vollbürger auch eine kriegspflichtige Militärperson. Ein Heer sammelte sich nur, wenn die jeweilige oberste Instanz in Gestalt von Kaiser, König, Herzog, Konsul usw. die Männer »zu den Waffen rief«, um einen Kriegszug zu führen. Zwischen diesen Gelegenheiten existierte normalerweise kein nennenswerter militärischer Apparat. Zwar hatten einige Großreiche wie das chinesische oder das spätrömische bereits mehr oder minder starke Armeen ständig unter Waffen. Aber so aufwendig diese militärische Dauerbelastung des Öfteren auch sein mochte, sie konnte doch die allgemeine Produktions- und Lebensweise nur äußerlich berühren.
Der entscheidende Unterschied liegt im Problem der Ausrüstung. Der vormoderne Krieger brachte seine Waffen mit und trug sie auch im Alltag oder bewahrte sie zu Hause auf. Helm, Schild und Schwert konnten nahezu in jeder Dorfschmiede produziert werden. Und jeder Hirtenjunge wusste, wie man Pfeil und Bogen oder eine Schleuder herstellt. Auch die gesamte Logistik der Kriegführung konnte dezentral organisiert werden. Dies entsprach ganz den weitgehend dezentralen Verhältnissen in einer agrarischen Hochkultur. Die Zentralgewalt, selbst die despotische, war hier immer nur begrenzt wirksam, und ihr Arm reichte kaum in das alltägliche Leben hinein.
Damit war es nun für immer vorbei. Musketen und vor allem Kanonen konnte man nicht mehr in jedem Dorf herstellen und zu Hause aufbewahren oder sie gar gewohnheitsmäßig bei sich tragen. Das Mordwerkzeug war plötzlich überdimensional geworden und überstieg den Rahmen der menschlichen Verhältnisse. In der Kanone finden wir also gewissermaßen den Archetypus der Moderne, nämlich das Werkzeug, das seinen Schöpfer zu beherrschen beginnt. Es entstand eine neuartige Rüstungs- und Todesindustrie, die das Urbild oder die Matrix der späteren Industrialisierung bildete und deren Leichengeruch die modernen Gesellschaften einschließlich der Weltmarktdemokratien unserer Tage nie mehr losgeworden sind.
Der militärische Apparat begann, sich von der bürgerlichen Organisation der Gesellschaft loszulösen. Das Kriegshandwerk wurde zum spezialisierten Berufsstand und die Armee zu einer ständigen Einrichtung, die die übrige Gesellschaft zu dominieren begann, wie Geoffrey Parker in seiner Untersuchung zeigt: »Im Zusammenhang mit dieser Entwicklung nahm die Größe der Armeen in ganz Europa zu, die bewaffneten Streitkräfte einiger Staaten wuchsen zwischen 1500 und 1700 um das Zehnfache, und die Strategien für den Einsatz dieser größeren Armeen wurden ambitionierter und komplexer (...) Schließlich führte die militärische Revolution dazu, dass sich die Auswirkungen des Krieges auf die Gesellschaft in dramatischer Weise verschärften: Die Kosten stiegen, die Schäden mehrten sich und die größeren Armeen stellten höhere Anforderungen an die Verwaltung.« (Parker 1990, 20)
Auf diese Weise wurden die gesellschaftlichen Ressourcen in einem nie dagewesenen Umfang für militärische Zwecke umgeleitet. Sicherlich hatte es auch früher schon gelegentlich eine Art Vergeudungsmilitarismus gegeben, aber niemals derart dauerhaft und mit einem derart hohen Anteil am Sozialprodukt. Der neue Rüstungs- und Militärkomplex entwickelte sich rasch zum unersättlichen Moloch, der ungeheure Mittel verschlang und dem die besten gesellschaftlichen Möglichkeiten geopfert wurden. Trotz oder gerade wegen ihrer vielen Heldengesänge und ihres kriegerischen Habitus waren die vormodernen Kulturen in einem viel geringeren Ausmaß auf Rüstungskonsum zugeschnitten gewesen, und ihre Kriege könnten fast wie harmlose Raufereien erscheinen.
Karl Georg Zinn zieht in dieser Hinsicht einen für die Moderne wenig schmeichelhaften Vergleich: »Gemessen an der waffentechnischen Entwicklung vom 14. Jahrhundert an stellte das Mittelalter (...) eine relativ schwächliche Militärmacht bereit. Krieg und Rüstung belasteten die Gesellschaft im Mittelalter weitaus weniger als in der Neuzeit. Der Anteil des landwirtschaftlichen Mehrprodukts, der für die Vernichtungszwecke verbraucht wurde, blieb während des Mittelalters relativ gering, sonst hätten weder die für den agrartechnischen Fortschritt notwendigen Investitionen erfolgen können noch wären so viele Kathedralen, neue Städte und Stadtbefestigungen errichtet worden. Vor allem sticht aber beim Vergleich von Mittelalter und Neuzeit die grundlegend verschiedene Qualität des technischen Fortschritts hervor: landwirtschaftliche Neuerungen im Mittelalter und städtische Rüstungs- und Luxustechnik bei Vernachlässigung der Landwirtschaft in der Neuzeit.« (Zinn 1989, 58)
»Madama la bombarda« verschlang aber nicht nur einen unverhältnismäßig großen Teil des gesellschaftlichen Produkts, sondern sie gab auch d...
Table of contents
- Über dieses Buch
- Die Aufhebung der Gerechtigkeit
- Realisten und Fundamentalisten
- Politische Ökonomie der Simulation
- Die Maschine der Selbstverantwortung
- Apocalypse Now!
- Totalitäre Ökonomie und Paranoia des Terrors
- Das Ende der Theorie
- Geld und Antisemitismus
- Der Knall der Moderne
- Wer ist »Big Brother«?
- Weibliche Tugenden
- Das Licht der Aufklärung
- Enteignung und Aneignung
- Aneignung als Kapitulation der Kritik
- Zweiter Abschied von der Utopie
- Der Alptraum der Freiheit
- Der molekulare Ausnahmezustand
- Die universelle Harry-Potter Maschine
- Der schwarze Frühling des Antiimperialismus
- Unrentable Menschen
- Weltkrise und Ignoranz
- Die Krise des Kapitals und die Krise der Linken
- Die Klimax des Kapitalismus
- Veröffentlichungsnachweise
- Über den Autor
- Über Fuego
- Impressum