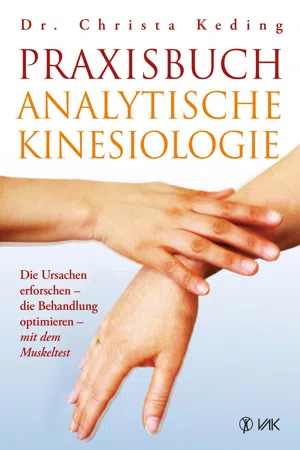![]()
TEIL II
DIE PRAXIS
DES
MUSKELTESTENS
![]()
Von einfachen zu komplexen Anwendungen
In den vorausgehenden Kapiteln habe ich alles beschrieben, was Sie benötigen, um den Muskeltest als Untersuchungsinstrument erfolgreich anwenden zu können:
• Die Physiologie macht verständlich, wieso er funktioniert.
• Mit der optimalen Testtechnik wissen Sie das Instrument zuverlässig einzusetzen.
• Der Muskeltest-Dialog öffnet Türen zum vegetativen Informationspool und ins Un(ter)bewusste.
• Die idiomotorische Programmierung des Rastertests erlaubt Ihnen vielfältigste und zugleich übersichtliche Anwendungen.
• Die Frage nach den „Antwortgebern“ hat uns sensibilisiert für Aufmerksamkeit und Selbstreflexion im Umgang mit dem Testverfahren.
• Wir haben einen Blick auf den Substanztest geworfen, für den wir das wahrnehmende Sinnesorgan (noch) nicht benennen können, und wir haben den Dialogtest betrachtet.
Wie lässt sich das alles nun zu einem sinnvollen System zusammenfügen, das für unser Leben beziehungsweise für die Heilkunde wirklich so nützlich ist, wie ich es zu Beginn angekündigt habe? Und: Kann man sich die praktische Anwendung des Muskeltests überhaupt selbst so gut aneignen, dass man sicher und verantwortungsvoll damit umgehen kann? – Das ist tatsächlich möglich, sofern man die Grundvoraussetzungen beherzigt, nämlich konsequente Selbstreflexion und Beschränkung auf den eigenen Kompetenzbereich. (Darauf komme ich immer wieder und vor allem am Ende des Buches konkreter zurück.) Auf dieser Basis möchte ich Sie in angemessenen Schritten in das „Muskeltest-Training“ einführen. Denn mit dem Muskeltesten ist es wie mit anderen Fertigkeiten auch: Man muss es trainieren und man braucht angemessene Trainingseinheiten, die folgerichtig aufeinander aufbauen. Das heißt: Sich das Schwerste möglichst nicht gleich beim „Warmlaufen“ vornehmen, sondern mit Erfahrungen beginnen, die Sicherheit schaffen und auf denen, wenn sie „sitzen“, weiter aufgebaut werden kann.
Wenn Sie die Prinzipien des Muskeltestens beherrschen, können Sie dieses Instrument in vielfältiger Weise nutzen. Seiner Grundfunktion entsprechend – nämlich dass er uns Zugang verschafft zu Informationen des Körpersystems, die im weitesten Sinne mit seiner Unversehrtheit zu tun haben – liegt sein „Zuhause“ in der Heilkunde. Die Reaktionsgrundlage des Muskeltests (Kontrollverlust der Muskulatur) ist ja im Prinzip ein Warnsignal zur Gefahrenabwehr; die primäre Funktion des Muskeltests steht also unmittelbar in Verbindung mit der Gesunderhaltung des Organismus.
Dementsprechend kann der Sinn des Muskeltestens nicht darin liegen, spektakulär irgendetwas „Spannendes“ auszutesten (auch nicht, ob Rom die Hauptstadt von Italien ist oder welche der vier Antworten bei „Wer wird Millionär?“ die richtige ist …). Es geht vielmehr darum, Kontakt aufzunehmen zu Instanzen von Körper und Seele, die uns innerhalb heilungsfördernder Prozesse besser leiten und entscheiden helfen. Hierzu ist der Muskeltest wie geschaffen und er bringt in der Heilkunde einen gravierenden Vorteil ins Spiel: Im Unterschied zu den üblichen Untersuchungsmethoden bietet er eine „Schau von innen“.
Übliche Befunde, ob von Labor, Abhorchen oder Röntgenbild, ermöglichen nur einen Blick von außen; sie werden zwar auch aus dem Individuum gewonnen, doch bedarf jeder Befund weiterer Interpretation, wird also sozusagen von dem isoliert, durch den Abgleich mit allgemeinen Erfahrungen und daraus resultierenden „Normalwerten“ gedeutet und als allgemeine therapeutische Konsequenz an den Betroffenen „zurückgegeben“. Ein Befund aber beweist keinen Zusammenhang! Schmerzlich haben das in meiner Klinikzeit beispielsweise einige Patienten erlebt, deren Leberwert Gamma-GT erhöht war: Umgehend wurden sie des Alkoholmissbrauchs verdächtigt, weil dieser Wert lange Zeit als Indikator für alkoholbedingten Leberschaden galt. Heute weiß man, dass es auch andere Gründe für die Erhöhung geben kann, und man braucht weitere Parameter, um die „Beweislage“ zu stärken.
Der Muskeltest hingegen ist das ideale Instrument, mit dem man tatsächlich den individuellen Zusammenhängen nachgehen kann. Insofern sind, kriminalistisch gesprochen, die klinische Medizin und auch weitestgehend die Regulationsmedizin auf „Indizien“ angewiesen – der Muskeltest jedoch verhilft zum „Geständnis“ …
Wie könnte nun eine erste sinnvolle Anwendung in der Praxis aussehen, wenn man das Instrument Muskeltest und seine Verlässlichkeit kennenlernen, erproben und nutzbringend einsetzen will?
Mit dem Muskeltest ist es grundsätzlich möglich, sehr komplexe Befundaufnahmen und daraus resultierende Therapiepläne zu erstellen. Darauf werden wir zuarbeiten. Wenn man aber gleich mit den komplexesten Problemstellungen begänne, würde das den Lernprozess enorm erschweren. Nach meiner Erfahrung (und nach der Erfahrung vieler Anwender aus unseren Ausbildungen) ist es ideal, mit einem leicht überschaubaren Arbeitssystem zu beginnen. Günstig ist es beispielsweise, den Test zunächst einmal zum „Berater“ bei der Therapiewahl zu machen, also reichlich mit dem Rastertest (Selektion von Möglichkeiten nach vorgegebenen Kriterien) und bei Bedarf ergänzend mit dem Dialogtest zu arbeiten, hiermit Erfahrungen zu sammeln und dann das Untersuchungsspektrum auszuweiten.
Der Rastertest in der Praxis
Weil ich diesen Aspekt für so wichtig halte, erlaube ich mir, ihn hier noch einmal zu betonen:
Die Arbeit mit Rastern (= Suchoptionen) zur Differenzierung von mehr als drei Objekten ist eine der wertvollsten Strukturen der Untersuchung mit dem Muskeltest innerhalb der Heilkunde!
Ein paar Beispiele mögen Sie anregen, Bereiche auszuwählen, in denen Sie mit dem Praxistraining sinnvoll beginnen können. Ihrer Inspiration bleibt es überlassen, weitere Einsatzmöglichkeiten zu erkunden, in denen der Muskeltest hilfreiche Informationen beisteuert. Wenn Sie dann immer wieder überzeugende Erfahrungen damit sammeln, werden Sie sich vermutlich (genauso wie ich) fragen, wieso er nicht längst zu einem Standardinstrument in der Schul- und Komplementärmedizin bzw. Naturheilkunde geworden ist …
Auswahlverfahren (bei denen der Muskeltest individuelle Entscheidungen ermöglicht) kommen in der Praxis sehr häufig vor, etwa für folgende Zwecke:
• Nahrungsmittel (Unverträglichkeiten können bei vielen Erkrankungen mitverantwortlich sein.)
• Diätempfehlungen (auch zeitlich begrenzte)
• Körperpflegemittel (etwa bei diversen Hauterkrankungen)
• Therapeutische Materialien (zum Beispiel Zahnwerkstoffe)
• Medikamente (allopathisch wie homöopathisch)
• Nachweis von Allergien
• Therapieverfahren (bei nichtmedikamentösen Behandlungen)
• Diagnoseverfahren
• Suche nach emotionalen Triggerbegriffen in der psychotherapeutischen Begleitung (– ausführlich behandelt in meinem früheren Buch Gesund durch psychologische Kinesiologie; Näheres dazu auf meiner Internetseite: www.praxis-keding.de/Ausbildung)
Auch als Alltagstest für jedermann findet der Muskeltest bei medizinischen Laien durchaus sinnvollen Einsatz, zum Beispiel:
– zum Austesten verträglicher bzw. gesundheitsfördernder oder gesundheitsschädlicher Nahrungsmittel (der Muskeltest als „Einkaufsberater“)
– zum Auswählen von Körperpflegeprodukten und Kosmetika (sehr bewährt bei Sonnenschutzmitteln, Zahnpasta, Waschpulver und vielem mehr)
– zum Auswählen von Selbstmedikation und Hausmitteln bei Bagatellerkrankungen.
Die Kriterien, nach denen die jeweiligen Substanzen selektiert werden sollen, müssen vor Testbeginn gut durchdacht sein – wobei sich einige Standardsituationen wiederholen, in denen dann natürlich auch auf vorgefertigte Formulierungen zurückgegriffen werden kann. Diese jeweiligen Optionspaare sollten um der Klarheit willen möglichst vor dem Testen benannt oder notiert werden, beispielsweise so:
Optionen
• Der Muskel hält (+), wenn die Substanz für den Organismus verträglich ist.
Der Muskel gibt nach (–) bei Unverträglichkeit.
• + wenn an dieser Stelle als Zahnmaterial geeignet und verträglich;
–, wenn eines davon nicht der Fall ist.
• +, wenn das Medikament den Heilungsprozess relevant fördert;
–, wenn das nicht der Fall ist.
• +, wenn das Medikament für den Heilungsprozess unerlässlich ist;
–, wenn man darauf verzichten kann.
• + bei dem, was als Sofortmaßnahme erforderlich ist;
– bei allem, was zunächst zurückgestellt werden kann (beispielsweise bei akuter Dekompensation einer chronischen Erkrankung).
• + bei Therapieverfahren, die hier und heute die Beschwerden lindern;
– bei allem, was nicht ausreichend nützt oder nicht verfügbar ist.
In manchen Fällen empfiehlt sich sogar ein wiederholter Testdurchgang mit denselben Substanzen unter verschiedenen Vorgaben, um noch differenziertere Entscheidungsmöglichkeiten zu nutzen, indem man die Auswahlkriterien vom Übergeordneten zum Spezielleren verfeinert.
Beispiele für Verfeinerung:
• Zunächst „verträgliche” Nahrungsmittel austesten, dann erst unter diesen die „empfehlenswerten”, sodass dem Patienten eine Entscheidungsoption bleibt, falls die „Empfehlungs”-Testergebnisse sein Ernährungsspektrum stark einschränken.
• Zunächst „geeignete” Medikamente auswählen (was sich üblicherweise auf Wirksamkeit und Verträglichkeit bezieht), um unter „optimal” dann auch situationsbezogen das Ideale zu wählen. (Tetracyclinpräparate könnten zwar in Bezug auf eine Erkrankung ideal sein, aber nicht in Anbetracht eines Urlaubs mit starker Sonneneinstrahlung. „Notwendig” (= unumgänglich) könnte dann als Kriterium wiederum darauf hinweisen, dass genau dieses Mittel eingenommen, die Sonne jedoch gemieden werden sollte … – Auf „geeignete” Mittel kann auch zurückgegriffen werden, sofern „optimale” situativ nicht verfügbar sind.
Da ein guter Rastertest in jeder Praxis sozusagen Gold wert ist, gebe ich seinem Einsatz hier noch etwas mehr Raum, indem ich anhand des „klassischen“ (weil gerade in der Kinesiologie oft genutzten) Nahrungsmitteltests noch einmal die unterschiedliche Aussagekraft von Rastervorgaben deutlich machen möchte.
Am weitesten verbreitet ist der Verträglichkeitstest:
+ = verträglich
– = unverträglich
Diese Aufteilung ergibt beispielsweise Sinn bei Störungen des Magen-Darm-Traktes, bei nahrungsabhängiger Migräne, eventuell bei Neurodermitis oder generell auf irgendwelche Beschwerden oder Störungen bezogen (zu denen vor dem Testen ein Bezug formuliert werden sollte).
Interessanter kann sein, ob jemand allergisch reagiert, also:
+ = nicht allergisch
– = allergisch
Was hier scheinbar verdreht definiert ist (bei „nicht“ steht das +), ergibt insofern Sinn, als der schwache Muskel weiterhin anzeigt, was gemieden werden sollte bzw. was „schadet“.
Interessant ist die Unterscheidung der Allergie von der Unverträglichkeit deshalb, weil sehr häufig nach Sanierung der ihr zugrunde liegenden Störung (siehe Kapitel „Ursachenorientierter Heilungsansatz“) das Allergen problemlos vertragen wird.
Selbstverständlich können auch Diätpläne ausgetestet werden:
+ = zurzeit für den Heilungsprozess förderlich oder zumindest neutral
– = beeinträchtigt derzeit Heilungsprozess oder Befinden
Die hierbei erscheinenden Testergebnisse müssen nichts mit genereller Unverträglichkeit zu tun haben! Beispielsweise kann ein hoch fiebernder Grippepatient während der akuten Krankheitsphase vielleicht keine Milch vertragen (da sie Verschleimung begünstigt) oder kein Fleisch (das den Verdauungstrakt belastet), hingegen reichlich Obst – nach der Genesung aber verkraftet er problemlos sein Milchmüsli und den Schweinebraten.
Vielleicht hat ein Patient einmal den Wunsch, präventiv nach der für ihn gesunden Ernährung zu forschen, die per Muskeltest individualisiert und optimiert werden kann:
+ = gesundheitsfördernde Nahrungsmittel
– = Nahrungsmittel, die nicht der Gesundheit dienen
Oder man kann eine Spezialkost austesten, um Mangelerscheinungen zu beheben oder eine Stoffwechselstörung auszugleichen (Stichwort Säure-Basen-Haushalt). Ihrer Kreativität sind da kaum Grenzen gesetzt. Überlegen Sie also vorab konkret, was Sie für den Patienten wollen, fassen Sie es in die passenden Worte und setzen Sie diese sozusagen als Leuchtschrift über den gesamten nachfolgenden Testablauf!
Im Zusammenhang mit dem Rastertest insbesondere für Arzneien sollte der Umgang mit Testkästen nicht unerwähnt bleiben. Um dieses Kapitel nicht zu überfrachten, gehe ich darauf dort näher ein, wo es größere praktische Relevanz hat, nämlich im Kapitel über biochemische Krankheitsursachen.
Verbale Suchlisten
Wenngleich sich in den oben genannten Beispielen die Suchkriterien auf den Substanztest beziehen, ist der Rastertest keineswegs auf die Anwendung bei materiellen Objekten beschränkt. Wie schon im Eingangsteil angesprochen, lassen sich Listen mit Stichworten erstellen, die ebenfalls nach definierten Kriterien selektiert werden können. In der medizinischen Praxis gehört dazu vor allem die Wahl von Therapieverfahren. Diese könnten zwar auch per Dialogtest benannt werden – aber stellen Sie sich den Aufwand vor, wenn Sie alle infrage kommenden Behandlungsmöglichkeiten für Rückenschmerzen der Reihe nach in ganzen Sätzen auf ihre Eignung überprüfen müssten! Wie viel einfacher ist es da, nach der entsprechenden Vorgabe nur noch eine Methode nach der anderen mit einem einzigen Wort aufzurufen und die unmittelbare Muskelreaktion abzulesen.
Beispielhaft könnte eine solche Liste für die Behandlung von Rückenschmerzen so aussehen:
– Akupunktur
– Bäder
– Chiropraktik
– Elektrotherapie
– Fangopackung
– Kurzwelle
– Massage
– Neuraltherapie
– operativer Eingriff
– Osteopathie
– Physiotherapie
– Rückenschule
– Schmerzmittel
– Stufenlage …
Ihr Kenntnisspektrum in konventioneller und komplementärer Medizin...