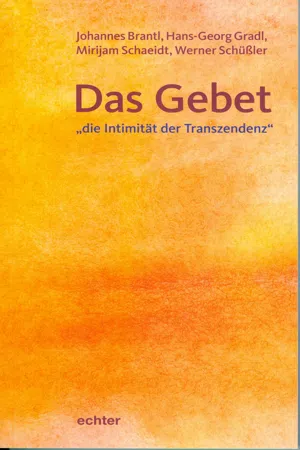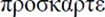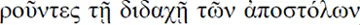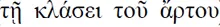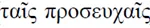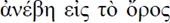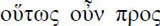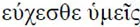![]()
HANS-GEORG GRADL
Modell und Maßstab
Das Vaterunser als Gebetsschule
1. Fragen und Beispiele: das Beten lernen
Ein Jünger ist ein Lernender. Das Substantiv (Jünger) wird ausschließlich in den Evangelien und in der Apostelgeschichte gebraucht und ist mit dem Verb (lernen) verwandt.111 Ein Jünger lernt in der Nachfolge seines Meisters. In den Fußspuren Jesu reift die Lebenspraxis des Jüngers. Zur Ausbildung eines Jüngers gehört auch die Unterweisung im Gebet. Auch Beten will gelernt sein. Das Gebet wächst an Vorbildern. Das Lukasevangelium fängt diese grundlegende Einsicht mit der Aufforderung der Jünger ein, die sie an Jesus richten: „Herr, lehre uns beten, wie schon Johannes seine Jünger beten gelehrt hat.“ (Lk 11,1) Der Satz ist im Imperativ formuliert und unterstreicht die Bedeutung dieser Bitte. Auch in Sachen Gebet ist der Jünger ein Lernender, der von der Größe seines Meisters zehrt.
Alle Evangelien erzählen von einem betenden Jesus. Unmittelbar vor die auffordernde Gebetsbitte der Jünger setzt das Lukasevangelium die Erinnerung an einen selbst im Gebet beheimateten Jesus. Als er sein Gebet beendet hatte, treten die Jünger mit ihrer Bitte an ihn heran (Lk 11,1). Immer wieder zieht er sich zum Gebet zurück (Mk 1,35; 6,46 par.; Lk 5,16; 9,18). Er betet im Angesicht von Krankheit und Leid (Mk 9,29). Im Gebet drückt er seinen Dank und seine Freude aus (Lk 10,21 par.). Er betet vor Entscheidungen. Aus dem Gebet resultiert die Auswahl der Zwölf (Lk 6,12-13). Vor seiner Gefangennahme ringt er mit Gott im Gebet (Mk 14,32-39 par.). Er spricht die ersten Worte des Sterbegebets eines frommen Juden im Angesicht des eigenen Todes (Mk 15,34 par.). Er unterweist seine Jünger im Gebet (Mk 11,25; Mt 6,5-8) und fordert sie zum inständigen Beten auf (Lk 18,1). Die Gebetspassagen in den neutestamentlichen Evangelien halten die Erinnerung an einen betenden Jesus wach. Sie sind als Aufforderung zu verstehen, auch hier dem Meister nachzufolgen. Ein Jünger ist ein Lernender und als solcher einer, der das Beten lernen muss.
Wie geht beten? So selbstverständlich das Gebet zur Jüngerschaft und zum urchristlichen Gemeindeleben hinzugehört, so schwierig scheint es zu sein. Unmittelbar im Anschluss an das Pfingstereignis schildert die Apostelgeschichte – mit satten Pinselstrichen und in einer so generellen wie überzeitlichen Bestandsaufnahme – Grundvollzüge der Urgemeinde in Jerusalem. Zusammen mit dem Festhalten an der Lehre der Apostel (), der Gemeinschaft ( ) und dem Brotbrechen () wird das Gebet () als eine tragende Säule christlichen Lebens genannt (Apg 2,42). Die Jünger beten: vor der Nachwahl des Matthias (Apg 1,24-25), in scheinbar aussichtslosen Situationen (Apg 16,25; 28,8), allein (Apg 10,9) und in Gemeinschaft (Apg 1,14; 12,5.12). Den Adressaten des lukanischen Doppelwerks aber dürfte dies mehr als Mahnung, denn als bloße historische Erinnerung zugedacht sein. Wie kein anderes Evangelium akzentuiert gerade Lukas die Thematik Gebet und schärft die Praxis anhand einzelner Gleichnisse (Lk 18,1-14), grundlegender Vergleiche (Lk 11,5-13) und durch das Gedächtnisgemälde der Urgemeinde (Apg 2,42) nachdrücklich ein. Die Adressaten sehen einen „vorbildlich betende(n) Herr(n) in einer betenden Kirche“112. Wie geht beten? Zur Beantwortung dieser Frage weist das lukanische Doppelwerk auf betende Beispiele und Vorbilder hin, die in der lesenden Auseinandersetzung intensiv beobachtet werden sollen. Wie zu Übungszwecken werden dem Leser große Gebetstexte regelrecht in den Mund gelegt und zum Nachbeten anempfohlen. So fasst die Kindheitserzählung das Geschehen in großen hymnischen Gebetstexten zusammen. Das Magnificat (Lk 1,46-55), das Benedictus (Lk 1,68-79), das Nunc Dimittis (Lk 2,29-32) und der Lobgesang der Engel (Lk 2,14) sind Einheiten sui generis. In der Wirkungsgeschichte wurden sie stets als Gebetsvorlagen verstanden und vom Stundengebet und von der Liturgie der Kirche als Einladung zur betenden Wiederholung aufgegriffen. Beten braucht aber auch die Reflexion und ein gutes theologisches Fundament. In der Art und Praxis des Betens spiegeln sich das Gottesbild und das Selbstverständnis des Beters. Der Beter darf von einer stets offenen Tür (vgl. Lk 11,5-10) ausgehen und muss sich das Recht zur Bitte nicht erst durch den Beweis der eigenen Gerechtigkeit erwerben. Beten ist Vertrauenssache und umfasst auch das Eingeständnis der eigenen Schuld und Schwäche (vgl. Lk 18,9-14). Ein Lehrstück des Betens ist das Vaterunser ebenso im Kontext des Matthäusevangeliums. Dort wird es in die Mitte der Bergpredigt gerückt und als Herzstück der ersten programmatischen Rede Jesu am Beginn seines öffentlichen Wirkens überliefert. Schon die Lokalisierung auf einem Berg (Mt 5,1: ) unterlegt die Rede mit einer hoheitsvollen Atmosphäre. „Der Berg mit bestimmtem Artikel, aber ohne Namen, verweist auf den Gottesberg, den Begegnungspunkt der Gotteswelt mit der irdischen Welt der Menschen. Es handelt sich also um keinen geographischen Begriff, sondern um einen theologischen.“113 In dieser ersten Rede lehrt Jesus vollmächtig die Gerechtigkeit des Himmelsreichs, die nicht als Ende des Gesetzes, sondern als dessen Erfüllung verstanden wird (Mt 5,17). Es sind nicht die Jünger, die an Jesus herantreten und ihn um eine Unterweisung im Beten ersuchen (vgl. Lk 11,1). Die Jünger sind – mit dem gesamten Volk – eigens adressierte Zuhörer (vgl. Mt 5,1), denen Jesus hoheitsvoll ein neues Selbstverständnis und Gottesbild vermittelt und aus freien Stücken das Beten lehrt. Wie geht beten? Vor den eigentlichen Gebetstext setzt das Matthäusevangelium zwei negative Beispiele (Mt 6,5.7) und zwei positive Handlungsanweisungen (Mt 6,6a.8a), die zwei – das Gebet betreffende – theologische Grundsätze (Mt 6,6b.8b) veranschaulichen. An die Stelle einer heuchlerischen Zurschaustellung der eigenen Gebetspraxis tritt ein Beten im Verborgenen, das nicht die Öffentlichkeit der Menschen, sondern die Vertrautheit mit Gott sucht. In der Kammer, bei verschlossener Tür wendet sich der Beter an seinen Vater, der das Verborgene sieht (vgl. Mt 6,6). Das Wissen um einen Gott, der schon vor jedem Gebetswort alles weiß, hinterfragt und karikiert die Ansicht, dass man Gott durch einen regelrechten Wortschwall die Bitten verdeutlichen müsse oder zur Erhörung zwingen könne. Gott weiß um die Bedürfnisse des Beters, noch ehe Bitten formuliert und ausgesprochen werden (Mt 6,8). Während die Jünger im Lukasevangelium Jesus zur Gebetsunterweisung auffordern (Lk 11,1), lehrt Jesu die Jünger nun selbst im Imperativ ein Gebet, das die richtige Gebetstheorie und -praxis illustriert: „So sollt ihr beten“ (Mt 6,9: )! Was beide Kontexte miteinander verbindet, ist der essentielle Modellcharakter dieses Gebets. Es verdeutlicht nicht nur die Haltung des Beters, sondern auch markante Gesichtszüge des im Gebet angeredeten Gottes. Es zeigt in seinem Rhythmus und der Anordnung der Bitten etwas von den grundsätzlichen Wertigkeiten, die sich der Beter in seinem Gebet zu Eigen macht. In der Wahl der Worte und im Inhalt der Gebetswünsche spiegeln sich das vorausgesetzte Verhältnis von Gott und Menschen und das Zueinander der einzelnen Beter. Im einen wie im anderen Fall ist das Vaterunser Modell und Maßstab des Gebets, eine Inspirationsquelle und Gebetsschule. Das Vaterunser verstehen, heißt darum immer auch, die eigene Gebetspraxis reflektieren und vom Gottesbild und Selbstverständnis des Beters Jesus lernen.
2. Text und Tradition: die Überlieferung der Worte Jesu
„Das Vaterunser stammt von Jesus.“114 Im Rahmen der mündlichen und liturgischen Überlieferung wurde das Herrengebet weitergegeben, in den erzählerischen Rahmen des Lukas- und des Matthäusevangeliums redaktionell eingebettet und stilistisch wie inhaltlich bearbeitet. Das Vaterunser im Lukasevangelium umfasst zwei Bitten weniger als im Matthäusevangelium. Auch wenn viel für die Ursprünglichkeit der kürzeren Gebetsform spricht,115 so ist die Variante im Matthäusevangelium nicht minder wahr. Vielmehr ergänzt die Matthäustradition auf Basis und unter Beobachtung wesentlicher Verkündigungsthemen Jesu die Bitte um die Verwirklichung des göttlichen Willens (Mt 6,10) und um die Befreiung vom Bösen (Mt 6,13). Beide Themen werden im weiteren Verlauf der Schrift aufgegriffen und entfaltet. Gegen Ende der Bergpredigt wird der gesamte Inhalt dieser ersten Rede als Offenbarung des Willens Gottes verstanden und mit dem Handeln der Christen verbunden. Der Wille Gottes ist Maßstab und Richtschnur für das eigene Verhalten (vgl. Mt 7,21; 18,14; 21,31). Die Befreiung vom Bösen wird in den zahlreichen Krankenheilungen und Exorzismen Jesu schon Wirklichkeit (vgl. Mt 10,7-8; 12,28). Sie sind Zeichen der hereinbrechenden Gottesherrschaft, die auch die Menschen zu einem Durchbrechen der Spirale des Bösen im eigenen Verhalten bewegt (vgl. Mt 5,38-48). Durch die Aufnahme ins Gebet betont und adelt das Matthäusevangelium die Zentralität des göttlichen Willens und die zukunftsweisende Bitte um die umfassende Befreiung vom Bösen. Auch wenn die längere Version so nicht direkt auf den historischen Jesus zurückgehen mag, sie greift doch zentrale Themen seiner Verkündigung auf.
Neben der Einfügung zweier Bitten ins Herrengebet machen die sprachlichen U...