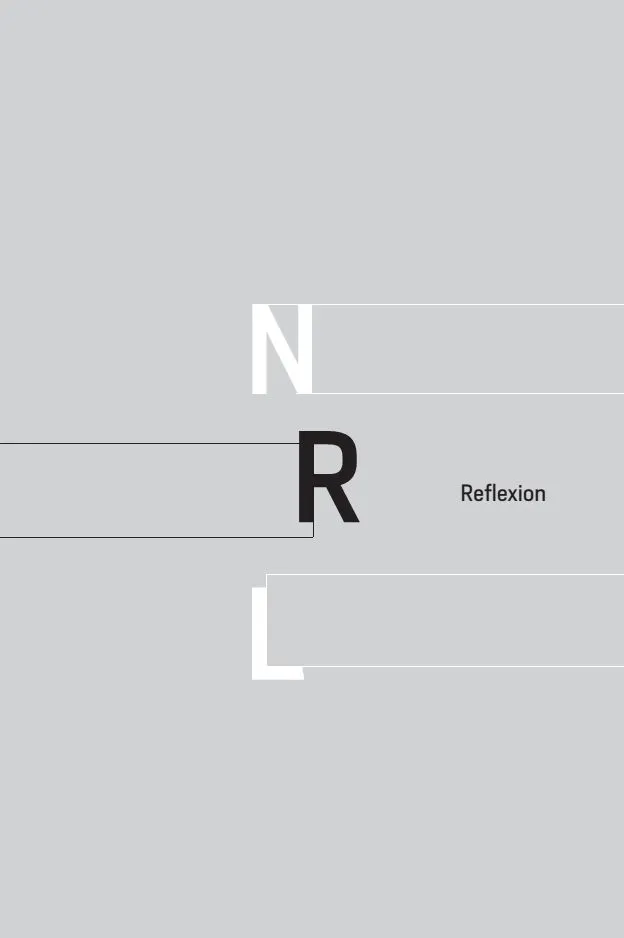![]()
![]()
Veronika Hoffmann | Siegen
geb. 1974, Dr. habil. theol., Professorin für Systematische
Theologie an der Universität Siegen
Anders glauben
Über veränderte Bedingungen des Glaubens1
„Glauben Sie an Gott?“ Wenn Meinungsforscher diese Frage stellen, scheint das Ergebnis zumindest für Westeuropa vorhersehbar: Immer weniger Menschen glauben heute an Gott – die angebliche „Wiederkehr der Religion“ hat daran bislang nichts geändert. Die Entwicklung der letzten Jahrzehnte scheint eine klare Sprache zu sprechen: Es gibt Menschen, die noch sind, wie die Menschen früher, sie glauben an Gott. Und es gibt mehr und mehr Menschen, die nicht mehr so sind, sie glauben nicht an Gott. In kirchlichen Kreisen führt das nicht selten zu dem enttäuschten Gefühl: Früher waren die großen Mehrheiten bei uns, jetzt werden wir zur Minderheit. Daraus kann man depressiv folgern: Wir machen etwas falsch, weil die Menschen nicht mehr zu uns kommen. Alternativ findet sich auch die aggressive Folgerung: Die heutige Gesellschaft ist schlecht, weil sie den Wert des Glaubens nicht mehr erkennt.
Meine Behauptung ist, dass dieser Früher-Heute-Vergleich nur bedingt funktioniert, weil „glauben“ „heute“ und „früher“ nicht dasselbe bedeutet. Wer heute glaubt, glaubt anders als die Jünger zur Zeit Jesu oder eine Bäuerin im Europa des 14. Jhs. Die Bedingungen haben sich für alle verändert, und diese Veränderungen liegen gewissermaßen noch vor der Frage „Glauben Sie an Gott?“ und werden von ihr deshalb nicht erfasst. Wenn ich von veränderten Bedingungen spreche, muss ich nicht nur erklären: verändert in welcher Weise?, sondern auch: verändert im Vergleich zu wann? Ich möchte das unter den Stichworten „Säkularität“ und „Authentizität“ tun, wobei ich auf Überlegungen des kanadischen Philosophen Charles Taylor zurückgreife.2 Im letzten Teil des Textes werde ich über einige mögliche Konsequenzen nachdenken.
Beobachtung 1: „Säkularität“
„Säkularität“ ist ein notorisch unklarer Begriff. Häufig wird unter einer „säkularen Gesellschaft“ eine solche verstanden, in der religiöser Glaube im Rückgang begriffen ist. Man kann „Säkularität“ zweitens in dem Sinn verwenden, in dem Deutschland ein „säkularer Staat“ ist. Das heißt: Wir glauben beispielsweise nicht, dass unsere Bundeskanzlerin von Gott eingesetzt ist, sondern sie ist gewählt. Und es gibt Religionsunterricht, aber man muss nicht teilnehmen, man kann sich auch abmelden. Diese zweite Bedeutung hat mit der erstgenannten Bedeutung von Säkularität nicht unbedingt etwas zu tun: Ein in diesem Sinne säkularer Staat kann problemlos hochreligiöse Bürger haben.
Bei Taylor begegnet noch ein weiterer Begriff von „Säkularität“. Hier ist „säkular“ nicht der Gegenbegriff zu „religiös“, sondern er bezeichnet den gemeinsamen Rahmen, in dem sich heute alle Weltanschauungen bewegen, d.h. die eingangs genannten veränderten Bedingungen des Glaubens. Taylor interessiert sich in seinem Werk Ein säkulares Zeitalter nicht für den numerischen Rückgang der Zahl der Glaubenden, sondern für den Wandel von einer Gesellschaft, in der es so gut wie unmöglich war, nicht in der einen oder anderen Weise an Gott zu glauben, zu einer, in der dieser Glaube eine Möglichkeit unter anderen ist.3
Wenn wir eine Zeitreise in die Zeit Jesu machen und die Bewohner des Mittelmeerraumes fragen könnten: „Glauben Sie an Gott?“, dann würde sich vermutlich niemand finden, der „nein“ sagt. Der Glaube an einen Gott oder mehrere Götter war selbstverständlich, ebenso wie es Mächte gab, die das Leben beeinflussten: Gestirne, Dämonen, Engel … Wenn Jesus „Glauben“ fordert, will er nicht Atheisten bekehren. Es geht ihm darum, sich wirklich mit dem ganzen Leben auf Gott einzulassen, nicht um mögliche Zweifel an dessen Existenz. Das gilt nicht nur für die Zeit Jesu, es gilt über weite Strecken der europäischen Religionsgeschichte: Man kann auf alle möglichen Weisen glauben, Magie praktizieren, sich um Gott nicht kümmern, die Gebote nicht halten – aber es gibt keine rein „immanente“ Deutung der Welt, keine Deutung, die die Welt als in sich geschlossen denkt, in der kein Gott, keine übernatürlichen Mächte, keine Geister oder Engel wirken.
Bis etwa ins 16. Jh. ist Glaube an Gott in diesem Sinn ein selbstverständlicher, unhinterfragter Rahmen, in dem sich alle Deutungen der Welt bewegen. Die Ordnung der Natur stammt von Gott ebenso wie diejenige der Gesellschaft und der Familie. Politik und Religion sind gerade nicht getrennt wie im modernen säkularen Staat.4 Dementsprechend wirkt Gott auch in militärischen Siegen und Niederlagen. Und er wirkt im Leben des einzelnen unmittelbar, er schickt Krankheiten, um zu strafen, er ist verantwortlich für das Wetter, das eine gute oder schlechte Ernte beschert. Engel stehen den Menschen hilfreich zur Seite, während man sich der Dämonen erwehren muss. Alles, was man tut, hat Folgen für das jenseitige, das „eigentliche“ Leben. Die Heiligen sind in ihren Reliquien anwesend und schützen „ihre“ Kirchen.5
Die Entstehung des „immanenten Rahmens“
Wie kommt es zur Veränderung dieses „selbstverständlichen Rahmens“? Hier wäre eigentlich ein großer kultur- und geistesgeschichtlicher Bogen zu schlagen. Es wäre über Konfessionskriege und die Aufklärung, neue politische Theorien, die aufkommende Geschichtswissenschaft und die ebenso aufkommenden Naturwissenschaften zu sprechen. Ich kann hier nur beispielhaft einen einzelnen Baustein der Entwicklung herausgreifen: Auf der biblisch-christlichen Linie hatte man immer wieder darum zu kämpfen, dass die Gottheit Gottes gewahrt bleibt. Gott mag sich der Welt zuwenden, in ihr antreffbar sein, sie erschaffen und erhalten. Aber er ist nicht einfach ein Teil der Welt. Man kann diesen Gott nicht dingfest machen, seine Anwesenheit nicht erzwingen, ihn nicht bestechen, damit er tut, was man sich wünscht. Schon das alttestamentliche Bilderverbot (Ex 20,4; Dtn 5,8) unterstreicht Gottes Andersheit und Unverfügbarkeit. Dieser Kampf um die Gottheit Gottes war und ist immer wieder zu führen.
Folgt man Taylor, hatte das historisch gesehen allerdings unbeabsichtigte Folgen. Sehr vereinfacht gesagt:6 Im Kampf gegen eine Vermischung von Gott und Welt kam es zu einer immer schärferen Trennung von Gott und Welt. Der Gott im Himmel rückte immer weiter weg und die Erde gehörte allein den Menschen. Gott hatte vielleicht noch die Welt erschaffen und ihr eine Ordnung gegeben, aber er griff in diese Ordnung nicht mehr ein. Er kümmerte sich auch nicht mehr persönlich um jeden einzelnen. Ebenso wurde die gesellschaftliche Ordnung zu einer Sache nicht „von Gottes Gnaden“, sondern der menschlichen Übereinkunft. Aber was unterscheidet schließlich einen Gott, der weit weg ist und so göttlich, dass er sich an der Erde die Hände nicht schmutzig macht, von einem Gott, den es nicht gibt? Die Grenze zwischen der Welt und dem Bereich Gottes wurde nach und nach undurchdringlich, und zum ersten Mal konnte man eine Welt denken, die ganz ohne Transzendenz auskommt, ohne „übernatürliche Mächte“.
Das ist, wie gesagt, nur eine der Linien, die Taylor auszieht, um die große Veränderung hin zu einem „säkularen Zeitalter“ deutlich zu machen. Und Geschichte verläuft auch nicht einfach geradlinig. Aber alles in allem führte das dazu, dass der selbstverständliche Rahmen heute ein immanenter ist. Man kann weiterhin davon ausgehen, dass die Welt gewissermaßen „nach oben offen“ ist, dass es einen Gott gibt, der sie gewollt hat und auf sie schaut. Aber man muss es nicht mehr. Man kann die Welt auch ganz und gar aus sich selbst erklären. Das heißt: Es entsteht zum ersten Mal nicht nur für einige wenige Philosophen, sondern für die breite Masse der Menschen die Möglichkeit einer atheistischen Weltsicht. Und damit wird der Glaube seinerseits von einer Selbstverständlichkeit zu einer Möglichkeit: einer Möglichkeit unter anderen, die Welt zu verstehen. Andere Menschen, die sich weder als verblendet noch als böse disqualifizieren lassen, leben aus anderen Überzeugungen.
Es geht also nicht einfach darum festzustellen, dass es Atheismus in nennenswertem Umfang erst seit der Neuzeit gibt. Sondern es geht um die Veränderung, die sich für alle ergibt, wenn jede Weise, die Welt zu verstehen, erkennbar eine Deutung ist. Glaube ist Deutung – und anderer Glaube oder Nichtglaube ist es auch. Was folgt daraus? Um diese Frage beantworten zu können, lohnt es sich, an einigen Stellen noch etwas genauer hinzusehen.
1. Muss man sich heute im Unterschied zu früher für den Glauben entscheiden? Sicherlich spielt die eigene Entscheidung heute eine größere Rolle. Aber Glaube als konkret gelebter, der die ganze Person prägt, als Nachfolge Christi, war schon immer auch eine Sache persönlicher Entscheidung. Umgekehrt muss ich mich heute so wenig wie früher entscheiden. Es gibt Entscheidungen, um die ich kaum herumkomme, z.B. was ich demnächst esse. Aber in Sachen Religion kann ich es auch auf sich beruhen lassen und mich nicht darum kümmern.
2. Die Rede vom Glauben als einer Möglichkeit unter anderen meint nicht, dass man nach Lust und Laune wählt, ob und was man glauben will. Niemand kann einfach beschließen zu glauben. Glaube entsteht aus Erfahrungen, Zeugnissen, Gesprächen, Argumenten, Praktiken … Dabei kommt auch ein Element der Wahl ins Spiel. Aber speisen sich nicht auch bewusste Glaubensentscheidungen aus tieferen Quellen, die gar nicht alle willentlich zugänglich sind? Das kann kaum anders sein, denn es geht dabei um die ganze Person, um eine Identität, die ich nicht einfach machen und mir zurechtlegen kann.7
3. Nicht selten wird aus der heute unhintergehbaren Pluralität möglicher Überzeugungen gefolgert, dass sich mit dem „selbstverständlichen Rahmen“ des Glaubens auch die Möglichkeit von Glaubensgewissheit definitiv aufgelöst hat. So geht z.B. der Religionssoziologe Peter L. Berger davon aus, dass man sich unter den skizzierten Bedingungen seines Glaubens nicht mehr fraglos gewiss sein kann – außer man verbarrikadiert sich fundamentalistisch und erklärt, dass eben doch alle dumm oder böse sind, die etwas anderes glauben.8 Hier kommt es jedoch darauf an, was man unter „Glaubensgewissheit“ versteht. Sie hat, wenn sie sich auf die Gegebenheiten einlässt, sicherlich heute eine andere Gestalt als früher, aber sie scheint mir nicht von vornherein unmöglich zu sein. Das gilt auf der Ebene der Überzeugungen: Wir können uns in Werten und anderen Grundüberzeugungen durchaus gewiss sein, auch wenn wir wissen, dass es andere Überzeugungen gibt und wie man zu ihnen kommen kann. Wäre ich in Saudi-Arabien geboren, fände ich es vielleicht richtig, wenn Frauen nicht Auto fahren. Insofern ist meine Überzeugung, dass Frauen das Autofahren erlaubt sein sollte, kontingent. Wären die Umstände anders, wäre meine Überzeugung vielleicht auch anders. Dennoch bin ich der Meinung, dass sie kein reiner Zufall ist, nur weil ich in Deutschland aufgewachsen bin. Und ich bin mir meiner Position auch durchaus sicher. Schon auf der Ebene der Überzeugung kann ich mir also sicher sein, a...