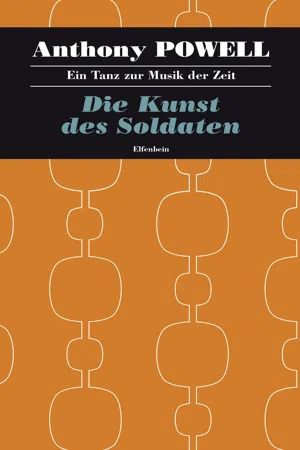![]()
1
Ich erstand meinen großen Militärmantel gleich zu Anfang dieser ganzen Sache, und zwar in einem der Läden in der Nachbarschaft der Shaftesbury Avenue, wo sie neben Offiziersausstattungen und Sportartikeln auch Theaterkostüme verleihen oder verkaufen. Die Atmosphäre im Inneren, bedrohlich wie in einem orientalischen Basar, suggerierte heimliche Geschäfte, verstohlenen, wenn vielleicht auch nicht ungesetzlichen Handel, und sie erhöhte noch meine Anspannung bei diesem für mich neuen Unterfangen. Der Verkauf fand im oberen Stockwerk statt, in einem dunklen, mysteriösen, mit Skiausrüstungen und Reithosen drapierten Raum, in dessen hinterem Bereich zwei kopflose Puppen in steifer Habachtstellung hinter den Glasscheiben einer hohen Vitrine ausgestellt waren. Eine dieser Figuren trug das mit glitzernden diagonalen Streifen besetzte Trikot eines Harlekins; die andere die scharlachrote Galauniform eines Infanterieregiments – allegorische Gestalten, so schien es mir, die den Dualismus des sie umgebenden antithetischen Warensortiments repräsentierten: das Zivile und das Militärische, Arbeit und Spiel, Distanziertheit und Involviertheit, Tragödie und Komödie, Krieg und Frieden, Leben und Tod.
Der Verkäufer, gebeugt, schon älter, mit Bart und dem der Atmosphäre angemessenen Gebaren eines levantinischen Händlers, holte den Mantel aus einem verborgenen, im Halbdunkel liegenden Winkel und half mir ehrerbietig in dieses doppelreihige, mit Messingknöpfen besetzte, steif-faltige, khakifarbene Kleidungsstück. Er knöpfte es mit schnellen, knochigen Fingern zu und schlug die Aufschläge bis zum Hals hoch; dann trat er zwei Schritte zurück, um die Wirkung zu prüfen. In dem dreiseitigen großen Spiegel in meiner Nähe überprüfte auch ich die Rückenansicht des bis zu den Waden hinunterreichenden Mantels und wurde mir dabei bewusst, dass ich, sozusagen kraft dieser militärischen Kostümierung, bald wie Alice durch den Spiegel in eine Welt schweben würde, die nicht weniger rätselhaft war als die jenes Mädchens.
»Wie gefällt er Ihnen, Sir?«
»Gut, denke ich.«
»Wie für Sie gemacht.«
»Er passt sehr gut.«
Er löste jetzt langsam, einen nach dem anderen, die Knöpfe. Dabei starrte er schweigend vor sich hin, so als ob er über etwas nachdenke.
»Ich glaube, ich kenne Ihr Gesicht«, sagte er.
»Wirklich?«
»War es ›Die mittlere Wache‹?«
»War was die mittlere Wache?«
»Die Theateraufführung, in der ich Sie gesehen habe.«
Ich habe absolut kein schauspielerisches Talent, überhaupt keins – ein grundlegendes Handicap bei fast allem, was man im Leben unternimmt; aber andererseits besitzen schließlich auch viele Schauspieler herzlich wenig davon. Es bestand kein Grund dafür, dass er nicht annehmen sollte, die Bühne könne genauso gut mein Beruf sein wie jeder andere auch. Doch mit etwas identifiziert zu werden, das vielleicht eine Spur profunder war als eine altmodische Farce, die das lärmend-fröhliche Leben in der Waffenkammer eines Schiffes der Royal Navy zum Gegenstand hat, wäre möglicherweise meinem Selbstwertgefühl zuträglicher gewesen; ich hielt aber eine nähere Beschreibung meiner persönlichen Umstände bei dieser Gelegenheit für zu mühsam und auch für fehl am Platz. Ich nahm deshalb seine Einschätzung, so ernüchternd sie auch war, ohne Widerspruch hin und beschränkte mich lediglich darauf zu verneinen, dass ich in diesem besonderen Klamaukstück mitgespielt hätte. Er half mir aus dem Mantel und schüttelte mit ernster Miene die Falten glatt.
»Und wofür wird dieser gebraucht?«
»Welcher?«
»Der Mantel – wenn ich mir die Frage erlauben dürfte?«
»Nur für den Krieg.«
»Oh«, sagte er begierig, ›Der Krieg‹ …«
Es war offensichtlich, dass ihn die jüngsten politischen Ereignisse völlig unberührt gelassen hatten; dass er ein Alter erreicht hatte, in dem er vielleicht desillusioniert war von den Gemeinplätzen des Lebens – ein zu eifriger Theaterbesucher, um noch für irgendetwas anderes außer den Schauspielkritiken in der Presse, so mittelmäßig sie auch geschrieben sein mochten, Zeit erübrigen zu können und um den Zeitungsberichten über die internationalen Krisen zu erlauben, die Lebhaftigkeit seiner ästhetischen Betrachtungen zu umwölken. Das war eine verständliche Einstellung.
»Ich werde mir die Aufführung merken«, sagte er.
»Tun Sie das bitte.«
»Und Ihre Adresse?«
»Ich nehme ihn gleich mit.«
Die Zeit war knapp. Jetzt, wo der Vorhang aufgegangen war zu dem alten Lieblingsstück – »Der Krieg« –, in dem mir, wie es schien, eine Statistenrolle zugedacht war, würden die Tage, die mir noch verblieben waren, bevor ich mich meiner Einheit anzuschließen hatte, für die Kostümprobe genutzt werden müssen. Ich durfte die Stichworte nicht verpassen. Je mehr ich darüber nachdachte, desto angemessener erschien mir die Metapher. Außerdem, die Kleidung macht den Mann aus – wenn nicht den ganzen, so doch einen großen Teil von ihm, besonders wenn es sich um die Uniform handelt. Nach ein paar Minuten hielt ich das Paket, ein ziemlich sperriges, in Händen.
»Ich hab versucht, ihn handlich zu verpacken«, sagte er. »Aber ich vermute, das Theater ist gleich in der Nähe.«
»Das Theater des Krieges?«
Er sah mich eine Sekunde lang verwirrt an, dann, meine Bemerkung für ein dunkles Bonmot aus der Welt des Theaters haltend, nickte er anerkennend.
»Ich wünsche Ihnen eine lange Laufzeit«, sagte er und schlug seine alten, mageren Hände wie zum Applaus zusammen.
»Danke.«
»Einen guten Tag, Sir, ich habe zu danken.«
Ich verließ den Laden, erlaubte mir aber noch einen letzten Blick auf die beiden prächtig gekleideten Puppen, die von ihrem Glasgefängnis aus die düster-beklemmende Welt der mit Tweed und Whipcord behangenen Kleiderbügel überblickten. Wenn ich es recht bedachte, waren diese kopflosen Figuren vielleicht gar nicht antithetisch, sondern repräsentierten vielmehr »Ehre und Witz, in der Hölle sie sitz’«, auf die sich der Teufel in Kiplings Gedicht bezieht. Sie saßen hier zwar nicht, sondern standen, aber die genaue Körperhaltung war nur Nebensache. Der eigentliche Punkt war, dass sie genau die richtige Kleidung trugen, während ihre Kopflosigkeit – ähnlich der Augenbinde der Liebe und der Justitia – sehr wohl auf die unerbittliche Vorbestimmtheit ihres gemeinsamen Schicksals hinweisen mochte, eines Schicksals, das selbst der Krieg nicht ändern konnte. Ja, der Krieg, der diesen beiden Attributen, »Ehre und Witz«, wahrscheinlich ein unbegrenztes Feld der Verwirklichung bot, würde ihre letztliche Fatalität eher noch intensivieren als mildern. Während ich in dem blassen, wie unwillig gewährten Sonnenschein des Londoner Dezembers, einem fahlen, doch so vertrauten Licht, über diese Vermutung nachgrübelte, erkannte ich die Weinhandlung wieder, die mir wegen der Flasche Portwein – wenn denn jene Flüssigkeit so bezeichnet werden konnte –, die Moreland und ich Jahrhunderte zuvor an jenem Sonntagnachmittag mit so großen Hoffnungen gekauft hatten, die aber zu trinken wir dann später gänzlich unmöglich fanden, ewig im Gedächtnis bleiben wird.
Wenn ich jetzt von einer beunruhigenden, doch gleichzeitig auch monotonen Gegenwart aus zurückblickte, erschienen mir diese Tage mit Moreland als eindeutig arkadisch. Auch das drohende Arbitrium zum Kriege hin (so der ziemlich geschraubte Ausdruck von Premierminister Chamberlain in seiner Radioansprache) hatte den Wochen, die mit dem Kauf des Militärmantels endeten, eine gewisse makabre Erregtheit verliehen. Jetzt, etwa vierzehn Monate später, schien jener Tag kaum weniger weit zurückzuliegen als die Opferung der Flasche Portwein. Das Letzte, das ich von Moreland (in einem von Isobels Briefen) gehört hatte, war, dass eine musikalische Verpflichtung ihn nach Edinburgh gebracht habe. Aber auch diese Information war mir schon vor langer Zeit geschickt worden, kurz nach meiner eigenen Ankunft bei der Division. Seit damals tat ich nun schon eine Million Jahre lang Dienst in diesem Hauptquartier, besaß ich kein Eigenleben außerhalb der Armee, hatte ich keinen Meister außer Widmerpool und keine Tischgenossen außer Biggs und Soper.
In der Zwischenzeit hatte der Krieg selbst verschiedene Phasen durchlaufen, einige davon äußerst unbehagliche: Frankreich war besiegt, Europa überrannt, eine Invasion Englands stand drohend bevor, der Luftkrieg über London war eröffnet. Im Zusammenhang mit dem letzteren Aspekt berichtete Isobel auch von dem spezielleren Ereignis eines Volltreffers auf Barnbys Fresken im Donners-Brebner-Gebäude. Meine Erinnerungen an diese Bilder waren jetzt genauso verschwommen wie die an Barnby selbst, der gegenwärtig als Tarnungsoffizier bei einer entfernt stationierten Einheit der Royal Air Force Dienst tat. In der letzten Zeit gingen die Dinge zwar ein wenig aufwärts – in der westlichen Sahara zum Beispiel –, aber die allgemeine Situation bot noch beträchtlichen Raum für Verbesserungen, ehe man sie auch nur im geringsten Maße als zufriedenstellend betrachten konnte. Di...