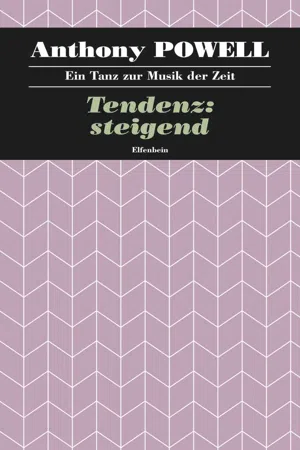1
Das letzte Mal, dass ich einige von Mr. Deacons Arbeiten sah, war auf einer Auktion, die aus unerfindlichen Gründen in der Nachbarschaft der Euston Road stattfand, viele Jahre nach seinem Tod. Keines der Bilder war mir vertraut, aber sie riefen, neben vielen anderen Dingen, besonders das Abendessen bei den Walpole-Wilsons in mein Gedächtnis zurück und belebten schlagartig die Erinnerung an jene Phase meiner Jugend. Sie weckten Gedanken an lang vergessene Konflikte und Kompromisse zwischen der Vorstellung und dem Willen, der Vernunft und dem Gefühl, der Macht und der Sinnlichkeit; aber auch an viele ganz persönliche Empfindungen der Freude und des Schmerzes, die ich in der Vergangenheit durchlebt hatte. Das Frühlingswetter draußen war kühl und sonnig: Mr. Deacons bevorzugte Jahreszeit. Die Ölgemälde im Innern, gegen drei Seiten eines Waschtisches gelehnt, schienen irgendwie in diese staubige, aber nicht unangenehme Umgebung zu passen, die auf ihre Weise auch an die Art von Wohnung erinnerte, die Mr. Deacon für sich selbst und seine Habe bevorzugte: an das Wohnzimmer über dem Geschäft zum Beispiel, formlos, nicht zu dauerhaft, ziemlich heruntergekommen. Seine Lieblingslokale, so erinnerte ich mich, lagen in diesen nördlichen Grenzbereichen Londons.
Ansammlungen beziehungsloser Objekte, die für eine Auktion zusammengetragen worden sind, nehmen, in der wahllosen Art ihrer Anhäufung, eine gewisse eigene Würde an: Gegenstände, die in einer bewohnten Behausung nicht zu ertragen sind, finden alle ihren eigenen Platz in diesen weitläufigen, anonymen Höhlen, wo diese Belanglosigkeiten, ohne Anspruch auf individuellen Wert zu erheben, still miteinander und mit der allgemeinen Nüchternheit des Hintergrundes harmonieren. Solche Lokalitäten haben etwas von Museen an sich, und die umherziehende Menge begutachtet gewöhnlich die angesammelten Überreste mit sachkundiger, unbefangener Intensität, die keineswegs nur auf kommerziellen Gewinn oder Erwerb ausgerichtet ist.
Hier in diesen Räumlichkeiten schien fast jedes von Menschen gemachte Ding vertreten zu sein: verhältnismäßig neue Rasenmäher; scheidenlose und rostige Kavalleriesäbel; Bruchstücke eines afrikanischen Fetischs aus Ebenholz; eine Schreibmaschine aus dem neunzehnten Jahrhundert, auf langen Metallfüßen unsicher platziert inmitten eines Teeservice aus Liverpooler Steingut, dessen schwarzweißes Landschaftsdessin irreparabel beschädigt war. Mehrere mit der englischen Flagge bezogene Kissen und Kopfpolster legten den bestürzenden Schluss nahe, dass irgendwo tief unter ihnen ein Leichnam auf sein Begräbnis mit militärischen Ehren wartete. Weiter hinten waren hohe Rollen blauen, grünen und rosafarbenen Linoleums wie Säulen gegen die Wand gestellt, eine minoische Kolonnade, von der aus Korbsessel und stark abgenutzte Gepäckstücke einen Halbkreis bildeten. In der Mitte dieses offenen Raumes stand, fast wie ein für den Gottesdienst dort aufgestellter Altar, der Waschtisch, um den die Bilder gruppiert waren. Auf seiner Marmorplatte hatten ein leerer Vogelkäfig, zwei vermutlich deutsche Zinnsoldaten und ein Stapel stark zerlesener Walzer-Noten ihren Platz gefunden. Vor einem Streifen eines maschinengewebten noppigen Teppichs, der wie ein verblichener Wandbehang an der Seite eines Kleiderschranks aus Kiefernholz herabhing, stand, mit dem Kopf nach unten, ein viertes Gemälde.
Alle vier Bilder gehörten zu der gleichen Schule großer, unordentlich angelegter Kompositionen ausschließlich männlicher Figuren, hell im Ton und mythologisch in der Thematik: dem Einfluss, nicht aber genau auch dem Geist nach präraffaelitisch – ein Kompromiss zwischen, etwa, Burne-Jones und Alma-Tameda, mit vielleicht einer Spur von Watts in der Methode des Farbauftrags. Eines von ihnen, das sich oben aus dem Keilrahmen gelöst hatte, datierte von 1903. Eine offenkundige Schwäche im Zeichnen wurde noch betont durch die absolute Gewissheit – die allerdings auch einige der größten Maler einholt –, dass keines von Mr. Deacons Bildern in einer anderen als seiner eigenen Epoche hätte gemalt werden können. Dieses Kennzeichen der Zeitlichkeit war hier besonders der Vorliebe des Malers für große, leere Flächen oft verwegen aufgetragener Farbe zuzuschreiben. Doch trotz ihrer augenscheinlichen Mängel hatten die Bilder, wie ich schon sagte, in dieser Situation etwas Ansprechendes und Passendes. Selbst der Wald von umgekehrten Beinen, die sich, offenbar in einem Laufwettbewerb bei den Olympischen Spielen, wild auf ihr Ziel zubewegten, zeigte sich zu seinem größeren Vorteil, wahrscheinlich wegen dieser verkehrten Stellung, in der er ein immenses Gefühl nervöser Dringlichkeit vermittelte, wobei die Fleischtöne der angestrengten Glieder der Athleten seltsam mit den rosafarbenen und gelben Konturen von drei Amoretten aus nachgemachtem Meißner Porzellan kontrastierten, die nebeneinander auf einem Nachtschränkchen dahertrippelten.
Nach einiger Zeit hielten zwei bukolische Gestalten in Sportmützen, Hemdsärmeln und Schürzen aus grünem Fries Mr. Deacons Bilder nacheinander hoch, damit sie von einer kleinen Schar von Händlern – einer deprimierten Gruppe von Männern, die aussahen, als ob sie sich zwischen zwei ihnen mehr zusagenden Ereignissen auf dem Rennplatz in die Auktion verirrt hätten – begutachtet werden konnten. Ich war mir nicht sicher, welchen Eindruck diese Zurschaustellung auf andere Leute machen mochte, und war froh, dass es während der Vorführung keine unfreundlichen Kommentare gab. Die ungeheure Größe der dargestellten Szenen hätte an sich schon sehr wohl zum Lachen reizen können; und obwohl ich damals schon genug über Mr. Deacon wusste, um seine Malerei nicht für ernsthafter zu halten als eine Reihe anderer in ihm im Widerstreit liegender Elemente, hätte mich die offene Verspottung seines Werkes doch betrübt. Alle vier Bilder trafen jedoch, als sie so eins nach dem anderen hochgehalten wurden, nur auf apathisches Schweigen; und obwohl sie alle zusammen schließlich jemandem für nur ein paar Pfund zugeschlagen wurden, war das Bieten selbst ziemlich lebhaft – möglicherweise wegen der Rahmen, die aus einem schwarzen Material gemacht waren, das ein goldenes Blumenmuster schmückte, wohl ein Entwurf des Malers selbst.
Mr. Deacon muss unser Haus während meiner Kindheit wenigstens ein halbes Dutzend Mal besucht haben, und bei diesen Gelegenheiten hatte ich ihn dann ganz zufälligerweise mehr als einmal gesehen und gesprochen. Ich weiß jedoch nicht, warum sich unsere Wege damals kreuzten, denn man sagte von ihm immer, er könne »Kinder nicht leiden«, so dass unsere Begegnungen, wenn man sie so nennen konnte, wohl kaum von meinen Eltern absichtlich arrangiert worden waren. Mein Vater, den die Unterhaltungen mit Mr. Deacon amüsierten, sprach gewöhnlich ohne Enthusiasmus von seiner Malerei; und wenn Mr. Deacon, wie er es manchmal tat, behauptete, er ziehe es vor, seine Bilder selbst zu behalten, statt sie zu verkaufen, rief diese Bemerkung bei uns zu Hause immer einen mild-ironischen Kommentar hervor, nachdem er gegangen war. Es wäre jedoch nicht fair, damit sagen zu wollen, dass Mr. Deacon, professionell gesehen, unfähig gewesen sei, einen Absatzmarkt für seine klassischen Sujets zu finden. Im Gegenteil, er konnte immer mehrere treue Käufer aufzählen, zumeist Geschäftsleute aus Mittelengland. Besonders einer unter ihnen, von ihm der »große Eisen-Mann« genannt – den ich mir immer als physisch aus dem Metall konstruiert vorstellte, von dem sein Einkommen herrührte –, pflegte zum Beispiel einmal im Jahr aus Lancashire nach London herunterzukommen und jedes Mal im Besitze einer Ölskizze des Antinous oder eines Bündels von Kohlestudien trainierender junger Spartaner in den Norden zurückzukehren. Mr. Deacon zufolge hatte eine dieser kleineren Arbeiten sogar ihren Weg in die örtliche Kunstgalerie des Eisenfabrikanten gefunden – eine Auszeichnung, die dem Maler offensichtlich große Befriedigung bereitete; doch pflegte Mr. Deacon von dieser Sache in einem missbilligenden Ton zu sprechen, denn er verurteilte die »offizielle Kunst«, wie er sie nannte, und sprach immer mit großer Bitterkeit von der Royal Academy. Als ich ihn später im Leben wiedertraf, entdeckte ich, dass er den Impressionisten und den Nachimpressionisten fast die gleiche Abneigung entgegenbrachte und, natürlicherweise, spätere Trends wie den Kubismus oder die Werke der Surrealisten sogar noch stärker ablehnte. Ja, Puvis de Chavannes und Simeon Solomon, von denen er den letzteren, glaube ich, als seinen Meister betrachtete, waren die einzigen Maler, von denen ich ihn je mit uneingeschränktem Beifall habe sprechen hören. Die Natur hatte ihn zweifellos dazu bestimmt, so etwas wie ein zweitrangiger Vertreter der Kunstbewegung der neunziger Jahre des vorigen Jahrhunderts zu sein; doch irgendwie hatte Mr. Deacon in seiner Jugend diesen Geist verfehlt – ein moralisches Getrenntsein, das vielleicht einen späteren Mangel an Einordnung erklärte.
Er war nicht reich, doch erlaubte ihm sein damaliges Einkommen die Bewahrung einer ziemlich unabhängigen Haltung im Hinblick auf die mehr materielle Seite der Existenz eines Malers. So hatte er einmal die Gelegenheit zurückgewiesen, das Innere eines Fischrestaurants in Brighton – wo er damals lebte – auszumalen, weil die gebotene Summe in keinem Verhältnis zu der erniedrigenden Natur der verlangten Arbeit gestanden habe. Seine Mittel hatten es ihm auch ermöglicht, eine, wie es hieß, exzellente kleine Sammlung von Sanduhren, Schattenrissen und Nippsachen der verschiedensten Art zusammenzutragen. Gleichwohl beschrieb er gelegentlich gern, wie er, um die Ausgaben und die Verantwortung für Dienstboten zu vermeiden, es willentlich auf sich nahm, über lange Zeitabschnitte für sich selbst zu kochen. »Ich könnte immer meinen Lebensunterhalt als Koch verdienen«, pflegte er zu sagen und scherzhaft hinzuzufügen, dass er in einer weißen Mütze »enorm dekorativ« aussehen würde. Wenn er das europäische Festland bereiste, tat er das gewöhnlich zu Fuß, mit dem Rucksack auf dem Rücken, statt mit der Eisenbahn, die er »stickig« fand und »unendlich voll von langweiligen Leuten«. Er war sorgsam, ja fast übertrieben ängstlich auf seine Gesundheit bedacht, besonders in Bezug auf die persönliche Reinlichkeit und gute sanitäre Einrichtungen; so dass einige der unappetitlicheren Seiten dieser vorgeblichen Terre-à-terre-Ausflüge ins Ausland für ihn manchmal eine harte Prüfung gewesen sein mussten. Vielleicht waren seine Besuche auf dem Festland aber in Wirklichkeit quälender für die Geschäftsführer der Hotels und Restaurants, die er frequentierte, denn für ihn war es von großer Wichtigkeit, absolut darauf zu bestehen, dass andere seinen Wünschen bis ins Einzelne nachkamen. Ohne Zweifel waren solche Reisegewohnheiten, soweit er sie wirklich freiwillig annahm und nicht durch finanzielle Erwägungen in einem gewissen Maße dazu gezwungen wurde, in seiner Vorstellung auch mit seiner eigenen, besonderen Auffassung von gesellschaftlichem Verhalten verknüpft, in der er von einer oft geäußerten Abneigung gegenüber einem Betragen geleitet wurde, das auch nur den Anschein erweckte, entweder konventionell oder konservativ zu sein.
In dieser letzteren Hinsicht ging Mr. Deacon weiter als mein Onkel Giles, der mit seinem Bekenntnis, »so etwas wie ein Radikaler« zu sein, im Kreise seiner eigenen Familie, ja, wo immer er sich befinden mochte, auch nie hinter dem Berg hielt. Aber mein Onkel bezog sich dabei auf eine Materie, die er kannte und die er, obwohl er das nie zugegeben hätte, sogar bis zu einem gewissen Grade verehrte; er wünschte nur, dass die meisten Seiten dieser vertrauten Welt besser seinem eigenen Geschmack angepasst seien. Mr. Deacon dagegen trat dafür ein, die existierende Welt gänzlich abzuschaffen oder zu ignorieren, um dann mit einer Welt ganz anderer Ordnung experimentieren zu können. Er beschäftigte sich mit Esperanto (oder, möglicherweise, einer der weniger bekannten künstlichen Sprachen), war, mit Unterbrechungen, Vegetarier und verfocht das Dezimalsystem für Münzen. Gleichzeitig bekämpfte er entschieden die Einführung einer Rechtschreibreform des Englischen (mit der Begründung, dass solche Veränderungen für ihn John Miltons »Verlorenes Paradies« ruinieren würden), und ich kann mich erinnern, dass gesagt wurde, er hasse »Frauenrechtlerinnen«.
Solche Auffassungen wären, mit der möglichen Ausnahme des Dezimalsystems für Münzen, bei meinem Onkel als bloße Marotten angesehen worden; aber da Mr. Deacon sie fast immer in einer leicht amüsanten Art darlegte, waren meine Eltern hier weit duldsamer als gegenüber ähnlichen Vorurteilen, die mein Onkel verbreitete, dessen herzlich bedauerte Ansichten von den meisten seiner Verwandten automatisch mit der gegen sie gerichteten Gefahr bevorstehender finanzieller Sorge verbunden wurden – von möglichen Skandalen innerhalb der Familie ganz zu schweigen. Wie auch immer, aggressive persönliche Meinungen, welcher Art sie auch seien, werden wohl zu Recht als unerwünscht betrachtet, oder es wird ihnen bestenfalls geringes Gewicht beigemessen, wenn sie von einem Menschen ausgesprochen werden, dessen Lebensverlauf so konstant erfolglos ist, wie es der von meinem Onkel gewesen war. Mr. Deacons Überzeugungen dagegen konnte man tolerant als Teil des Rüstzeugs eines professionellen Malers – der auch keineswegs ein Versager war – ansehen und sie, wie widerwillig auch immer, als unvermeidliches Zubehör eines Boheme-Berufes hinnehmen, ja sogar als etwas auf ihre Art Wertvolles, da sie eine andere Seite menschlicher Erfahrung veranschaulichten.
Gleichwohl betrachteten ihn meine Eltern, obschon sie sich zweifellos über seine gelegentlichen Besuche freuten, mit Recht als einen Exzentriker, der sich, wenn man nicht sehr aufpasste, leich...