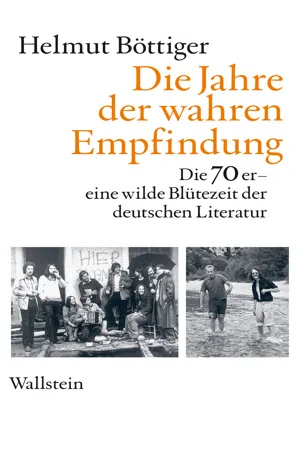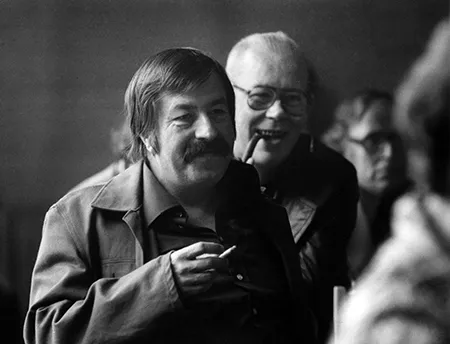![]()
Vorspiel
Uwe Johnson, die Kommune 1 und das Puddingattentat
In den Jahren 1966 und 1967 überließ der sehr auf Anstand und Moral bedachte Schriftsteller Uwe Johnson seine Familien- und seine Arbeitswohnung in Westberlin der berüchtigten Kommune 1. Doch das wusste er nicht. So kam es zu einem ungeahnten Miteinander von Literatur, Bohème und Politik, das wie ein skurriles Vorspiel zu den verblüffenden Ereignissen der nächsten Jahre wirkt.
Johnson brach Ende April 1966 zu einem über zweijährigen Aufenthalt in New York auf, den er sich zum Teil mit einer Stelle als Schulbuchlektor des Verlags Harcourt, Brace & World finanzierte. Dass er seine beiden Westberliner Wohnungen in zwei Etappen unterschiedlichen Nutzern zur Verfügung stellte, lag an dem kollegialen Verhältnis, das er zu Hans Magnus Enzensberger unterhielt. Die beiden blutjungen Schriftsteller waren zum ersten Mal bei der Tagung der Gruppe 47 auf Schloss Elmau im Jahr 1959 aufeinandergestoßen: Enzensberger als bereits durchgesetzter »angry young man«, der mit seinem Gedichtband »Verteidigung der Wölfe« einiges Aufsehen erregt hatte, und Johnson als soeben aus der DDR übergesiedelter neuer Hoffnungsträger des Suhrkamp Verlags, dessen Romandebüt »Mutmassungen über Jakob« gerade beworben wurde.
Dass sie sich bei dieser ersten Begegnung gleich in die Haare gerieten, ist durch einen kurzen Zeitungsartikel von Klaus Wagenbach belegt. Enzensberger hatte sein Langgedicht »Schaum« vorgetragen, ganz im Stil seiner frühen Provokationsgesten, und Johnson, in der Ernsthaftigkeit der Auseinandersetzung mit der DDR aufgewachsen, beargwöhnte das. Enzensberger ging es um Wirkung, Johnson um Haltung. Wagenbach gibt wieder, was Enzensberger nach Johnsons Kritik entgegnet habe: »Wenn Sie jemandem sagen, dass er sich ändern solle, so ist dies das sicherste Mittel, dass er sich nicht ändert.« Worauf Johnson versetzte: »Ich halte es für einen pädagogischen Fehler, die Antwort auszulassen.«
Dieser Schlagabtausch war ein äußerst charakteristischer zwischen Ost und West, zwischen dem spielerisch-wendigen Medienjongleur und dem prinzipientreuen Moralisten, der durch harte staatliche Strukturen hindurchgegangen war. Damit waren gegensätzliche Positionen erkennbar geworden, in persönlichen wie in gesellschaftspolitischen Fragen. Aber ganz so einfach war es dann doch wieder nicht. Enzensberger, durch seine quecksilbrige Intelligenz und Auffassungsgabe ein Avantgardist des öffentlichen Diskurses, lobte kurz danach Johnsons Romandebüt in einer Kritik so scharfsinnig, dass beider Verleger Siegfried Unseld in einem Brief an Johnson konstatierte, unter den Rezensionen zu »Mutmassungen über Jakob« rage »keine außer der Enzensbergerschen« heraus. Darauf entspann sich ein Briefwechsel zwischen Johnson und Enzenberger, und sie genossen dabei ihre gemeinsamen sprachlichen Interessen, aber zugleich ihre Gegensätze. Es fällt allerdings auf, dass Johnson dies zu einem Vertrauensverhältnis ausbaute, während Enzensberger in erster Linie darauf setzte, Johnson als ästhetisch reizvollen Bündnispartner für seine publizistischen Aktivitäten zu gewinnen. Es gibt in den ersten Nummern des im Vorfeld der 68er-Bewegung höchst einflussreichen, von Enzensberger herausgegebenen »Kursbuchs« ab 1965 insgesamt drei Beiträge Johnsons.
Da war es naheliegend, dass Johnson, als er in die USA aufbrach, ab Mai 1966 seine Atelierwohnung in der Niedstraße an Ulrich Enzensberger weitergab, den jüngeren Bruder von Hans Magnus. Und als Johnson dann im Januar 1967 ein Hilferuf von Dagrun Enzensberger ereilte, der norwegischen Ehefrau von Hans Magnus, reagierte er auch hier sofort freundschaftlich und hilfsbereit. Sie schrieb, dass »Mang«, Enzensbergers Kose- und Spitzname, und sie sich »für einige Zeit trennen« würden, sie bezeichnete es als »Eheurlaub«. Deswegen bat sie darum, Johnsons Familienwohnung in der Stierstraße, »d. h. ein Zimmer + Küche + Bad«, für »eine kürzere Zeit leihen zu dürfen«.
Abb. 1: Die Kommune 1 feiert den Auszug aus Uwe Johnsons Wohnung in der Niedstraße 14
So richtig reinen Wein schenkte sie Johnson aber nicht ein. Dagruns Ehemann war nämlich mittlerweile bereits zweimal in der Sowjetunion gewesen, nachdem er beim ersten Mal eine politisch-erotische Bekanntschaft gemacht hatte, für die er trotz all seiner raffiniert relativierenden Diskurstechniken in dieser Zeit wohl äußerst empfänglich war. In seinen späten autobiografischen und mit prismatischen Effekten spielenden Erinnerungsspiegelungen unter dem Titel »Tumult« hat er angedeutet, dass seine zweite Ehe mit der um dreizehn Jahre jüngeren, dreiundzwanzigjährigen Sowjetrussin Mascha eine zeitgemäß aufgeladene amour fou war: Das »tete-à-tete im Gras« in der Dunkelheit neben einem säulengeschmückten Restaurant über Baku! Die Heirat 1966 im »Eheschließungspalast der Abteilung Standesamt der Stadt Moskau«! Die »Liebeswut« und die »Tyrannei« der »bezaubernden« Russin, deren »grün schimmernde, durchdringende, erwachsene Augen« den westdeutschen Wortradikalen in einen ungeahnten Zustand des Begehrens versetzt hatten! Seine erste Frau, Dagrun, wusste, dass dies unwiderruflich das Ende ihrer Ehe bedeutete, und sie wollte den auf die Freundschaft selbstverständlich auch unter den Ehepaaren großen Wert legenden Uwe Johnson nicht mit der ganzen bitteren Wahrheit brüskieren.
Johnson beschrieb Dagrun Enzensberger in nachgerade rührender Weise, wie sie den Schlüssel von der Hauswartsfrau bekommen würde und worauf sie bei der Wohnung sonst noch achten müsse. Eine erste Ahnung davon, was mit seinen neu entstandenen Beziehungen zu den engen Familienausläufern seines Freundes Enzensberger auf ihn zukommen würde, dämmerte ihm vielleicht schon am 3. Februar 1967, als ihm Dagrun zwischen Mitteilungen über die Reparatur des Kühlschranks und den Austausch des »Überfallsrohrs im Spülkasten des Clo’s« mit schwedischem Akzent bekannte: »So wie es hier ist – ist es nichts. Es gibt keine alternative, neue mögligkeiten müssen geschaffen werden. Warum – wie – wohin – diese fragen versuche ich mich klarzuwerden. Alleine bin ich nicht. Wir machen eine kommune mit wenige verzweifelte, die alle nicht mehr dieses hier mitmachen können. Nach aussen profilieren wir uns vorläufig nur in demonstrationen, sit-in-s etc.«
Auch über Ulrich Enzensberger, den Untermieter im Niedstraßen-Atelier, begann sich Johnson im fernen New York langsam Gedanken zu machen. Denn die Reparatur des Dachfensters, um die er ihn gebeten hatte und für die er bereits »unter das Fenster groessere Mengen Linoleum habe legen lassen«, sprengte den vereinbarten Kostenrahmen erheblich. Dafür schrieb ihm Dagrun am 31. März: »Durch Ulrich E. kam ich mit leuten in verbindung die in einer ähnlichen lage waren. Wir haben mit unseren eigenen persönlichen schwierigkeiten angefangen, mit lebensgeschichten, aufarbeitung der dunklen schichten. Wir nennen es ›den alltag revolutionieren‹. Wir sind 8 leute verschiedenen schlages, intellektuelle, mit gemeinsamem ziel, der Gesellschaft einen Spiegel vorhalten.«
Zum Kern dieser Kommune gehörten neben Dagrun und Ulrich Enzensberger unter anderem Fritz Teufel und Rainer Langhans, die es später zu zwar auch politischer, vor allem aber zu beträchtlicher popkultureller Relevanz bringen sollten. Sie suchten für ihre Zwecke eine große Wohnung oder ein Haus, aber auf absehbare Zeit mussten die von Johnson bezogenen Räume ihr Aktionszentrum bilden. Bereits am 29. März, also zwei Tage vor Dagrun Enzensbergers Selbstdarstellung der Kommune, hatte Johnson ein anderer Brief über die Wohnung in der Stierstraße erreicht, und zwar von seiner Vermieterin Ursula Grunke. Es seien mittlerweile fünf Personen eingezogen, und viele Mieter hätten sich über nächtliche Ruhestörungen beschwert. Außerdem habe Frau Enzensberger einen Wasserschaden verursacht, für dessen Kosten Johnson nun aufkommen müsse.
Abb. 2: Grass und Johnson, noch Jahre später gemeinsam feixend
Die Ereignisse begannen sich zu überstürzen. Am 6. April las Johnson in seiner geliebten »New York Times«, der er in seinem Großroman »Jahrestage« ein Denkmal gesetzt hat, die reißerische Schlagzeile »11 SEIZED IN BERLIN FOR ALLEGED PLOT TO KILL HUMPHREY«. Das machte ihn nicht nur betroffen, sondern betraf ihn auch wirklich selbst: Die elf festgenommenen Personen, die den US-Vizepräsidenten Hubert Humphrey während seines Berlin-Besuchs angeblich ermorden wollten, hatten ihren Plan nämlich mit einigen anderen in seinen Zimmern ausgeheckt. Ulrich Enzensberger gibt in seinem 2004 erschienenen Buch »Die Jahre der Kommune 1« mit dem »Kommune-Protokoll« vom 2. April wieder, was genau geplant war: Die »Humphrey-Aktion« sollte in der Martin-Luther-Straße oder direkt am Rathaus Schöneberg stattfinden, mit möglichst vielen roten Rauchbomben, um Irritation auszulösen. Die Demonstranten wollten dabei etliche Gegenstände auf die Staatskarosse werfen, Bälle, Früchte, Schlagsahne und vor allem Pudding. Für das Happening war außerdem Gesang vorgesehen, Lieder wie »Hoch soll er leben«, »Backe backe Kuchen« oder »Berlin ist eine Reise wert«.
Das später als »Puddingattentat« in die Geschichte eingegangene Ereignis wurde allerdings, offenkundig mittels eines V-Manns des Verfassungsschutzes, bereits im Vorfeld vereitelt. Am 5. April wurden die Kommunarden zum einen Teil im Grunewald beim Test von Rauchbomben, zum anderen Teil in Johnsons Atelierwohnung in der Niedstraße verhaftet. Johnson musste das am 7. April in einem ausführlichen Bericht seiner »New York Times« lesen, und zwar unter ausdrücklicher Nennung seines eigenen Namens: »They were seized at 6 P. M. yesterday in the home of the German novelist Uwe Johnson.« Dagrun Enzensberger, »the divorced wife of a well-known German poet, Hans Magnus Enzensberger«, wurde dabei als »a leader of the ›horror commune‹« bezeichnet.
In der »New York Times« las sich das mindestens genauso dramatisch, wie es sich in der bundesdeutschen Innenpolitik ausnahm. Die »Frankfurter Allgemeine Zeitung« titelte: »›Mao-Gruppe‹ in Berlin hantiert mit Sprengstoff«, das Berliner Boulevard-Blatt »Der Abend« fand die Schlagzeile »Maos Botschaft in Ost-Berlin lieferte die Bomben gegen Vizepräsident Humphrey«, und wie alle anderen Gazetten versäumte es auch die »Bild«-Zeitung nicht, darauf hinzuweisen, dass die Attentäter in der Wohnung des sich in den USA aufhaltenden Schriftstellers Uwe Johnson festgenommen worden waren.
In dieser Situation machte es sich bezahlt, dass Johnson einige Jahre vorher seinen Kollegen Günter Grass, der nach einer neuen Wohngelegenheit suchte, auf das Nachbarhaus in der Niedstraße hingewiesen hatte. Sie wohnten seitdem Wand an Wand. Johnson rief nach Lektüre des Artikels in der »New York Times« Grass sofort an und bat ihn, nach dem Rechten zu sehen. Er schrieb ihm auch gleich eine Vollmacht, in der es hieß, »die Räumung der Wohnung und des Studios von meinen früheren Gästen, Herrn Ulrich Enzensberger und Frau Dagrun Enzensberger, sowie von allen Personen, die sich sonst dort aufhalten, zu betreiben«. Grass überwachte denn auch am 8. April die Räumung von Johnsons Wohnung durch die Polizei. Anschließend meldete er Vollzug und bezeichnete sich in einem Brief an Johnson stolz und ironisch als den »großen Rausschmeißer der Pudding-Schmeißer«. Johnson war überglücklich und bat noch um die Bestellung einer Putzfrau, die das Ganze »mit Seife und Wasser« ordentlich herrichten sollte, bevor er mit seiner Familie wieder einzog.
Das war nicht ganz ohne Pikanterie, denn in der Zeit, als Johnson mit Hans Magnus Enzensberger noch einen freundschaftlich-kollegialen Kontakt pflegte, hatte er sich über den berühmten Kollegen Grass noch mit der Bezeichnung als »Gross-Schriftsteller« lustig gemacht. Jetzt waren die Fronten aber geklärt. Grass, wie er die Kommunarden vertreibt: Ein schöneres Bild für seine Lieblingsvision in der 68er-Zeit ist kaum denkbar, und er wusste darum. Enzensberger indes, der die Vertrauensperson gewesen war, wegen der Johnson seine Wohnung so umstandslos zur Verfügung gestellt hatte, wies mit wegwerfender Gebärde alle Verantwortung von sich: »ich gehöre keiner kommune an, habe mit keiner kommune etwas zu schaffen.«
Enzensberger, Johnson, Grass: dieses Dreieck vermaß sehr unterschiedliche politisch-literarische Kraftfelder. Und es enthält vieles von dem, was sich in den Jahren nach 1968 entladen sollte. Einen wichtigen Zündstoff dafür lieferte die berühmte Nummer 15 des von Hans Magnus Enzensberger herausgegebenen »Kursbuchs« mit seinem vielzitierten Aufsatz »Gemeinplätze, die Neueste Literatur betreffend«. Er beschrieb darin, die Erregtheiten dieser Jahre souverän aufnehmend, die Crux der Literatur in der kapitalistischen Gesellschaft. Enzensberger kritisierte den bürgerlichen Literaturbegriff vehement, sicherte sich aber, wie es für ihn immer charakteristisch war, gleichzeitig für alle Fälle ab und druckte im selben Heft unter anderem auch als Erstveröffentlichung die vier letzten Gedichte von Ingeborg Bachmann.
Gegen Ende seines Aufsatzes umriss er ziemlich deutlich, wie eine relevante Literatur in der unmittelbaren Gegenwart aussehen könnte. Er nannte als Muster »Günter Wallraffs Reportagen aus deutschen Fabriken, Bahman Nirumands Persien-Buch, Ulrike Meinhofs Kolumnen, Georg Alsheimers Bericht aus Vietnam«. Es ging ihm also entschieden um nicht-belletristische Texte mit gesellschaftspolitischer Relevanz, mit konkretem Bezug. Dazu gehöre auch eine gezielte Praxis, die herrschende »Bewusstseins-Industrie« zu unterlaufen. Das gelinge am besten mit Aktionen, die nicht mehr an »traditionellen Mitteln« wie dem Buch hängen würden. Das Beispiel, das Enzensberger dafür fand, wirkt nach alldem äußerst konsequent: Ein Maßstab sei die »Arbeit Fritz Teufels«. Der zum Markenzeichen gewordene Untermieter Uwe Johnsons also, der personifizierte Pudding-Attentäter!
Enzensberger folgerte: »Wer Literatur als Kunst macht, ist damit nicht widerlegt, er kann aber auch nicht mehr gerechtfertigt werden.« Das »Kursbuch« Nr. 15 stand in der allgemeinen Wahrnehmung für den »Tod der Literatur«. Damit fingen die siebziger Jahre an.
![]()
Das Manifest der plötzlichen Verunsicherung
Peter Schneiders Erzählung »Lenz«
Im Jahr 1973 erschien im soeben gegründeten Rotbuch Verlag als eines seiner ersten Bücher eine schmale Broschur mit 90 Seiten, in der Art aktueller Flugschriften. Auf dem Titel war zwischen dem hellen roten Rahmen, der die Produkte dieses Verlags charakterisieren sollte, ein leicht blaustichiges Schwarzweißfoto abgebildet. In einer diffusen, hügeligen Landschaft zieht sich da eine breite Autostraße einem am Horizont verblassenden Gebirgszug entgegen. Damit wurde einiges angedeutet. Das Innere der Menschen, die sich zwischen diesen dünnen biegsamen Buchdeckeln bewegten, musste etwas ziemlich Verunsichertes haben. Aber es war auch gezeichnet von einer ungewissen, mit einer vagen Richtung versehenen Sehnsucht.
Dass dieses Bändchen einen ungeheuer anmutenden Erfolg haben würde, war seiner Aufmachung nicht sofort anzusehen, doch die Erzählung »Lenz« von Peter Schneider wurde sofort zu einem Kultbuch. Sie thematisierte etwas, das Anfang der siebziger Jahre in der Luft zu liegen schien, aber bisher nicht so recht greifbar gewesen war. Die Art der Politisierung in der 68er-Zeit hatte etwas zurückgelassen, womit die Einzelnen nun alleine zurechtkommen mussten – eine Leerstelle der Gefühle, für die man noch keine richtigen Worte finden konnte.
»Lenz« wirkte wie ein roher, unbehauener Versuch und dadurch äußerst authentisch, aber ihre suggestive Kraft entwickelte diese Prosa dadurch, dass sie über ein bloßes Zeitzeugnis hinausging und eine fiktive Form fand, einen ästhetischen Rahmen. Es war wie ein Geniestreich. Peter Schneider veröffentlichte diesen Text im Alter von 33 Jahren, und er hatte bereits einen gewissen Namen – allerdings auf ganz anderen Feldern als dem einer sich vorsichtig herantastenden Literatur. Er galt auf dem Höhepunkt der 68er-Bewegung als ein glänzender Agitator und war für seine politisch aufrüttelnden und emotionalisierenden Ansprachen bekannt. Das war, wie er später sagte, für ihn selbst überraschend, aber bereits sein erster Auftritt vor den sich radikalisierenden Studenten war ein Schlüsselerlebnis. Anfangs hätten sich die Zuhörer noch vernehmlich miteinander unterhalten, ein beträchtliches Grundrauschen, gegen das sich die Stimme des Redners am Mikrophon schwer durchsetzen konnte. Doch Schneider hatte bei dem schwarzen amerikanischen Bürgerrechtler Malcolm X eine bestimmte rhetorische Technik entdeckt, dieser skandierte seine Reden in einer mitreißenden rhythmischen Weise. Dieses musikalisch aufpeitschende Prinzip probierte Schneider nun auch einmal aus, und offenkundig funktionierte es auch bei ihm. Langsam seien ihm alle gefolgt, er zeigte Wirkung, plötzlich hörten ihm alle zu. Schneider wurde in der Folge einer der ...