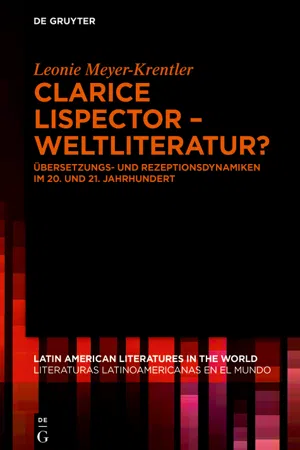Zahlreiche Literaturkritikerinnen und -kritiker in Ländern wie den USA, England, Deutschland oder Schweden nahmen die Autorin Clarice Lispector (1920–1977) in der Phase zwischen 2010 und 2020 zum ersten Mal zur Kenntnis und erfuhren, bei der Brasilianerin handele es sich um eine der Größen der Weltliteratur. Mit ihrem Werk aber schien niemand von ihnen vertraut zu sein. Wie war das möglich? Immerhin wurde sie in vielen Ländern Lateinamerikas und insbesondere in Brasilien seit langem von einem breiten Lesepublikum verehrt und galt weltweit als die bedeutendste Autorin in portugiesischer Sprache. Ihr Werk wurde phasenweise auch im Ausland rezipiert, geriet aber immer wieder in Vergessenheit. Über Lateinamerika hinaus bekannt wurde Clarice Lispector in den Jahren nach ihrem Tod 1977 über eine intensive Rezeption in Frankreich. In einige weitere Länder strahlte dies aus, so nach Deutschland, wo sie nach zwei Jahrzehnten der Übersetzung und Publikation ihres Werkes wieder vollständig in Vergessenheit geriet. Nach dem Erfolg der ersten englischsprachigen Biographie (Moser 2009) und der Neuübersetzung einiger Romane sowie der Herausgabe der gesammelten Erzählungen in den USA (2015) kamen Kritikerinnen und Kritiker der großen englischsprachigen Organe plötzlich nicht mehr um sie herum und erzeugten eine neue, weitreichende Aufmerksamkeit für Clarice Lispectors Werk – über 30 Jahre nach ihrem Tod. „Schon wieder entdeckt!“ titelte ZEIT ONLINE zu ihrem 100. Geburtstag im Dezember 2020 und stellte Clarice Lispector dem deutschen Publikum als eine Autorin vor, „die schon zu Lebzeiten als bedeutendste brasilianische Schriftstellerin galt und dennoch in Brasilien sowie im Ausland immer wieder als Geheimtipp gehandhabt wurde“ (Sales Prado 2020).
Der Frage nach den Zusammenhängen für diese immer wieder in Frage stehende, diskontinuierliche Wahrnehmung als Weltliteratur geht der vorliegende Band nach, indem er die Publikations-, Übersetzungs- und Rezeptionsgeschichte der Autorin anhand konkreter Materialien zugänglich macht und Schlüsselphasen herausstellt: in Brasilien und Lateinamerika, im feministischen Frankreich der 1980er Jahre, in den USA, wo sie zunächst wenig oder wenig gut übersetzt wurde und erst im 21. Jahrhundert mit skurriler Verspätung zum shooting star der Weltliteratur geworden ist, und in Deutschland, wo sich verschiedene Verlage neu um ihr Werk bemühen, nachdem eine Reihe von Veröffentlichungen insbesondere aus den 1980er und 1990er Jahren lange vergriffen sind.
Diese hier so kurz angerissene Rezeptionsgeschichte macht Clarice Lispector zu einer zentralen Figur, wenn es um Fragen danach geht, wie Weltliteratur überhaupt gemacht wird und welche Faktoren dazu beitragen, wenn ein Werk international nicht oder nur phasenweise rezipiert wird. Welche Rolle spielen Übersetzungen? Eigneten sich Lispectors Texte weniger für eine weiterreichende Zirkulation als andere, die von Experten als ähnlich relevant eingeschätzt wurden – und falls ja, warum? Und was hat sich im Laufe der Zeit daran geändert? Natürlich gibt es viele Fälle von Autorinnen und Autoren, die in ihrem Ursprungskontext weit bekannter wurden als in anderen Sprachräumen: „local success guarantees little“ schreibt William Marling (2016: 2) über das Verhältnis nationaler und internationaler Erfolge von Autoren auf dem Weg weltliterarischer Kanonisierung in den 1960er Jahren. Die extreme Form dieses Phänomens, die sich bei Clarice Lispector beobachten lässt, ist hingegen selten. Darüber hinaus wurde sie seit dem sensationellen Debut, das sie 1943 im Alter von 23 Jahren in Rio de Janeiro veröffentlichte, auch im Ausland von der Literaturkritik immer wieder sehr selbstverständlich zur Weltliteratur gezählt, allerdings nur in kurzen Wellen rezipiert. Ob die jüngste Rezeptionswelle insbesondere in den USA nachhaltiger sein wird, bleibt abzuwarten.
Mehrere Faktoren spielen für die Rezeptionsgeschichte von Clarice Lispectors literarischem Werk eine wesentliche Rolle. Erst einmal ist da die Frage, welchen Einfluss es hatte, dass Clarice Lispector auf Portugiesisch schrieb, eine zu ihren Lebzeiten (und weit darüber hinaus) außerhalb Lateinamerikas und Portugals für viele Verlage exotische, schwer rezipierbare Sprache. Bekanntlich hatten in der Phase nach 1959 portugiesischsprachige Autorinnen und Autoren keinen nennenswerten Anteil am weltweiten Boom lateinamerikanischer Literaturen, ein Umstand, der sich mit Blick auf die zu diesem Zeitpunkt auf Portugiesisch vorliegenden literarischen Texte nicht rechtfertigen lässt (Remington Krause 2010). Zweitens stellt sich natürlich die ebenso zentrale Frage, welche Rolle es spielte, dass Lispector eine Frau war – gerade im machistischen Brasilien der 1940er Jahre, wo ihre Karriere begann, ein immens einflussreicher Faktor, wenngleich schwer zu beforschen, weil es kaum Vergleichsmöglichkeiten gibt. Wie viele Frauenfiguren in der internationalen Kunst- und Literaturszene ihrer Zeit wurde sie zwar nicht vollkommen ignoriert, brauchte aber deutlich länger als männliche Kollegen, um rezipiert zu werden, und wurde außerhalb Brasiliens insbesondere im Kontext der Revision einer fehlenden Beachtung in der Vergangenheit bekannt. Wie sind die Zusammenhänge dessen bei näherer Betrachtung zu bewerten, was lässt sich aus verschiedenen Rezeptionskontexten zu diesem Thema zusammenführen?
Als dritter Aspekt, der hier genannt werden muss, stellt sich die Frage nach dem Einfluss von Clarice Lispectors eigenwilliger, die Erwartungen ihrer Leserinnen und Leser häufig irritierender Ästhetik auf Übersetzungs-, Zirkulations- und Rezeptionsdynamiken. Die Lektüre von Lispectors Romanen und Erzählungen, deren erzählerische Kraft nicht zuletzt in einer permanenten Suche nach einer Sprache ,hinter den Worten‘, jenseits der sprachlichen Konventionen liegt, ist aufgrund ihrer einzigartigen Ästhetik schließlich schon in der Ausgangssprache kein leichtes Unterfangen. Ihr Schreiben sei „wie in unbekannten Gewässern fischen“,1 schreibt Antonio Maura angelehnt an die poetischen Bilder der Autorin, die immer wieder mit literarischen Konventionen brach, um das Neue hervorzuholen. Manchen ihrer Leserinnen und Leser hat Lispector damit offenbar etwas sehr Wesentliches eröffnet, wie zahlreiche Aussagen von Künstler/innen, Autor/innen und Wissenschaftler/innen bezeugen. Die Schweizer Schriftstellerin Zoë Jenny, um dieses Beispiel herauszugreifen, schreibt im Winter 2018: „Der Roman Nahe dem wilden Herzen (Schöffling & Co) der brasilianischen Schriftstellerin Clarice Lispector gehört zu den Büchern, die immer in meiner Nähe sein müssen. Er ist Trost, Beruhigungsmittel und Aufforderung zugleich. Jeder Satz kristalline Poesie. Geheimnisvoll, radikal, tiefgründig. Eine einzige Seite reicht aus, mich wieder zu versöhnen.“2 Clarice Lispector selbst ging davon aus, dass sich nur bestimmte Menschen für eine solche, immer auch sehr ins Emotionale gehende Erfahrung der Lektüre ihrer Texte eigneten – sie hat in den Jahren vor ihrem Tod mehrfach darüber gesprochen, wie erstaunt sie darüber war, dass manchmal wenig belesene oder sehr junge Menschen ihre Texte zu verstehen und intensiv zu rezipieren in der Lage waren, während sich unter Expert/innen für portugiesischsprachige Literatur neben begeisterten Fürsprecher/innen immer auch solche fanden, die ihre Erzählliteratur als hermetisch ablehnten (vgl. Lispector 2013). Ein wichtiges Charakteristikum – auch dies ist in Zoë Jennys Kommentar bereits angeklungen – scheint weiterhin zu sein, dass sich einige ihrer Texte erst in der mehrmaligen Lektüre ganz entfalten – ein Effekt, der in Bezug auf Lyrik weithin bekannt und etabliert war, für Erzähltexte allerdings nicht.
Was bedeutet all dies – damit kommen wir zum vierten Punkt der Faktoren oder ,Vorbedingungen‘, die die Rezeptionsgeschichte beeinflussen sollten – was bedeutet dies für so genannte Gatekeeping-Prozesse und für Dynamiken der Netzwerk-Bildung, die für andere Autorinnen und Autoren der Zeit nachweislich sehr wichtig waren, um zu weltliterarischen Erfolgen zu gelangen (vgl. Marling 2016, Müller 2020)? Zwar gab es zu Clarice Lispectors Lebzeiten keine klar nachzuzeichnende, erfolgreiche internationale Kanonisierungsgeschichte – diese findet sich erst postum – aber es gibt Ansatzpunkte, die in diese Richtung gehen. Warum blieb ein ,Durchbruch‘ in solchen Phasen aus, etwa als 1967 der renommierte amerikanische Verleger Alfred A. Knopf ihren von Gregory Rabassa ins Englische übersetzten Roman A maçã no escuro als The Apple in the Dark in sein Programm aufnahm, zu einer Zeit, zu der in Rabassas Englisch mehrere Texte des Boom lateinamerikanischer Autoren um die Welt gingen? Hinsichtlich solcher Dynamiken lohnt ein genauer Blick gerade auf die Verflechtungen zwischen verschiedenen Prozessen: denen der Netzwerkbildung, die für einen Erfolg auf weltliterarischer Ebene entscheidend waren, zwischen Dynamiken der Lesererwartung, gerade auch hinsichtlich der sehr spezifischen Ästhetik Lispectors und eben auch der Übersetzungsprozesse, die einer internationalen Wahrnehmung ihres Werkes notwendigerweise vorausgingen. Zu beobachten ist ein Phänomen, das sich als ,doppelte Isolation‘ Clarice Lispectors zu ihren Lebzeiten verdeutlichen lässt: Eine Isolation, was zum einen Netzwerke innerhalb des internationalen Literaturbetriebs angeht – hier war Lispector trotz vieler Jahre in Europa und den USA recht stark auf Kontakte in Brasilien bzw. Lateinamerika beschränkt. Zum anderen wurde sie auf einer Ebene der literarischen Bezüge und der literarischen Ästhetik allein in einem nicht braslianischen, ‚weltliterarischen‘ Kontext verortet und nahm eine Einzelstellung innerhalb der brasilianischen Literatur ein. In besonderer Weise hing dadurch von Beginn an viel von den Übersetzungen ihrer Bücher ab, die extrem unterschiedlich ausfielen, was ihre Qualität betrifft.
Doch bevor es näher um diese übersetzerischen Zusammenhänge gehen soll, drängt sich eine weitere Frage auf: Worüber sprechen wir überhaupt, wenn wir von Weltliteratur sprechen? Und können wir angesichts der aktuellen Kritik an einem allzu sehr mit politischen und ökonomischen Globalisierungsdynamiken einhergegangenen, wissenschaftlichen Begriff von Weltliteratur (vgl. dazu Müller 2019b) überhaupt noch von einer solchen sprechen?
Um solche Fragen für diesen Band zu klären, ist eine kurze Positionsbestimmung innerhalb der in den Kulturwissenschaften seit etwa zwei Jahrzehnten mit neuer Intensität geführten Debatte um Weltliteratur vonnöten. Der vorliegende Band ist im Kontext des Projektes „Reading Global – Constructions of World Literature and Latin America“ des European Research Council unter der Leitung von Gesine Müller entstanden. Dabei sind Müllers Arbeiten zum Konstruktionscharakter von Weltliteratur (vgl. Müller 2019a/b, Müller 2020) von grundlegender Bedeutung, wenn es um die Frage nach den Bedingungen globaler Rezeption lateinamerikanischer Literaturen und um materialbasierte Zugänge zu Weltliteraturfragen geht. Weltliteratur wird – wenngleich es in der literaturkritischen Praxis bis heute oftmals anders zu beobachten ist – nicht mehr „als statischer Kanon einer Reihe herausgehobener und verbindlicher Werke“ betrachtet, sondern „als komplexer und dynamischer Prozess im Sinne historisch variierender, weltweiter Rezeptionsvorgänge“ (Müller 2020: 11).
Pascale Casanovas La République Mondiale des Lettres (1999) fasst Weltliteratur mit Bourdieu als autonomes globales Feld auf, literarisches Kapital wird nicht durch ästhetische Verfahren oder ideologische Aspekte von Texten generiert, sondern durch die netzwerkartige Interaktion historischer, materieller und ökonomischer Faktoren und diskursiver Praktiken (vgl. Casanova 2004: 17–21; Müller 2020: 11–13). In eine ähnliche Richtung geht David Damrosch, wenn er schreibt, Weltliteratur sei in erster Linie „a mode of circulation and reading“ (2003: 5). Vor dem Hintergrund der von Theoretikern wie Casanova, Damrosch und auch Franco Moretti (2000) erarbeiteten Analysen des Zirkulations- und Prozesscharakters von Weltliteratur wendet sich diese Studie insbesondere den Schattenseiten, den Bruchstellen und Ausschlussmechanismen ,klassischer‘ weltliterarischer Kanonisierung anhand eines konkreten Fallbeispiels zu.3 Denn wenn es gelingt, anhand konkreter Materialien zu zeigen, welche Einschränkungen eine Autorin auf einem solchen Kanonisierungsweg erfahren hat, die – totz der auf- und abebbenden Wellen, in denen sie rezipiert worden ist – als weltliterarisch kanonisiert gelten muss, wird eine neue Perspektive auf die Problematiken solcher Prozesse im 20. und beginnenden 21. Jahrhundert möglich. Dass dabei immer auch ein kritischer Blick auf nicht reflektierte eurozentrische bzw. US-amerikanische Perspektivverhaftungen sehr wesentlich ist, liegt auf der Hand und ist in den vergangenen Jahren vielfach hervorgehoben worden – ebenso wie die Tatsache, dass solche Perspektivverhaftungen aufgrund der Materiallage nicht immer vermeidbar sind. Dieser Band richtet sich im Bewusstsein dieser Diskussionen auf die Rezeption einer Autorin aus dem ,Globalen Süden‘4 hinsichtlich klassischer Denominationszentren in den USA und in Europa – denn hier findet sich, was internationale Kanonisierungsprozesse außerhalb Lateinamerikas angeht, eine konkrete Grundlage für einen materialbasierten Nachvollzug von Kanonisierungsprozessen in Lispectors Fall. In mancher Hinsicht ist dies selbstverständlich ein Einzelfall, der nicht ohne weiteres verallgemeinert werden kann. Zu übergeordneten Fragen nach weltliterarischer Kanonisierung bzw. von Anschluss- und Ausschlussdynamiken im literarischen Feld bietet Clarice Lispectors Übersetzungs- und Rezeptionsgeschichte ungeachtet dessen einen außerordentlich wertvollen Zugang.
Für diese Studie ist dabei die These zentral, dass sich Lispectors langer Weg zu einer breiteren internationalen Rezeption exemplarisch an Texten nachvollziehen lässt, die mehrmals in die gleiche Sprache übersetzt wurden. Neben der Quantität der vorliegenden Übersetzungen in eine bestimmte Sprache war das Vorliegen solcher Übersetzungsvarianten daher ein zentrales Kriterium für die Auswahl der Sprachräume und Rezeptionskontexte, die hier gesondert besprochen werden. Dazu zählen insbesondere (1) Übersetzungsvarianten zu Clarice Lispectors Debut Près du cœur sauvage in Frankreich, (2) Übersetzungen ihres in der englischsprachigen Welt (neben den Erzählungen) am intensivsten rezipierten Romans The Hour of the Star, sowie (3) der Roman Die Passion nach G.H., der als Schlüsseltext zu ihrem Werk gilt, in verschiedenen Varianten im Deutschen.
Für die Frage nach Lispectors steinigem Weg zu weltliterarischer Anerkennung außerhalb Brasiliens spielen übersetzungstheoretische Fragen im Kontext der Weltliteratur-Debatte immer wieder eine Rolle. Grundlegend ist sicher die Frage, ob ein neuer, auf anderen Prämissen fußender Weltliteratur-Kanon angestrebt werden sollte, oder ob es nicht eher darum geht, wie Doris Bachmann-Medick formuliert hat, „die Verflechtung von Weltliteratur, Übersetzung und Kanonbildung aufzubrechen“ (Bachmann-Medick 2004: 176). Wertvoll sind bei einem solchen Bestreben die Impulse einer kulturwissenschaftlich orientierten Übersetzungsforschung, die Perspektiven auf kulturelle Hybridisierungsphänomene ehemals national definierter Literaturgeschichtsschreibung im Hinblick auf Weltliteratur-Geschichte vorantreibt. Übersetzungsherausforderungen, von denen Lispectors Zirkulations- und Rezeptionsgeschichte in hohem Maße zeugt, müssen „in einem konfliktreichen Spannungsfeld der Auseinandersetzung und Verhandlung zwischen kulturellen Differenzen aufgegriffen“ werden (Bachmann-Medick 2004: 183). Lispector ist einerseits ein gutes Beispiel für die Notwendigkeit, die modernisierungstheoretische Grundannahme einer bruchlosen Internationalisierung bzw. eines gelingenden internationalen Kulturaustauschs massiv in Frage zu stellen, wie es bereits im postkolonialen Diskurs vorgeprägt ist, andererseits zeigt ihr Fall auch die Problematiken kulturrelationalistischer Vorannahmen, die einen auf den Urspungskontext beschränkten Erfolg litera...