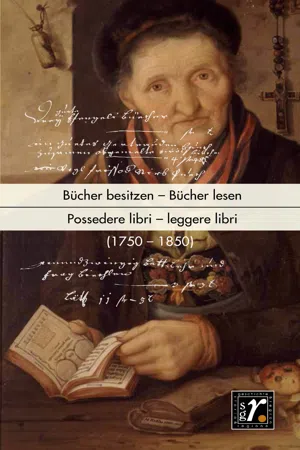![]()
Margret Friedrich/Dirk Rupnow (Hg.), Geschichte der Universität Innsbruck 1669–2019, Band 1: Phasen der Universitätsgeschichte, Teilband 2: Die Universität im 20. Jahrhundert
Innsbruck: innsbruck university press 2019, 567 Seiten.
Noch immer gehört die Universitätsgeschichte zu den vernachlässigten Subdisziplinen der Geschichtswissenschaft, die zumeist dann Interesse weckt, wenn ein runder Jahrestag (in der Regel alle 25 oder 50 Jahre) vor der Tür steht und es der Hochschule mit einem Mal unumgänglich erscheint, durch einen Rückblick auf die institutionelle Eigengeschichte sich ihrer selbst und ihrer Rolle in Staat und Gesellschaft zu vergewissern. Dies trifft auch auf das vorliegende Werk zu, das im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck anlässlich des 350. Gründungsjubiläums entstanden ist. Der hier besprochene Teilband Die Universität im 20. Jahrhundert ist der zweite von insgesamt drei Bänden, die sich der Innsbrucker Hochschulgeschichte von 1669 bis 2019 annehmen. Es ist den Herausgeber*innen hoch anzurechnen, dass sie der wechselvollen Vergangenheit der Tiroler Universität im 20. Jahrhundert einen eigenen Band gewidmet haben und diese aus einer vorbehaltlosen, durchaus selbstkritischen Perspektive heraus betrachten. Schließlich ist es ja gerade diese von politischen wie gesellschaftlichen Umbrüchen geprägte Epoche der Universität, die mit Ausnahme weniger Einzelstudien – etwa von Michael Gehler1 – bislang nur wenig Aufmerksamkeit gefunden hat.
Das von Ina Friedmann und Dirk Rupnow verfasste Werk gliedert sich in sechs Teile, die den Zeitraum vom Ende des Ersten Weltkrieges bis zur aktuellen Gegenwart umfassen. Auf eine Einleitung verzichtend, setzt die Studie direkt mit dem Verlust Südtirols an Italien ein, was bei den Leser*innen einiges an Vorwissen beziehungsweise die Bereitschaft zur Dekontextualisierung voraussetzt. Es ist anzunehmen, dass die Herausgeber*innen auf diese Weise einen nahtlosen Übergang vom ersten zum zweiten Teilband schaffen wollten.2 Da dem Rezensenten allerdings nur der zweite Teilband zum 20. Jahrhundert vorlag, konnte er diese Vermutung nicht überprüfen und fühlte sich beim Einstieg in die durchaus spannende Lektüre von den Verfasser*innen beziehungsweise. den Herausgeber*innen allein gelassen. So wurde leider nicht klar, was denn eigentlich das Ziel der Darstellung ist, welche Fragestellungen und methodischen Überlegungen dem Band zugrunde liegen oder warum man sich für ein solches Vorgehen entschieden hat.
Nachdem im ersten Kapitel die Rolle der Universität im Kampf um die Einheit Tirols geschildert wird, widmet sich das zweite Kapitel detailliert den 1920er und beginnenden 1930er Jahren, wobei die hier behandelten Schlaglichter ein breites Spektrum von politisch-ideologischen, aber auch wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und studentischen Themen abdecken. Das dritte Kapitel bildet sodann quasi das Vorspiel zum Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich und geht insbesondere auf den Austrofaschismus ein, indem etwa politische Eingriffe in das österreichische Hochschulwesen (zum Beispiel hinsichtlich des Universitätsrechts oder in Bezug auf politische Berufungen beziehungsweise Entlassungen) thematisiert werden. Das vierte und zugleich umfangreichste Kapitel ist freilich dem Nationalsozialismus und seinen Auswirkungen auf die Tiroler Hochschule vorbehalten. Erkennbar wird hier an den ausgewählten Themenfeldern – unter anderem Widerstand, Verfolgung, „Säuberung“ der Dozenten- und Studierendenschaft, Kooperation von Wissenschaft und Staat, Kriegsalltag und Bombenschäden –, dass die Verfasser*innen beim Abfassen ihrer Studie eine ausgewogene wie umfängliche Darstellung ihrer Alma Mater im Blick hatten, in der zahlreiche Aspekte der institutionellen Eigengeschichte während dieser „kritischen Phase“ gleichberechtigt nebeneinander stehen sollen. Um es vorwegzunehmen: Dieser heterogene – und dadurch abwechslungsreiche – Zuschnitt ist absolut gelungen! Auch am fünften Kapitel, das mit dem Titel „Entnazifizierung, Kontinuität und Schlussstrichmentalität“ überschrieben ist und den Zeitraum von 1945 bis 1960 abdeckt, wird dies deutlich. Wie schon in den vorangegangenen Kapiteln beschränkt sich die Analyse nicht auf eine reine Binnenperspektive, sondern erlaubt an exemplarischen Beispielen einen Blick „von außen“ auf die Universität. Der sechste Teil schließlich untersucht die Entwicklung der Hochschule bis in die unmittelbare Gegenwart und behandelt wiederum ein buntes Potpourri an Themen – darunter den freien Zugang zur Hochschule, deren räumlichen Ausbau sowie die akademische Erinnerungsund Gedenkkultur. Aber auch eher randständige Themen wie die Suche nach den verschwundenen Insignien der Karls-Universität Prag finden in diesem abschließenden Teil Erwähnung.
Der Teilband bietet somit vielfältige Perspektiven auf eine interessen-, spannungs- und konfliktreiche Phase der Leopold-Franzens-Universität, ohne dabei die Bedürfnisse der Leser*innen aus dem Blick zu verlieren. Immerhin ist die Lektüre einer so stattlichen Darstellung zweifellos auch eine Herausforderung an die Kondition der Lesenden. Die zahlreichen Abbildungen sorgen jedoch für eine hohe Anschaulichkeit und der von jeglichem Ballast befreite Anmerkungsapparat fügt sich hervorragend in den Lesefluss ein. Zugleich ist der letztgenannte Punkt aber auch einer der größten Schwachpunkte der Studie, da die Verfasser*innen leider keine Einbettung ihrer Erkenntnisse in einen gesamtösterreichischen Zusammenhang vornehmen und darüber hinaus weitgehend auf aktuelle Forschungsarbeiten zur deutschen wie österreichischen Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte im 20. Jahrhundert verzichten. Das Fehlen eines Quellen- und Literaturverzeichnisses erschwert die Arbeit mit dem Band zudem unnötigerweise. Anhand der genannten Monita wird deutlich, dass die wissenschaftliche Beschäftigung mit der Universitätsgeschichte noch immer zu sehr vom „Verwertungskontext“ Hochschuljubiläum abhängig ist. Dies liegt in erster Linie an dem modernen, als Massenveranstaltung konzipierten Eventcharakter akademischer Jubelfeiern, wodurch die wissenschaftliche Beschäftigung mit der eigenen Vergangenheit zur Nebensache und eine jubiläumsunabhängige Verstetigung der Universitätsgeschichte überdies verhindert wird.3 Vielleicht ist der Teilband auch deshalb weniger an ein hochschulhistorisch versiertes Fachpublikum, als vielmehr an eine regionale Leserschaft adressiert, die sich vorrangig für die Innsbrucker Universitätsgeschichte interessiert. Und für diese Zielgruppe ist das vorliegende Werk bestens geeignet.
Martin Göllnitz
_________________________________
![]()
Fabian Frommelt/Florian Hitz/Michael Kasper/Christof Thöny (Hg.), Das Jahr ohne Sommer. Die Hungerkrise 1816/17 im mittleren Alpenraum
(Schriftenreihe des Arbeitskreises für interregionale Geschichte des mittleren Alpenraumes 4), Innsbruck: Universitätsverlag Wagner 2017, 166 Seiten, 25 s/w-Abbildungen.
Der Sammelband fasst die Ergebnisse von neun Referaten zusammen, die im November 2016 an einer Tagung des Arbeitskreises für interregionale Geschichte des mittleren Alpenraums in Chur gehalten wurden. Der „mittlere Alpenraum“ umfasst im Wesentlichen die Kantone St. Gallen und Graubünden, das Fürstentum Liechtenstein und das Bundesland Vorarlberg. Die meisten Verfasser sind ausgebildete Historiker, die im Schuldienst, in der Kultur oder in der Verwaltung tätig sind. Jeder Beitrag sollte einen besonderen thematischen Schwerpunkt herausgreifen.
Der Saarbrückner Frühneuzeithistoriker Wolfgang Behringer liefert den Überblick und den Einstieg zum Thema, wobei er sich auf seine 2016 publizierte Synthese zur Tambora Krise stützt. Nicht alle Autoren hielten es für nötig, die Frage aufzuwerfen, inwieweit ihre Ergebnisse, abgesehen vom regionalen Geschehen die in der Literatur greifbaren Kenntnisse dieser Krise bereichern. Hansjakob Gabathuler geht in seiner Darstellung zur Ostschweiz kaum über die Ergebnisse hinaus, die Daniel Krämer in seiner bahnbrechenden Monographie 2015 publiziert hat1. Dasselbe gilt für den Beitrag von Adolf Collenberg zu Graubünden, der kaum Neues bringt.
Paul Eugen Grimm stützt sich für seinen Aufsatz zu den Verhältnissen im Unterengadin auf das Tagebuch von Rosius à Portas, des Gründers des bekannten Bildungsinstituts im Unterengadiner Dorf Ftan. Obschon die meteorologischen Verhältnisse dort nicht besser waren als in anderen Teilen des Alpenraums, mussten die dortigen Bewohner den Gürtel nur wenig enger schnallen, da in Dörfern wie Ramosch und Tschlin offenbar genügend Getreide produziert wurde, um das talaufwärts gelegene Ftan mit zu versorgen. Im Februar und März stiessen Lawinen an verschiedenen Orten wiederholt bis an den Inn hinunter vor, was auf extreme Verhältnisse hindeutet.
Paul Vogt hat seinen Beitrag zur Situation im Fürstentum Liechtenstein historisch eingeordnet. Dabei hilft ihm der Vergleich zweier Gemeinden, das Typische herauszufiltern und seine Ergebnisse zu plausibilisieren. Er setzt als einziger einen mit zahlenreichen Grafiken belegten demografischen Schwerpunkt. Wesentlich ist das Ergebnis, dass in Hungerjahren vor allem der Anteil der älteren Leuten an den Verstorbenen anstieg. Ein weiterer Schwerpunkt thematisiert das Krisenmanagement der katholischen Kirche.
Innovativ ist der anschaulich illustrierte Beitrag von Michael Kasper zur religiösen Bewältigung des Lawinenfrühlings 1817 in Vorarlberg. Namentlich gilt dies dem Nachweis von 13 Tage anhaltenden Schneefällen im April 1817, die meterdicke Schneemassen ablagerten und zahlreiche verheerende Lawinen auslösten. Diese Ergebnisse tragen dazu bei, die Ursachen des lang andauernden extremen Hochstandes des Bodensees im Sommer 1817 zu erklären. Ferner befasst sich Kasper ausführlich mit Elementen der religiösen Erinnerungskultur. Die Geistlichen reagierten auch pragmatisch auf die Lawinenkatastrophen, indem sie öffentliche Sammlungen zugunsten der betroffenen Familien organisierten.
Im vorarlbergischen Klostertal liess die Krise nach der Schilderung von Christof Thöny angeblich die Wilderei ansteigen, indem (im Sommer) 1817 nur noch wenig Rotwild gezählt wurde. Neben der Wilderei wäre allerdings auf die extremen Schneemassen hinzuweisen, die zahlreiche Tiere verhungern oder durch Raubtiere umkommen liessen, wie dies die Wildforschung anhand weniger extremer Schneewinter im 20. Jahrhundert nachgewiesen hat. Bei Thönys Schilderung der demografischen Verhältnisse vermisst man den ausdrücklichen Verweis auf die entsprechenden, weit besser belegten Ergebnisse von Krämer.
Sabine Sutterlütti hat die frühen Sammlungen für Katastrophengeschädigte in Vorarlberg unter die Lupe genommen. Bemerkenswert ist die aufwändige und zeitraubende Bürokratisierung der Katastrophenhilfe in der K u K Monarchie des 19. Jahrhunderts, ganz abgesehen davon, dass die Geschädigten mit den schliesslich ausbezahlten paar Batzen nur einen Bruchteil ihres Schadens decken konnten. Pragmatischer und zielführender war die Praxis in der Schweiz, wie ein Blick in das vom Rezensenten 2002 herausgegebene Buch gezeigt hätte.2
Jürg Simonett hat den seinerzeit von ihm postulierten Zusammenhang zwischen dem Strassenbau in Graubünden und der Hungerkrise kritisch unter die Lupe genommen und kommt zu einem negativen Ergebnis.
Wie bei Tagungsbänden üblich, die von vielen Autoren herausgegeben werden, fehlt es an einem Überblick zum Thema, in dem herausgestellt wird, inwieweit die publizierten neun Artikeln der Tagungsreferenten und -referentin unsere Kenntnisse des Themas ergänzen und bereichern. Zu den Aufgaben regionalgeschichtlicher Forschungen sollte es gehören, regionale und lokale Besonderheiten herauszuarbeiten und diese mit dem aus der allgemeinen Literatur Bekannten zu vergleichen. Für Historiker aus anderen Regionen ist dieser Aspekt wesentlich.
Christian Pfister
_________________________________
![]()
Anna Grillini, La guerra in testa. Esperienze e traumi di civili, profughi e soldati nel manicomio di Pergine Valsugana (1909–1924)
(Quaderni dell’Istituto storico italo-germanico 102), Bologna: il Mulino 2018, 227 pagine.
Il volume di Anna Grillini pone un tassello fondamentale nella complessa trama della storia dell’intervento psichiatrico durante la Grande Guerra. Le fonti analizzate per la ricerca – che comprendono 2942 cartelle cliniche prodotte nel Manicomio provinciale tirolese di Pergine Valsugana dal 1909 al 1919, 280 cartelle cliniche di degenti trentini trasferiti nell’Imperial-regio Istituto dei mentecatti di Hall (Psychiatrisches Krankenhaus Hall in Tirol) durante il periodo di chiusura della struttura di Pergine Valsugana, documentazione di archivi locali e dell’Archivio centrale dello Stato – restituiscono uno scenario di particolare interesse ponendo in stretta relazione la storia dei due ospedali psichiatrici e in generale la storia della psichiatria italiana e austriaca. Il passaggio del Trentino dall’Impero austro-ungarico all’Italia nel 1919 segnò infatti un cambio di amministrazione che dal punto di vista storico permette un efficace confronto tra le prassi dei du...