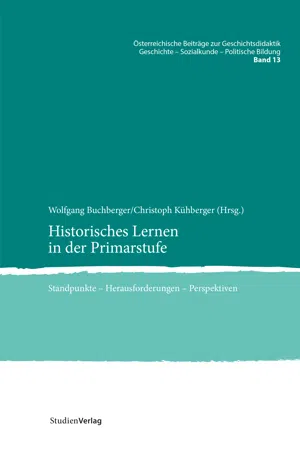![]()
Historisches Lernen mit Schulbüchern
Wolfgang Buchberger
Ausgehend von der Frage, welchen Beitrag Schulbücher für das historische Lernen – auch in der Primarstufe – leisten können, wird im Folgenden zuerst (1) der Begriff des historischen Lernens näher beleuchtet, bevor anschließend den Fragen nachgegangen wird, (2) wie frühes historisches Lernen in der Primarstufe aussehen kann und (3) welche Rolle Schulbücher dabei spielen (sollten). Danach (4) werden Ergebnisse einer kategorialen Analyse aller österreichischen Sachunterrichtsbücher (n=35) präsentiert, die sich dem Einsatz von schriftlichen Quellen in den Lehrwerken zum Sachunterricht widmete. Am Ende (5) werden in Form eines Resümees die wesentlichen Punkte dieses Beitrags zusammengefasst.
1. Historisches Lernen
Es soll hier mit diesem zentralen Begriff gestartet werden, da es zum einen gar nicht immer so klar ist, was genau unter historischem Lernen verstanden wird. Zum anderen ist es im Rahmen einer Schulbuchanalyse, die grundgelegte Möglichkeiten historischen Lernens untersuchen möchte, unumgänglich, normative Gesichtspunkte historischen Lernens zu benennen,1 die Aufschluss darüber geben, welche Ziele denn eigentlich erreicht werden sollen.2
Speziell mit Blick auf den Umgang mit schriftlichen Quellen im schulischen Unterricht postuliert Pandel als Ziel des historischen Lernens im Geschichtsunterricht: „Historisch denken zu lernen.“3 Aber was genau bedeutet es, historisch zu denken und wie kann man es lernen? Welche konkreten Operationen historischen Denkens sind für die Untersuchung des Umgangs mit Textquellen in Schulbüchern relevant?
In der Geschichtsdidaktik als „Wissenschaft vom historischen Lernen“4 besteht Einigkeit darüber, dass es im Geschichtsunterricht5 um mehr gehen muss als die Vermittlung auswendigzulernender Wissensbestände über die Vergangenheit. Als Ziel wird vielmehr die Förderung und Entwicklung eines reflektierten und (selbst-)reflexiven Geschichtsbewusstseins ausgewiesen. Vor bereits mehr als 40 Jahren sieht Jeismann als den Kern der geschichtsdidaktischen Wissenschaftsdisziplin das „Geschichtsbewusstsein in der Gesellschaft“6. Geschichtsbewusstsein ist für ihn der innere „Zusammenhang von Vergangenheitsdeutung, Gegenwartsverständnis und Zukunftsperspektive“7.
Auch Rüsen fordert die Hinwendung zum Geschichtsbewusstsein als „Basis allen historischen Lehrens und Lernens“8:
„Die oberste Qualifikation, die durch das historische Lernen erreicht werden soll, ist eben die Fähigkeit des Geschichtsbewußtseins, Sinn über Zeiterfahrung bilden zu können, um sich erfahrungsgestützt im Zeitverlauf der eigenen Lebenspraxis absichtsvoll orientieren zu können. Um eben dieser Fähigkeit willen, wird das Geschichtsbewußtsein in den mühsamen Prozessen menschlicher Individuierung und Sozialisation ausgebildet. Dieses oberste Lernziel, diese fundamentale Qualifikation, läßt sich in präziser Zuspitzung auf das, was es grundsätzlich heißt, historisch zu lernen, als ‚narrative Kompetenz‘ bezeichnen.“9
Geschichtsbewusstsein ist hier als „Inbegriff der mentalen Operationen“10 oder Bewusstseinstätigkeiten eines jeden Individuums zu verstehen, um sich über sinnbildende Zeiterfahrung11 im Umgang mit den Zeitebenen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu orientieren, indem es „sich auf Vergangenheit und Zukunft bezieht und beide in ein Verhältnis setzt“12. Zentral für dieses anthropologische Bedürfnis, sich zu orientieren,13 für diese „Grundausstattung menschlichen Denkens“14 ist laut Rüsen das historische Erzählen. Für ihn lässt sich historisches Lernen „als Bildung von Geschichtsbewusstsein durch Erzählen thematisieren“15.Dahinter steht die narrativistische Geschichtstheorie. Grundlegend dabei ist einerseits, dass historische Erkenntnis in Form von Geschichte immer eine narrative Struktur aufweist, also erzählt wird,16 und andererseits die erkenntnistheoretische Unterscheidung zwischen Vergangenheit und Geschichte.
Kommt man wieder zurück zu Rüsens Definition von historischem Lernen als Befähigung des Geschichtsbewusstseins durch Erzählen, so bildet den Hintergrund dafür das vielfach rezipierte theoretische Modell historischen Denkens. Ausgehend von Orientierungsbedürfnissen in der Gegenwart aufgrund von Kontingenzerfahrungen wird fragend die Vergangenheit (methodisch fundiert) erschlossen, um durch „narrativ geformten Sinn“17, also Orientierung stiftende Darstellungen, die Vergangenheit auf Gegenwart und Zukunft zu beziehen (als Beitrag eines gegenwärtigen Diskurses).18 Da für die Operationen des historischen Denkens das Geschichtsbewusstsein zuständig ist, „verstanden als Komplex von Dispositionen, Prozessen und Fähigkeiten im und zum ‚Umgang‘ mit Geschichte“19, zielt historisches Lernen auf die Entwicklung eines reflektierten und (selbst-)reflexiven Geschichtsbewusstseins. Dieses kann durch schulischen Unterricht gefördert, entwickelt und elaboriert werden. Somit ist historisches Lernen deutlich ausgerichtet auf die Fähigkeiten historischen Denkens, wozu es im deutschsprachigen und im internationalen Diskurs weitgehende Übereinstimmung gibt.20 Ziel ist es dabei, Lernende dazu zu befähigen, sich eigenständig und begründet, selbstbestimmt und selbstverantwortet21 in der Zeit zu orientieren. Dies meint ausdrücklich Orientierung durch „sinnbildende Zeiterfahrung“ im Sinne der Theorie historischen Denkens, charakterisiert durch die Basisoperationen der De- und Re-Konstruktion,22 und nicht bloß Orientierung in der Vergangenheit.
Kompetenzmodelle geben davon abgeleitet Antwort auf die Frage, wie die Zentralkategorie des Geschichtsbewusstseins in Form von Kompetenzen historischen Denkens operationalisiert werden kann, welche Fähigkeiten, Fertigkeiten und Bereitschaften also notwendigerweise für historische Orientierungsprozesse grundgelegt werden müssen.23
2. Historisches Lernen in der Primarstufe
Lange Zeit hielten sich aufgrund von später als solchen bezeichneten „tradierten Scheinwahrheiten“24 generelle Vorbehalte gegen historisches Lernen in der Primarstufe. Kinder im Primarstufenalter wären mit historischem Lernen psychisch und kognitiv überfordert und somit schlichtweg dazu nicht in der Lage, da sie „noch kein Verständnis für historische Zusammenhänge und für Geschichte als solche (was immer das sein mag) aufbringen“ könnten und „‚der Geschichte‘ überfordert und unverständig gegenüber“ stünden.25 Diese „Verfrühungsthese“ historischen Lernens26 hielt sich sehr lange „infolge älterer, stufenbezogener Entwicklungstheorien und der damit einhergehenden, als gering erachteten Chancen und Möglichkeiten für elaboriertes Lernen im Elementar- und Primarbereich“.27 Beispielhaft angeführt sei an dieser Stelle Friedrich Gärtner: „Das Kind [in der Primarstufe; Anm.] ist noch nicht reif, ‚Geschichte‘ zu erfassen, also müssen wir uns damit begnügen, ihm ‚Geschichten‘ darzubieten.“28
Stufungs- und Reifungstheorien konnten mittlerweile wissenschaftlich widerlegt werden, psychologische Vorbehalte gegen frühes historisches Lernen aufgrund der Annahme von entwicklungsstadientypischen „Einschränkungen des Denkens“29 lassen sich demnach unter Berücksichtigung der vielen kritischen Befunde durch Forschungsergebnisse nicht mehr aufrechterhalten. Nicht ein vermeintlicher (lebensalterbedingter) Entwicklungsstand ist entscheidend für erfolgreiches Lernen, sondern individuelles Vorwissen und die Verfügbarkeit von Begriffen, um weitere Begriffe zu verstehen und somit neue Kenntnisse in den je eigenen Wissensstrukturen zu verankern.30 Bei Kindern bereits vorhandene „naive“ Theorien können dadurch im Sinne des „conceptual change“ aufgegriffen und weiterentwickelt werden.31
Was bedeutet dies jedoch für historisches Denken, für analytische und reflexive domänenspezifische Denkprozesse, für die das Verständnis von Metakonzepten wesentliche Voraussetzung ist?32 Die neuere entwicklungspsychologische Forschung verweist darauf, „dass die grundlegenden begrifflichen Voraussetzungen für ein konstruktivistisches Verständnis von Wissenschaft schon im Grundschulalter vorhanden sind“.33 Dies ist insofern relevant, als die Ergebnisse „auf die Möglichkeiten zur Vermittlung epistemologischer Grundbegriffe im Grundschulalter hinweisen, die für das Verständnis des Zusammenhangs von Interpretation und Evidenz zentral sind“.34
Zusammeng...