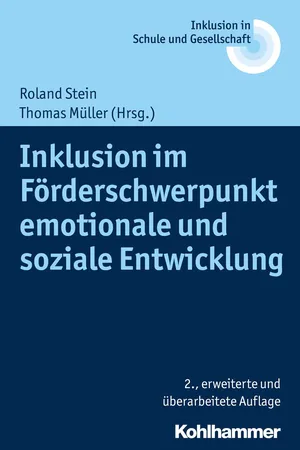![]()
Evidenzbasierte Praxis im Förderschwerpunkt emotional-soziale Entwicklung
Clemens Hillenbrand
Evidenzbasierte Praxis meint die Ausrichtung des Handelns an überprüften und wissenschaftlich fundierten Maßnahmen bezogen auf die spezifische, professionelle Situation. Seit der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung, die reale Verbesserungen für Personen mit Benachteiligungen und Behinderungen verlangt, stellt sich die Frage des wirksamen Handelns und der effektiven sonderpädagogischen Unterstützung (Kultusministerkonferenz, 2011) dringlicher denn je: Welche Vorgehensweisen und Handlungsmöglichkeiten lassen tatsächlich eine positive Wirkung erwarten? Der Begriff »Evidenzbasierung«, aus der medizinischen Forschung übernommen, drückt generell die Anforderung an Vorgehensweisen, Methoden, Verfahren und Programme aus, bestimmten wissenschaftlichen Überprüfungen Stand zu halten und dabei zu positiven Wirkungen zu führen. Evidenzbasierung als Anforderung wird in der deutschsprachigen Sonderpädagogik bisher wenig thematisiert und nur selten werden Studien zur Überprüfung nach den Kriterien durchgeführt.
Die Grundlagen und Kriterien für Evidenzbasierung werden im folgenden Beitrag geklärt, bevor ein Überblick über die Verfahren geboten wird, die den Kriterien zumindest näherungsweise genügen. In der internationalen, englischsprachigen Forschung stellt die Ausrichtung an einer evidenzbasierten sonderpädagogischen Praxis jedoch einen breit akzeptierten Standard dar, der als Auswahlkriterium für sonderpädagogische Vorgehensweisen dient. Für den Einsatz evidenzbasierter Verfahren in inklusiven Bildungssystemen ist jedoch ein schlüssiges Rahmenkonzept notwendig, das eine den Bedürfnissen der Lernenden gemäße und wirksame Unterstützung bietet. Das international anerkannte Rahmenkonzept eines responsiven Handlungsmodells (Response-to-Intervention) entspricht nach den vorliegenden Studien diesen Anforderungen. Evidenzbasierte Verfahren der emotionalen und sozialen Entwicklung, die in diesem Rahmen genutzt werden können, lassen sich zwei verschiedenen Grundkonzeptionen zuordnen: erstens die klar strukturierte, unterstützende Gestaltung der Lernumgebung und zweitens die gezielte Vermittlung emotionaler und sozialer Kompetenzen. Als Schlussfolgerung ist festzuhalten, dass evidenzbasierte Unterstützung ein Gesamtkonzept darstellt, das wissenschaftliche Standards mit den praktischen Anforderungen an konkrete Handlungsmöglichkeiten verbindet. International besteht Konsens darin, dass erst durch den Einsatz evidenzbasierter Verfahren in einem wirksamen Rahmenkonzept tatsächlich das Recht auf inklusive Bildung, nämlich eine den Bedürfnissen angemessene Unterstützung, verwirklicht werden kann. Letztlich profitieren davon auch die pädagogischen Fachkräfte.
1 Einführung
Der Auftrag zur inklusiven Bildung gemäß UNESCO und UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung fordert eine wirksame Unterstützung für alle Lernenden gemäß ihrer Bedürfnisse (United Nations, 2006, §24; Hillenbrand, 2012) – institutionelle oder schulorganisatorische Fragen werden, sofern sie nicht systematisch von Teilhabe ausschließen, hingegen nicht angesprochen, sondern liegen in der Hoheit der Unterzeichnerstaaten (Bielefeldt, 2010; Riedel, 2008). Damit bildet die nachgewiesene Wirksamkeit von Maßnahmen der Erziehung und Bildung einen Schlüssel zur Verwirklichung von Inklusion.
Daraus resultieren brisante Konsequenzen, die bisher wenig diskutiert werden. Wie lässt sich die Wirksamkeit prüfen? Sind alle sonderpädagogischen Maßnahmen zur Unterstützung emotionaler und sozialer Prozesse positiv wirksam und in gleichem Maße? Muss die Wirksamkeit differenziert für spezifische Situationen eingeschätzt werden? Bedeutet die nachgewiesene Wirksamkeit die Verpflichtung zum Einsatz, also eine Quasi-Technologie? Wenn keine Erkenntnisse über die Wirksamkeit einer Maßnahme vorliegen – wie ist dann vorzugehen? Solche Fragen sind keineswegs banal, sondern treffen in den Kern des Förderschwerpunkts emotionale und soziale Entwicklung sowohl für die Forschung als auch für die Praxis. Das Programm einer evidenzbasierten Praxis möchte Hilfen zur Beantwortung dieser Fragen bieten.
2 Das Grundproblem: zur Kausalität pädagogischen Handelns
Zur Klärung der Wirksamkeit sonderpädagogischen Handelns stellt sich ein grundsätzliches Problem, das im Diskurs der analytischen Erziehungsphilosophie (Oelkers, 2001) herausgearbeitet wurde: Erziehung stellt immer ein Versuchshandeln dar, das eine Wirkung intendiert und erzielen will, aber die Wirksamkeit des eigenen Handelns nicht in der Hand hat. »Die pädagogische Intention garantiert nicht die Wirksamkeit der Handlung. Die Absicht des Pädagogen kann erfüllt werden, aber das pädagogische Handeln kommt lediglich einem Versuchen gleich« (Oelkers, 1984, S. 29, H.i. O.). Und: »Es ist nicht kausal im Sinne einer naturwissenschaftlichen Kausalität und kann also auch nicht mit einer technologischen Verknüpfung zwischen ›Intention‹ und ›Wirkung‹ rechnen« (ebd., S. 29f.). Niklas Luhmann bescheinigte der Erziehung denn auch ein Technologiedefizit (Kiper, 2007).
Ist damit jede Bemühung um möglichst wirksames sonderpädagogisches Handeln von vornherein obsolet und sinnlos? Wenn einerseits dieses Defizit konstatiert wird, heißt das andererseits nicht, dass es nach Kiper keine Bemühungen um die Annäherung an möglichst wirksame, erfolgreiche Handlungsformen geben sollte (ebd.). Gerade die Aufgabe sonderpädagogischer Unterstützung im Rahmen inklusiver Bildungssysteme (Kultusministerkonferenz, 2011) erfordert eine wissenschaftlich fundierte Aussage über die Wirksamkeit der genutzten Maßnahmen: »Persons with disabilities receive the support required, within the general education system, to facilitate their effective education« (United Nations, 2006, § 24, 3d; Hervorhebung C.H.). Die notwendigen und nachgewiesenermaßen wirksamen Maßnahmen (»effective«!) sind in einem inklusiven Bildungssystem also für die Lernenden im allgemeinen Bildungssystem verfügbar. Interessanterweise taucht in der UN-Konvention keine Aussage zu den Organisationsformen auf, formuliert wird hingegen dieser Anspruch auf tatsächlich wirksame Unterstützung, auf die insbesondere Lernende unter benachteiligenden und behindernden Bedingungen Anspruch haben (Bielefeld, 2010). Dieser Anspruch lässt sich vernünftiger Weise auch kaum bestreiten. Zahlreiche Veröffentlichungen versuchen mit der Publikation und Hervorhebung von ›best practice‹-Beispielen Hilfen für eine wirksame Unterstützung zu bieten: Als prominentes Beispiel lässt sich die Verleihung des Jakob-Muth-Preises für inklusive Schulmodelle durch die Bertelsmann-Stiftung verstehen.
Selten jedoch werden die hervorgehobenen und ausgezeichneten Modelle einer wissenschaftlichen Prüfung der Wirksamkeit unterworfen und so bleiben die Kriterien für ›best practice‹ sehr stark von der Qualität der Darstellung, den persönlichen Einschätzungen und Werturteilen abhängig. Diese Unbestimmtheit dessen, was ›best practice‹ nun eigentlich ausmacht, ist wissenschaftlich ungenügend und auch für die Praxis nicht hinnehmbar (Cook/Tankersley/Cook/Landrum, 2008). Das Problem wird durch die Einsetzung von Kommissionen nicht geringer und so herrscht ein buntes Angebot an ›best practice‹-Beispielen im gesamten pädagogischen Feld, die auch politische Entscheidungen beeinflussen können. Wissenschaftlich-empirische Standards sind jedenfalls nicht anzutreffen.
Die internationale wissenschaftliche Diskussion wie auch die Bildungspolitik anderer Staaten hat daher empirisch fundierte Anforderungen formuliert und legt durchgehend strengere Kriterien an. Hierfür kann die Bildungspolitik der US-Regierungen als Beispiel stehen: Der No Child Left Behind Act von 2001 fordert die sonderpädagogische Unterstützung durch solche Maßnahmen, die durch wissenschaftlich fundierte Forschung überprüft und durch nachvollziehbare Studien als nachgewiesenermaßen wirksam belegt wurden (Cook et al., 2008, S. 70). Die Forderungen werden bestätigt im Individuals with Disabilities Education Improvement Act von 2004, der zugleich die Notwendigkeit der Ausbildung von Lehrkräften in solchermaßen überprüften Handlungsformen fordert (ebd.). Verfahren, die diesen Anforderungen entsprechen, sind evidenzbasierte Verfahren: Sie erhöhen gewissermaßen die Wahrscheinlichkeit, tatsächlich eine positive Wirkung auszulösen, auch wenn sie es nicht garantieren können. Evidenzbasierung stellt damit einen probabilistischen, keinen technologischen Zugang zum Problem pädagogischen Handelns dar.
Wenn also die Kriterien für evidenzbasiertes Vorgehen international definiert sind, müsste sich ein Korpus von Verfahren identifizieren lassen, die diesen Kriterien genügen. Welche Konsequenzen für das praktische Handeln sind daraus zu ziehen? Ist folglich der (quasi-technologische) Einsatz der wissenschaftlich ermittelten Verfahren – verkürzt gesagt: der handelnde Sonderpädagoge als Anwender wissenschaftlich aufbereiteter Techniken zur Behebung psychosozialer Defizite – der Sinn von evidenzbasierter Praxis im Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung?
3 Das Programm evidenzbasierter Praxis
Den Einsatz von Maßnahmen und Vorgehensweisen in Handlungsfeldern der Medizin, Psychologie und Pädagogik, deren Wirkungen durch wissenschaftlich fundierte Forschung überprüft wurde, nennt die internationale wissenschaftliche Diskussion »evidence-based practices« (Freeman/Sugai, 2013, S. 6; Fuchs/Fuchs/Compton, 2012; McLeskey/Waldron, 2011). Eine einfache Übersetzung in den Terminus »evidenzbasierte Praxis« in deutscher Sprache birgt ein grundlegendes Problem: Der deutsche Ausdruck ›evident‹ meint »offenkundig und klar ersichtlich« (Duden Fremdwörterbuch, 1982, S. 232), folglich keiner weiteren Überprüfung zu unterziehen. Die deutschsprachige Bedeutung bildet damit ziemlich genau das Gegenteil vom englischsprachigen ›evidence‹, nämlich »facts or information indicating whether a belief or proposition is true or valid« (Oxforddictionaries, 2013). Evidenzbasierte Praxis meint also operationalisierte, replizierbare Handlungsformen, die einer kritischen Prüfung durch wissenschaftliche Forschung unterzogen wurden und daher belegbare, nachgewiesene Fakten ihrer positiven Wirksamkeit vorlegen können.
Das Programm evidenzbasierten Handelns und das zugrundliegende Axiom stammt aus der Medizin und geht von der Wertschätzung empirischer Wirkungsforschung aus, die zu einem grundlegenden Verständniswandel der Therapie in der Medizin führt: weg von den Lehrmeinungen anerkannter Autoritäten hin zu empirisch kritisch überprüften Heilverfahren. Zurhorst spricht von einem Wandel der Therapie von medizinischen Schulen zu kritischer Forschung, gewissermaßen weg von »eminenzbasierter« hin zu »evidenzbasierter« Behandlung (Zurhorst, 2003, S. 98).
Dieser grundlegende Wandel medizinischen Selbstverständnisses geht insbesondere auf die Autorengruppe um Sackett zurück, die erst in diesem Schritt die konsequente Nutzung wissenschaftlicher Erkenntnisse für die bestmögliche medizinische Behandlung für den einzelnen Klienten sieht. Evidenzbasierte Medizin (EbM) »ist der gewissenhafte, ausdrückliche und vernünftige Gebrauch der gegenwärtig besten externen, wissenschaftlichen Evidenz für Entscheidungen in der medizinischen Versorgung individueller Patienten. Die Praxis der EbM bedeutet die Integration individueller klinischer Expertise mit der bestverfügbaren externen Evidenz aus systematischer Forschung« (Sackett/Rosenberg/Gray/Haynes/Richardson, 1997, S. 644). Diese bis heute meist zitierte Definition für Evidenzbasierung betont einerseits die individuelle Expertise der Professionellen und andererseits die Orientierung an kritischer, wissenschaftlicher Forschung. Es ist also keineswegs eine technologische, rezeptartige, nach »Kochbuch« vorgehende Therapie, sondern die Suche nach einer verantwortlichen, transparenten Entscheidungsfindung für die dem Klienten geeignetste Maßnahme.
Gefordert ist also die Verbindung der fachlichen Expertise des Professionellen bezogen auf den Einzelfall mit dem besten, verfügbaren wissenschaftlichen Wissen. Gegenüber manchen Vorwürfen meint Evidenzbasierung also keineswegs eine standardisierte, vielleicht noch nach Kostenersparnis normierte Vorgehensweise, die ohne Rücksicht auf den Adressaten eingesetzt wird. Vielmehr drückt das mit dem Begriff Evidenzbasierung gemeinte Programm das eigentlich selbstverständliche Anliegen aus, auf der Basis professioneller Expertise und Erkenntnis des konkreten Einzelfalls nach dem besten wissenschaftlichen Erkenntnisstand zu handeln. Nutzt die Praxis der Sonderpädagogik so weit wie möglich solche Vorgehensweisen, wie es die internationale sonderpädagogische Forschung (Fuchs/Fuchs/Compton, 2012; McLeskey/Waldron, 2011) sowie auch die bildungspolitische Diskussion (UNESCO, 2010) im breiten Konsens fordern, und setzt sie mit Hil...