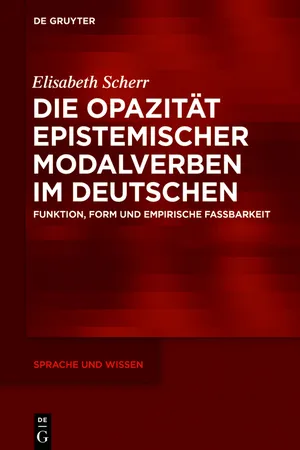1Einleitung
Ich kann wissen, was der Andere denkt, nicht was ich denke. Es ist richtig zu sagen ‚Ich weiß, was du denkst‘, und falsch: ‚Ich weiß, was ich denke‘.
(Eine ganze Wolke von Philosophie kondensiert zu einem Tröpfchen Sprachlehre.)
(Ludwig Wittgenstein)
Das primäre Forschungsinteresse, das als auslösender Faktor zur Entwicklung der vorliegenden Arbeit gesehen werden kann, ist im Bereich der Variationslinguistik angesiedelt. Nach intensiver Auseinandersetzung mit der regionalen Variabilität in der Grammatik des deutschen Gebrauchsstandards im Rahmen des Forschungsprojekts Variantengrammatik des Standarddeutschen1 stieß ich auf die Annahme, dass auch funktional-pragmatische Sprachhandlungsmuster, etwa zur Artikulation von Indirektheit oder Höflichkeit, Gegenstand regionaler Variation sein können. Den konkreten Anstoß bot der Lernzielkatalog des Österreichischen Sprachdiploms Deutsch für das staatlich anerkannte Prüfungssystem für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, entwickelt von Muhr (2000). Darin werden unter anderem Sprachhandlungen präsentiert, die in den unterschiedlichen Regionen des Deutschen in Form und Frequenz differieren würden (vgl. ebd.: 133ff.). Im Abschnitt Interkulturelle Unterschiede zwischen Österreich und Deutschland (ebd.: 141) wird etwa die Hypothese aufgestellt, dass „in Österreich generell ein anderer Gebrauch“ von „illokutionsmodifizierenden Elementen“ wie „Modalpartikeln, Adverbien und anderen modalen Elementen“ (ebd.) vorherrschen würde. „Österreichische Sprecher“ würden demnach „eher indirekte Formen der Kommunikation“ (ebd.) bevorzugen, darunter fiele unter anderem eine verstärkte Verwendung von indikativischen oder konjunktivischen Modalverben (im Folgenden: MVen). Neben anderen stereotypen Differenzen, die sich in dieser Publikation durch die nationale Unterteilung des deutschen Sprachgebiets motivieren, wird also auch die sprachliche (In-)Direktheit angeführt, die sich in den verschiedenen Regionen des deutschen Sprachraums unterscheiden würde. An anderer Stelle betont Muhr (1995: 233), dass „die österreichischen Sprecher dazu [tendieren], deutlich mehr gesichtsbewahrende Explikationen für entschuldigungsträchtige Verstöße zu verwenden“, während deutsche Sprecher/-innen2 „hochsignifikant dazu neigen“ würden, „sog. gesichtsbedrohende Explikationen“ zu verwenden. Hinter dem Konzept von „gesichtsbedrohenden Explikationen“ steht der theoretische Ansatz der Politeness3 von Brown und Levinson (2000), die als sprechhandlungssteuernden Einflussfaktor das Face beschreibt: Modalität und andere sprachliche Strategien (vgl. ebd.: 255ff.) dienen dazu, für Sprecher/-in und/oder Hörer/-in gesichtsbedrohende Situationen sprachlich zu ‚entschärfen‘ (vgl. ebd.: 19ff.). Muhr bringt demnach den Phänomenbereich der Modalität mit Indirektheit, Face-Saving und insbesondere mit nationalstaatlich unterschiedlichem kommunikativem Verhalten in Verbindung.
Diesen Annahmen zur diatopisch bedingten Variabilität der Kommunikationsstrategien fehlt bis dato jegliche quantitativ-empirische Basis. Wenn aber davon ausgegangen wird, dass sprachliche Handlungskonventionen, etwa die Verwendung von MVen, regionale Variabilität aufweisen, so müsste sich dies auch anhand von authentischem Sprachmaterial belegen lassen. Die Datengrundlage, die für die vorliegende Arbeit verwendet wird, entstammt dem Forschungsprojekt Variantengrammatik des Standarddeutschen. Darin enthalten sind rund 600 Millionen Wortformen, bestehend aus informationsorientierten Pressetexten wie Nachrichten oder Reportagen4 aus sämtlichen Voll- und Halbzentren des deutschen Sprachgebiets (für Details vgl. Kap. 6.). Zunächst war eine Überprüfung der Muhr’schen Annahmen in Bezug auf Modalität und MVen in diesem Großkorpus geplant. Bei informationsorientierten Pressetexten ist der Anspruch gegeben, einen vergleichsweise hohen Anteil an objektiver ‚Wahrheit‘, separiert von persönlicher Meinungsäußerung, vorzufinden. Die legislative Fixierung dieses Anspruchs findet sich in Deutschland im Bundesverfassungsgerichtsgesetz durch die Entscheidung, „dass die Presse schon um des Ehrenschutzes des Betroffenen willen zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung verpflichtet ist. […] Im Idealfall würde in jedem Medium nur die tatsächliche, objektive Wahrheit verbreitet“ (vgl. Heimann 2008: 88f.). In Österreich ist die „Wahrnehmung journalistischer Sorgfalt“ im Mediengesetz geregelt. In §§29ff. wird auf die Wichtigkeit der Wahrheit der Behauptungen verwiesen, bei „Aufwendung der gebotenen journalistischen Sorgfalt“ müssen „hinreichende Gründe“ vorliegen, „die Behauptung für wahr zu halten.“ Die Beziehung zwischen der Verfasserin/dem Verfasser eines Zeitungstextes und seiner Leserschaft ist also von absoluter Verlässlichkeit, Sachlichkeit und Glaubwürdigkeit des Dargestellten geprägt (vgl. Neuberger 2011). Eine wie auch immer geartete persönliche Schlussfolgerung oder eine subjektive Vermutung durch den Schreiber werden bei informationsgeleiteten Textsorten wie Berichten oder Reportagen zu sachlichen Themen sanktioniert und müssen daher sprachlich ‚verkleidet‘, indirekt gestaltet werden. Dies kann etwa gelingen, indem persönliche Faktizitätseinschätzungen als intersubjektiv dargestellt werden, als Inferenzen vor dem Hintergrund gegebener Hinweise. Der Schreiber legt in diesen Fällen nahe, dass hinreichende Gründe vorliegen, um eine Schlussfolgerung als gerechtfertigt einzustufen. Dessen ungeachtet werden Inhalte mit offenem Faktizitätsgrad präsentiert. Diese spezifische Funktion wird im Deutschen unter anderem durch die epistemische Verwendung von MVen realisiert:5
| (1) | epistemische Verwendungsweise: |
| Die BBC muss dringend, im eigenen Interesse, klären, ob Savile Helfer hatte und wer ihn deckte. Und wie ausgerechnet im Hort journalistischer Integrität ein Beitrag unterdrückt wurde, der die Missbrauchsvorwürfe thematisierte. Savile muss sich sehr sicher gefühlt haben. (Der Standard). |
| (2) | deontische (nicht-epistemische) Verwendungsweise: |
| Für 2012 und die Folgejahre muss nun ein neuer Leistungsvertrag ausgehandelt werden, der auch Abschreibungskosten beinhaltet. (Rheinische Post). |
Es ist also schon an dieser Stelle wichtig zu erkennen, dass die MVen nicht insgesamt als Strategien zur Artikulation indirekter oder höflicher Kommunikationsstrategien gewertet werden können, da sie unterschiedliche referentielle Bezüge aufweisen. Die so genannten deontischen Verwendungsweisen etwa drücken Notwendigkeit, Möglichkeit, Erlaubnis, Wille oder Präferenz in Bezug auf einen Sachverhalt aus. Sie insgesamt als Höflichkeits- oder Indirektheitssignale zu werten, würde einer Vernachlässigung ihrer direktiven Bedeutungskomponente entsprechen, die sie ebenso gut im Bereich der Face Threatening Acts (Brown/Levinson 2000: 99) verorten könnte. Epistemische Verwendungsweisen hingegen drücken eine subjektive Bewertung bzw. einen Zweifel an der bestehenden Faktizität eines Sachverhalts aus.6 Diese Interpretationsvarianten der MVen sind ab dem Althochdeutschen belegt und illustrieren die grundlegende Tendenz in der Sprache, „Subjektsphäre und Objektsphäre immer klarer zu unterscheiden und sprachliche Formen auszubilden, die dabei helfen, die sachthematische und reflexionsthematische Sinnebene der Sprache so klar wie möglich zu unterscheiden“ (Köller 2004: 533). Auch bei epistemischen Verwendungsweisen wäre es eine simplifizierende Darstellung, die Funktion auf die Artikulation von ‚Höflichkeit‘ oder ‚Indirektheit‘ zu reduzieren, da das funktionale Spektrum weitaus differenzierter ist (vgl. Kap. 4.). Auf analytischer Ebene ist jedenfalls relevant, dass diese Ambiguität der MVen einer Intransparenz, gewissermaßen einem referentiellen Graubereich gleichkommt, der als Opazität bezeichnet wird (vgl. Bußmann 2008: 494; Ziegler 2016). MVen sind „die einzigen polyfunktionalen Modalausdrücke im Gwd. [Gegenwartsdeutschen, E. S.]“ (Reis 2001: 310), was sie im Rahmen von Indirektheits- oder Höflichkeitshypothesen umso interessanter macht: Es ist nicht zuletzt die Opazität dieser Elemente, die einer vergleichsweise geringen Salienz von MVen als Realisierungsformen subjektiver Bewertungen zugrunde liegt. Durch den Einsatz epistemischer Modalverben (im Folgenden: EMVen)7 wird ein Sachverhalt geschildert, der nicht auf Fakten, sondern auf scheinbar logischen Schlussfolgerungen beruht. Dadurch werden „die pragmatischen Konsequenzen des Aussagesatzes für den Sprecher“ (Fritz 2006: 1001) abgeschwächt, sein Gesicht bleibt gewahrt, selbst wenn sich der Inhalt später als kontra-faktisch erweisen würde. Eine zu direkte Präsentation von nicht-faktischen Schlussfolgerungen hingegen würde nicht nur für den Produzenten eine Verletzung seines Selbstbildes bedeuten, sondern auch das Gesicht der Rezipientin/des Rezipienten massiv bedrohen: Dessen grundsätzliches Vertrauen, das er beispielsweise einer Journalistin/einem Journalisten entgegenbringt, wäre erschüttert.8
1.1Problemstellung
Nach der thematischen Eingrenzung des Phänomenbereichs im Zuge der Themenfindung stellte sich die Frage nach der methodischen Möglichkeit einer Klärung der hypothetischen Annahme einer diatopischen Variabilität. Bei dem Versuch, eine quantitative Korpusstudie zu entwickeln, taten sich allerdings gravierende Probleme auf, die in der Analysierbarkeit der EMVen lagen. An der sprachlichen Oberfläche unterscheiden sich die Bedeutungsvarianten nämlich nicht voneinander: Als finite Verben kongruieren MVen in jedem Fall mit dem Subjekt und verlangen einen Infinitiv des 1. Status (ohne zu)9 (vgl. Reis 2001: 307). Es handelt sich also um opake Elemente, die dem Prinzip der Ikonizität bzw. Transparenz (vgl. Köpcke 1994: 82; 1998: 51) zuwiderlaufen: Die konkrete Bedeutung des MVs kann auf den ersten Blick nicht aus der Wortform selbst oder aus seiner formalen Realisierung im Satz erschlossen werden. Dies bedeutet nun aber, dass epistemische Bedeutungsvarianten nicht unmittelbar Gegenstand einer (schon gar nicht automatisierten) Korpusanalyse sein können, die sich auf objektive Parameter stützen sollte. Vorerst unabhängig von der variationslinguistischen Dimension wurde daher die quantitative Fassbarkeit und die objektive Erklärung der epistemischen Bedeutungsvariante der MVen zu primären Forschungszielen erklärt.
Ein Konsultieren der Forschungsliteratur hierzu bietet nur spärlich Lösungsansätze. Ein großer Teil der Publikationen zu EMVen beschäftigt sich nicht mit der objektiven Unterscheidbarkeit der Bedeutungsvarianten, sondern nimmt a priori unterschiedliche Bedeutungen an, die einzelnen Beispielsätzen mehr oder weniger intuitiv durch die jeweiligen Autoren zugeschrieben werden. Außen vor bleibt über weite Strecken die Nennung von Hinweisen, die eine Einordnung des MVs als epistemisch motivieren würden. Werden diese stellenweise genannt und möglicherweise sogar kurz erklärt, stehen sie meist nicht im Fokus der Betrachtungen.10 Dieselbe Beobachtung trifft weniger häufig, aber auch auf diachrone Untersuchungen zu den deutschen MVen zu. Im Laufe der Entwicklung des Deutschen wird einem Quellenbeleg gelegentlich eine epistemische Bedeutung zugeschrieben, die Gründe bzw. objektiv zugängliche Nachweise für eine neu entstandene Bedeutung bleiben aber oft ungenannt.11 Im Bereich der synchronen Untersuchungen sind es vor allem die folgenden Autorinnen und Autoren, die sich einer objektiv zugänglichen Erklärung für die Entstehung der unterschiedlichen Bedeutungsvarianten der MVen widmen: Abraham (1999; 2001; 2004; 2009), Abraha...