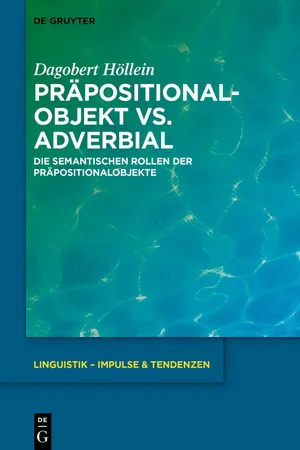1Einleitung
Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist die funktionale Unterscheidung von präpositionalen Strukturen in Präpositionalobjekte (PO) und Adverbiale durch die Modellierung von PO als Träger von semantischen Rollen. Ziel ist die Entschärfung eines Standardproblems der Grammatiktheorie im Allgemeinen und der Valenztheorie im Besonderen: Da zwischen PO und Adverbialen die valenztheoretisch fundamentale Grenze zwischen Komplementen und Supplementen verläuft, hängt die Adäquatheit der Valenztheorie entscheidend davon ab, wie überzeugend diese Unterscheidung modelliert werden kann.
De facto hängen aber auch nicht-projektionistische Theorien wie die Konstruktionsgrammatik von einer Abgrenzung ab bzw. nehmen diese in der Abgrenzung von profilierten und nicht profilierten Partizipantenrollen vor. Die Konstruktionsgrammatik Goldberg’scher Prägung verlagert die Abgrenzung auf die Inhaltsseite der Argumentstrukturmuster und bietet zur Überprüfung ein lediglich auf dem Obligatoriktest basierendes Testverfahren an (Goldberg 1995: 45). Auch für die Konstruktionsgrammatik ist deshalb eine Unterscheidung trotz des Verzichts auf Projektion relevant.
Der hier vertretene PO-seitige Lösungsansatz basiert auf der Annahme, dass PO-Präpositionen signifikativ-semantische Nischen (semantische PO-Rollen) indizieren. Diese Annahme steht im Widerspruch zur einschlägigen Fachliteratur, in der allgemein angenommen wird, dass PO-Präpositionen im Wesentlichen bedeutungsleer sind (Breindl 2006: 936; Eisenberg 2013: 304; Engel 2009a: 100; Pittner/Berman 2008: 38). Die Gegenposition der Arbeit, die zuvor bereits durch Lerot (1982) bezogen und von Rostila (2007) ausgearbeitet worden ist, besagt im Kern, dass PO-spezifische signifikativ-semantische Nischen (Welke 2013: 25; Ágel 2017: 529) Bedeutung kodieren und über diese Nischen die Abgrenzung von PO und Adverbial sowie eine funktionale Beschreibung des PO-Bereichs möglich werden. An die Stelle des bislang inhaltlich ungeordneten PO-Bereichs tritt ein inhaltlich deutlich konturiertes System signifikativ-semantischer Nischen.
Die Abgrenzungsproblematik wird zusätzlich dadurch entschärft, dass einerseits aktuelle Ansätze im Bereich der Direktionalforschung (Ágel 2017; Welke 2011b; 2007) Berücksichtigung finden und Direktiva als neues Mitglied in den „Satzgliedkanon“ (Ágel 2017: 540) aufgenommen werden, andererseits der diachrone Übergang von direktiven Strukturen zu Präpositionalobjekten in die theoretischen Überlegungen einbezogen wird.
Die theoretische Grundlage zur Modellierung der PO bilden drei Theoriebausteine: die signifikative Semantik, Satzbaupläne als Zeichen im konstruktionsgrammatischen Sinn und die bereits erwähnten semantischen Nischen, wobei die vertretene Grammatiktheorie ein Hybrid aus Valenztheorie und Konstruktionsgrammatik ist. Die signifikative Semantik Welkes (2002; 2011b) fokussiert – pauschal gesagt – die Bedeutung im Sinne Coserius (1970a: 14; 1970b: 57; 1972: 78ff.) und steht damit im Gegensatz zu der etablierten bezeichnungszentrierten (denotativen) Rollensemantik Fillmore’scher Prägung, weshalb sich die signifikative Semantik besonders zur Erfassung der als Bedeutungsgruppen gedachten semantischen Nischen eignet. Das Konzept der Satzbaupläne wird gegenüber der traditionellen valenztheoretischen Auffassung, nach der Satzbaupläne in erster Linie ausdrucksseitige Muster sind, konstruktionsgrammatisch erweitert: Satzbaupläne werden im Sinne konstruktionsgrammatischer Argumentstrukturmuster (Goldberg 1995; 2006) als komplexe Zeichen mit einer Ausdrucks- und einer Inhaltsseite aufgefasst, um semantische Nischen als signifikativ-semantische Rollen auf der Inhaltseite der Satzbauplanzeichen fassen zu können. Semantische Nischen gelten mit Rostila (2005b; 2007) als etabliert, wenn sie produktiv belegt werden können:
| (1) |
Supermarkt-Angestellte erwischten ihn, als er in einer Tiefkühltruhe nach Schoko-Eis buddelte. (HMP09/OKT.02657 Hamburger Morgenpost, 27.10.2009, S. 45) |
| (2) |
Wir werden immer nach Geld krampfen müssen. (Fallada, Hans (1983): Kleiner Mann. Was nun? Hamburg: RoRoRo, S. 42. Zitiert nach Krause 1998: 276) |
| (3) |
Scannen Sie nach Lebenszeichen und danach die Trümmerteile. (Siebenborn, Thorsten (2008): Darkness. Norderstedt: Books on Demand, S. 30) |
Als produktive Belege werden Realisierungen von PO in der Umgebung von Verben gewertet, die diese nicht lizenzieren. So kommen in den Sätzen (1)-(3) die Verben buddeln, krampfen und scannen jeweils mit einem POnach+Dat vor, obwohl alle drei normalerweise (d. h. von ihrer Grundvalenz her) nicht mit diesem POnach+Dat stehen. Im konkreten Fall setze ich die Nische QUAESITUM an, deren Bedeutung als ‚das Gesuchte‘ paraphrasiert werden kann. Verben, die diese Nische kodieren, die also ein POnach+Dat regieren, sind z. B. suchen, fragen, forschen. Durch die produktiven Belege wird die Nische zum einen erweitert und zum anderen abgesichert.
Zur Etablierung der Nischen und ihrer empirischen Absicherung wird in dieser Arbeit eine Korpusuntersuchung durchgeführt. Das Korpus der Arbeit bildet der vom Institut für deutsche Sprache über COSMAS II bereitgestellte Jahrgang 2009 der Zeitung Hamburger Morgenpost. Grundlage der Untersuchung sind PG (Präpositionalgruppen) mit den 17 folgenden PO-Präpositionen, die in Valenzlexika des Deutschen belegt sind: an+Akk, an+Dat, auf+Akk, auf+Dat, aus+Dat, für+Akk, gegen+Akk, in+Akk, in+Dat, mit+Dat, nach+Dat, über+Akk, über+Dat, um+Akk, von+Dat, vor+Dat, zu+Dat.
Für die Untersuchung wird zunächst eine rund 1800 Einträge umfassende Liste mit Verben angelegt, die PO mit den genannten 17 PO-Präpositionen regieren. Die Liste speist sich aus entsprechenden Einträgen in den Valenzlexika Elektronisches Valenzwörterbuch deutscher Verben (Kubczak 2010), Verben in Feldern (Schumacher 1986b), Kleines Valenzlexikon deutscher Verben (Engel/Schumacher 1976) und Wörterbuch zur Distribution und Valenz deutscher Verben (Helbig/Schenkel 1969). Ausgehend von dieser Liste konventionalisierter Verb-PO-Verbindungen wird das Korpus der Arbeit in Hinblick auf zwei Ziele untersucht: erstens produktive PO-Belege im oben genannten Sinn zu finden; zweitens weitere, nicht in den Valenzlexika gelistete, konventionalisierte Verb-PO-Verbindungen zu detektieren. Zur Überprüfung letzterer werden das Wörterbuch deutscher Präpositionen von Müller (2012) und das Duden Universalwörterbuch (Duden 2012) herangezogen: Ist eine Verb-PO-Verbindung in einem der beiden Wörterbücher gelistet, gilt sie als konventionalisiert.
Die Arbeit ist wie folgt aufgebaut: Im zweiten Kapitel wird die Theorie der Arbeit entlang der drei Theoriebausteine entwickelt: erstens der signifikativen Semantik, zweitens der Satzbaupläne und drittens der semantischen Nischen. Im dritten Kapitel wird die Abgrenzung von Adverbial und PO im Licht semantischer Nischen thematisiert. Im vierten Kapitel werden aufbauend auf der Theorie die Hypothesen und die Methode für die empirische Untersuchung abgeleitet. Im fünften Kapitel wird das System der semantischen Rollen des Deutschen im präpositionalen Bereich auf Grundlage der Korpusdaten etabliert. Die Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse erfolgt im sechsten Kapitel.
2Grundlegung semantischer Nischen
In diesem Kapitel wird die Theorie der Arbeit entwickelt, die aus drei Bausteinen besteht: der signifikativen Semantik, Satzbauplänen als Zeichen im Sinne der Konstruktionsgrammatik und schließlich den signifikativ-semantischen Nischen. Der Theorieteil ist einerseits die Basis für die empirische Untersuchung der semantischen Nischen. Andererseits werden hier die theoretischen Grundlagen für weiterführende Konzepte wie die Ausdrucksbildung und den Nischentransit gelegt.
2.1Signifikative Semantik
Der erste Theoriebaustein dieser Arbeit ist die signifikative Semantik, die in Opposition zur vorherrschenden denotativen Semantik steht. Nachdem die signifikativ-semantische Literatur mit Ausnahme von Dowty (1991) lange Zeit eher verhalten rezipiert worden ist, wird sie aktuell vermehrt in Publikationen aufgenommen (vgl. Rostila 2007; Strietz 2007; Felfe 2012b: 367ff.; Codarcea 2013: 95; Mollica 2014: 354ff.; Ágel 2015; 2017).
Der Terminus signifikative Semantik geht auf Fleischmann (1985: 84) und insbesondere auf Welke (1987: 159; 1988: 188; 2003: 478; 2011b: 146) zurück, wobei begriffliche Vorläufer für Welke Lakoff (1977; 1987), Starosta (1978) und Dowty (1979; 1991) sind (vgl. Welke 2002: 97).1 Der Grundgedanke der signifikativen Semantik ist aber bereits früher und/oder unabhängig von den genannten Sprachwissenschaftlern z. B. durch Coseriu (1972: 88f.), Ullmann (1973: 70f.), Jäger (1981: 6) und Knobloch (1990: 191) formuliert worden. Dieser Grundgedanke der signifikativen Semantik besagt, dass die Bedeutung, nicht die Bezeichnung primär ist.
Das maßgebliche Arbeitsgebiet der signifikativen – wie auch der denotativen – Semantik ist bislang die Rollensemantik2. Zwar hat Coseriu (1972: 88) die signifikative Semantik über dieses Gebiet hinaus im Bereich der lexikalischen Semantik angedeutet, in der Folge haben sie Welke, Lakoff, Starosta und Dowty jedoch auf die Rollensemantik beschränkt. Maßgebliches zum Ausbau der signifikativen Semantik im Bereich der Rollensemantik hat dabei Welke geleistet.3
Im Folgenden wird die signifikative Semantik in kritischer Auseinandersetzung mit der denotativen Semantik entwickelt, wobei die Semantikauffassung dieser Arbeit stark der signifikativen Semantik Welkes (2002; 2011b) verpflichtet ist. Nach einer knappen Einführung in die denotative Semantik werden zunächst fünf Argumente gegen diese formuliert, um aus dieser Kritik Grundsätze der signifikativen Semantik abzuleiten. Anschließend wird an klassischen Beispielen der denotativen Semantik der Mehrwert einer signifikativ-semantischen Analyse verdeutlicht. Die bereits in der Literatur ausgearbeiteten signifikativsemantischen Rollen werden abschließend in einer Liste zusammengestellt.
2.1.1Denotative Semantik
Die denotative Semantik ist das Standardprogramm für Rollenkonzepte und – von der Vervielfältigung der Einzelrollen abgesehen – nach einer Etablierungsphase in den 1960er/1970er Jahren theoretisch seitdem nicht entscheidend verändert worden. So berufen sich aktuelle Arbeiten (Wagner 2005: 182; Johansson 2008: 10) unmittelbar auf die frühen Schriften Fillmores (1968b; 1972; 1977) oder übernehmen die Theorie mittelbar (Primus 2012: 88; 1999: 32; Lestrade 2010: 44; Igo/Riloff 2008: 1458; Levin/Rappaport Hovav 2008: 51ff.; Härtl 2015: 200; Croft 2012: 179).4 Rostila (2007: 46) kritisiert, dass selbst die Konstruktionsgrammatik, die „ein signifikativ-semantischer Ansatz ist“ (ebd.), weitgehend auf dieses Konzept zurückgreift, so z. B. Goldberg (1995: 43; 2006) und Croft (2001: 216).
Einführend kann das Programm der denotativen Semantik mit Starosta als Dreischritt beschrieben werden: Erstens die sprachexterne Situation feststellen, die einem gegebenen Satz entspricht; zweitens den verschiedenen an der Situation5 beteiligten Größen subjektiv semantische Rollen zuschreiben und drittens dann annehmen, dass diese semantischen Rollen in allen Paraphrasen des Ausgangssatzes und in allen anderen Sätzen, die auf dieselbe außersprachliche Situation verweisen, konstant bleiben (vgl. Starosta 1981: 89ff.).
1. Es wird die außersprachliche Situation bestimmt, die einem Satz entspricht (Starosta 1981: 89). Für einen Satz wie (1) ist also eine entsprechende Situation in der außersprachlichen Wirklichkeit festzustellen:
2. Es werden „den verschiedenen Mitspielern dieser Situation subjektiv Rollen-Etikette zugewiesen“ (ebd.). In der außersprachlichen Situation, die nach denotativ-semantischer Auffassung Satz (1) entspricht, schlägt ein Mensch namens Peter einen anderen Menschen namens Anton. Peter ist in der außersprachlichen Situation der Handelnde und erhält deshalb die semantische Rolle – das Rollenetikett in Starostas Diktion – AGENS. Anton dagegen ist in der außersprachlichen Situat...