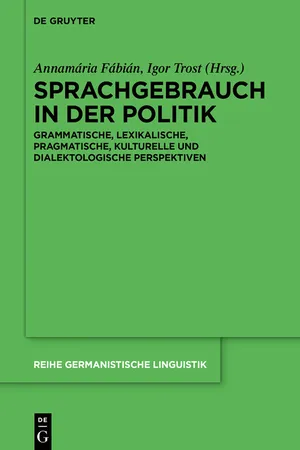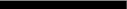2Gegenstand, Problem, Ziel
Den Gegenstand dieser Untersuchung bildet die Politizität – im Sinne dessen, was Voraussetzung für (das Prozessieren von) Politik ist (vgl. Bußhoff 1993), zugleich aber (in komplementär systemischer Interpretation) auch jedem Ergebnis oder Produkt dieses Prozessierens eignet – als Komponente des Bedeutungsspektrums der Zeichenhaftigkeit, respektive des kommunikationsrelevanten Potenzials der Medialität von (Konzepten von) Sprache. Als Problemstellung gilt das Heranführen des Untersuchungsgegenstandes (in seiner Charakteristik als Schlüsselphänomen der Sphäre des Politischen) an den Prozess der oben angerissenen Theoriebildung. Dabei wird auch deren Konnex zur Peirce’schen Semiose-Modellierung, welche für den Bereich sozialer Phänomene als nahezu universell explikativ gelten darf (vgl. Glauninger 2017), adäquat zu berücksichtigen sein. Ziel ist es, der Deutung des Zusammenhanges zwischen Politik, Sprache und (Sprach-)Wissenschaft mit neuen, originären soziolinguistischen Ansätzen Impulse zu verleihen. Dies erscheint umso lohnender, als die Politolinguistik nicht nur ihr Spektrum an Fragestellungen erheblich erweitert, sondern sich im Zuge dessen vor allem auch paradigmatisch hinreichend konstituiert hat. Davon legt nicht zuletzt der vorliegende Band ein beredtes Zeugnis ab, in dessen Beiträgen jeweils spezifisch politolinguistische Kristallisationen pragma-, variations-, text- oder medienlinguistischer, diskurs- bzw. gesprächsanalytischer sowie funktionalgrammatischer und -semantischer Perspektiven manifest werden. Genau an dieser Stelle aber setzt nun die hier vorgelegte Arbeit an, indem sie in Wechselwirkung mit, respektive Komplementarität zu diesen Prozessen zusätzlich noch eine meta(polito)linguistische Dimension aufspannt.
3Konzipierung, Semiotizität und Semantizität von Sprache
Im Licht grundlegender (radikal) konstruktivistischer Ansätze,8 insbesondere der Annahme, dass unser Erleben von Wirklichkeit auf einer überwiegend sprachbasierten Konzipierung eines kontinuierlichen – präkonzeptionell unstrukturierten – Stromes an Sinneseindrücken beruht (vgl. Borensztajn 2006: 7) und diese Wirklichkeit somit zwar einer Konvention entspricht, aber nichts mit einer intersubjektiv zugänglichen, objektiv (beobachterunabhängig) existierenden Realität zu tun hat,9 kommt den Konzepten von Sprache (in jedweder Form) aus mehreren Gründen unikale Qualität zu. So repräsentieren diese beispielsweise eine spezifische, in mehrfacher Hinsicht potenzierte Selbstreferentialität. Denn alles als Sprache (in welcher inner- und außer(sprach)wissenschaftlichen Ausprägung auch immer, s. oben) im Bewusstsein Stehende, Erlebte, Mögliche ist letztlich – wie alles, was wir (als Wirklichkeit oder Welt) erleben – sprachlich konzipiert (und wird zudem stets sprachlich kommuniziert).
Dabei konstituieren sich die (stets sprachbasierten) Konzepte von Sprache in einer per se semiotischen, präziser: indexikalischen Struktur – genau dies aber lässt Sprache als Zeichen Wirksamkeit entfalten. Die für diese Sicht unabdingbar vorauszusetzenden Annahmen sind in der Peirce’schen Semiose-Theorie grundgelegt und implizieren das Verwerfen einer Reihe von herkömmlich linguistischen Postulaten:
Die Etablierung eines in logozentrischer Manier a priori dekontextualisierten Gegenstandsbereiches [der Linguistik] und die daraus resultierende Verengung der komplexen semiotischen Sphäre auf Sprachzeichen (die jenem Gegenstandsbereich entsprechen) hat dazu geführt, dass die Problematisierung von Sprache (in ihren unterschiedlichen Perspektivierungen/Konzeptualisierungen) als Zeichen ausblieb oder bestenfalls rudimentär angedacht wurde. Tatsächlich aber ist die Semiotizität (und somit Semantizität) von Sprache per se dieser ausnahmslos „eingeschrieben“, d. h. folgt aus ihrem Status als Konstrukt der Wirklichkeitsperspektivierung, ihrer konzeptionellen Dimension. Denn eine bestimmte (Einzel-)Sprache – bzw. jedwede „Erscheinungsform“ (als Teilbereich) einer solchen – repräsentiert stets ein historisches und gegenwärtiges Gesamt an einschlägigen Konstruktionsprozessen, in deren Verlauf spezifische, aus dem Totalspektrum der „sprachlichen“ Sinneseindrücke (respektive Bewusstseinsinhalte) selegierte Segmente in einer bestimmten Konfiguration korrelieren mit spezifischen, aus dem Totalspektrum der „nicht-“, respektive „außersprachlichen“ Sinneseindrücke/Bewusstseinsinhalte selegierten Segmenten. Diese Korrelation aber repräsentiert nichts anderes als eine zeichenhafte, im Besonderen indexikalische Struktur: Das „Sprachliche“ indiziert/evoziert/steht für das „Außersprachliche“ – als Zeichen. (Glauninger 2017: 117–118).
Vor diesem Hintergrund wird der Blick frei für die Semiotizität von Sprache, deren Status als Zeichen, resultierend
aus der sozialen Perspektivierung von Sprache(n), dem – extensiv dimensionierten – soziogruppal-interaktionalen Konzipieren von sprachlichen Erscheinungsformen. Dabei konstituiert sich auf Basis der Kookkurrenz bzw. des Korrelierens von „Sprachlichem“ und „Außersprachlichem“ eine indexikalische (Signans-Signatum-)Struktur, die sich als infinite Semiose prozessual entfaltet. (Glauninger 2017: 125).
Da nun aber die Bedeutungs-Ebene dieser Zeichen potenziell alles umfasst, wofür das – entsprechend konzipierte – Sprachliche im (kollektiven) Bewusstsein steht (vgl. Glauninger 2017), wird einsichtig, dass
sich mental-emotive Aggregationen dieser Komplexität nicht logozentrisch-diskret analysieren, respektive in- und extensional „vermessen“ [lassen]. Den Kern dieses schillernden Spektrums an (sozialen) Bedeutungen bilden aber Attitüden/Stereotype unterschiedlichster Art, die […] in nahtloser Verschränkung der inner- und außer(sprach)wissenschaftlichen Sphäre generiert, konventionalisiert und tradiert werden. (Glauninger 2017: 125–126).
Die auch hier nochmals betonte grundsätzliche Gleichwertigkeit (sprach-)wissenschaftlicher und nicht wissenschaftlicher Konzepte von Sprache hinsichtlich ihrer Zeichen- und Bedeutungsdimension ergibt sich epistemologisch aus der eingangs vorgenommenen operativ konstruktivistischen Positionierung vorliegender Arbeit und bedarf keiner weiteren Begründung. Was aber deutlicher veranschaulicht werden muss, ist jene durchaus gegebene Potenzierung an Semiotizität, Semantizität und Medialität, die sich als Folge der wissenschaftlichen Teilhabe am Prozess des fortwährenden (gesamt-)gesellschaftlichen10 Generierens bzw. Konstruierens von Sprache ergibt. In diesem Zusammenhang ist aufschlussreich, wie unterschiedliche wissenschaftliche Disziplinen entweder auf ihre je spezifische Weise Sprache konzipieren oder aber (vorhandene) Sprachkonzepte entsprechend modifizieren/adaptieren.11 Dass im Zuge von Operationen dieser Art die Linguistik zugleich auch ihren Gegenstand(sbereich) konstruiert, stellt kein Spezifikum dar, ganz im Gegenteil: Wissenschaftliche Gegenstände sind ausnahmslos soziale Konstrukte – freilich mit je nach Einzeldisziplin mehr oder weniger deutlich erkennbarer gesellschaftlicher Bedingtheit (bzw. umgekehrt: Relevanz) der Kulturpraxis Wissenschaft.
4Medialität und Politizität
Für die vorliegend problematisierte sprachliche Politizität haben nun aber über das hinsichtlich der Semantizität von Sprache als solcher (Stichwort: Kontextualisierung12) Dargelegte hinaus bestimmte Faktoren inner- und außer(sprach-)wissenschaftlicher Sprachkonzipierung besondere Relevanz, die mit wesentlichen Aspekten der Medialität von Sprache eng zusammenhängen. Auch diesen Überlegungen liegt ein fundamental semiotischer Ansatz zugrunde: Jede Zeichenhaftigkeit (sowie deren funktionale Ebene in Form von Bedeutsamkeit) beruht auf Konvention. Sprachkonzepte in ihrer Semiotizität und Semantizität sind als Produkte sozialer Interaktion (von teils maximal ausgreifender gesellschaftlicher Extension) unabdingbar konventionell. Ein wesentliches (Steuerungs-)Moment hinsichtlich der Übernahme von bzw. des Sozialisiert-Werdens in Bezug auf Konventionen aber ist – freilich in vielfältiger, facettenreicher Kodierung sowie durchaus differenziert (und oftmals subtil) Wirksamkeit entfaltend – Macht.
Somit wird offenkundig, dass sämtlichen Sprachkonzepten die Qualität der Politizität – im eingangs definierten Sinn (vgl. 1) – inhärent ist, und dies in bemerkenswerter, kaum zu überschätzender Ursächlichkeit, denn „Macht braucht ein politisches System“ (Baraldi, Corsi & Esposito 1997: 135). Wenn deshalb an dieser Stelle vorliegender Untersuchung von der Politizität sprachlicher Medialität die Rede ist, geht es verständlicherweise dezidiert nicht um in usuell linguistischer Manier modellierte sprachliche (Teil-)Systeme13 als Medien einer als politisch spezifizierten Sphäre der Kommunikation.14 Von Interesse ist vielmehr, inwiefern sich einerseits (politische) Macht als Konstituens (der Konzipierung) von Sprache analytisch fassen und empirisch beschreiben lässt bzw. wie andererseits die – stets in Prozessen sozialer Interaktion ablaufende – Konz...