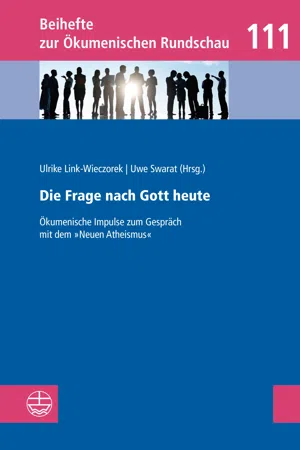![]()
II. GOTTESERFAHRUNG
Wir wollen die Frage nach Gott heute von der Erfahrung Gottes her behandeln. Dafür wird dieses Kapitel beleuchten, wie für Christinnen und Christen die Gottesbeziehung in ihrem eigenen Leben konkret Gestalt gewinnt. So unterschiedlich das im Einzelnen auch geschieht und so unterschiedlich die Situationen, die historischen und kulturellen Kontexte der Lebensgestaltung auch sein mögen – in allen Kirchen lässt sich ein gemeinsamer Zugang zur Deutung des Lebens beobachten: Christinnen und Christen deuten ihr Leben, indem sie es einordnen in die große Heilsgeschichte Gottes. Insofern steht Gott mitten im Leben und für mehr als nur für dessen Anfang und Ende (II.1). Die Rede von Gott hat nicht ausschließlich einen jenseitigen »Allmachtsgott« zum Gegenstand, sondern bezieht sich auf das tatsächliche Leben auf der Erde. Die christlichen Konfessionen kennen verschiedene Entdeckungszusammenhänge für Lebensdeutung und Lebensgestaltung in der Gegenwart Gottes (II.2): Kontemplation, Heiligung, Leben in der Bundespartnerschaft mit Gott oder ein Glaubensleben in der Prägung durch Christus. Sie alle stellen Praktiken und Perspektiven dar, in denen die Glaubenden ihre jeweils individuelle »kleine« Geschichte durch die »große« Geschichte Gottes mit der Welt deuten und interpretieren. Glaubende fühlen sich dadurch hineingenommen in die heilsame Dynamik Gottes, in der sie ihr persönliches Leben führen können. Wie aber können in diesem Zusammenhang die Krisenerfahrungen des Lebens (II.3) verstanden werden? Um diese Frage geht es bei der Rede von der sog. »Rechtfertigung Gottes« (Theodizee) mit Anfragen an die Allmacht Gottes (II.3.a). Die Lehre von Gottes Vorsehung wird als eine tröstende Vergewisserung von Gottes mitfühlender Begleitung auch in der Gebrochenheit des Lebens wiedergewonnen (II.3.b). Auch der Begriff »Verborgenheit« Gottes wird in der Krisenerfahrung relevant. Alles mündet schließlich in die Frage, inwiefern Gott vom Leiden in der Welt selber betroffen (II.4) ist. Damit wird zugleich ein Übergang geschaffen zur Trinitätslehre, die im folgenden Kapitel (III) im Zentrum stehen wird.
1.GOTT: MEHR ALS NUR ANFANG UND ENDE DES LEBENS
Wenn Christinnen und Christen schnell sagen sollen, was ihnen am Gottesglauben wichtig ist, dann heißt es häufig: Hier geht es um die Fragen nach dem Woher und Wohin des menschlichen Lebens. Mit Gott werden Antworten verbunden auf Fragen wie: »Woher komme ich? Wozu lebe ich?« Und über das eigene Leben hinaus wird der Glaube an Gott ganz generell in Verbindung gebracht mit dem Fragen nach Ursprung und Ende der Welt im Ganzen: »Gibt es einen Urheber der Welt, der ihr einen Sinn gibt, und gibt es ein ewiges Leben, das die Menschen erhoffen dürfen?« Anfang und Ende, ja, die Endlichkeit des Lebens überhaupt, scheint der Motor des Fragens nach Gott zu sein. Aber sie ist beileibe noch nicht alles, was den Gottesglauben interessiert: Auch das schon begonnene und noch nicht beendete Leben gerät unter der Frage nach Gott in ein spezifisches Licht.
Wie ist es mit dem Leben tatsächlich: Wird es nicht immer konkret gelebt, in bestimmter Zeitspanne, mit bestimmten Mitmenschen, mit beglückenden und bedrohlichen Umständen und Erfahrungen? Leben ereignet sich in Beziehungen. Wir deuten unser Leben, indem wir es in Beziehung setzen – zu unseren Mitmenschen, zu unserer Herkunft und Zukunft, zu uns selbst. Welche Rolle spielt Gott dabei? Im ökumenischen Nachdenken über die Grundausrichtung des christlichen Gottesglaubens haben wir einen stark lebensbezogenen Zug entdeckt, der den einzelnen Menschen und seinen Weg in den Blick nimmt und ihn nicht in einem universal-heilsgeschichtlichen Bogen quasi unsichtbar werden lässt. Das einzelne, konkrete Leben darf im großen Zusammenhang von Gottes Wirken in Schöpfung, Erlösung und der Gegenwart des Heiligen Geistes nicht verschwindend klein erscheinen, sondern im Gegenteil: Schon in den biblischen Texten wird die große Geschichte von Gottes Hereinkommen in die Welt und von seinem Mitgehen mit den Menschen erzählt, um in diesem Licht gerade das einzelne Leben jeweils neu und konkret erzählen zu können. Durch dieses biblische Erzählen angeregt entstanden beispielsweise um die Wende zum 5. Jhd. n. Chr. die berühmten »Bekenntnisse« des Augustinus, in denen er sein Leben in der Gegenwart Gottes deutend erzählt. Auch die kontextuelle Bibellektüre der lateinamerikanischen Basisgemeinden des 20. Jahrhunderts setzt eine Verflechtung von großer Geschichte Gottes mit der Welt und konkreter Lebensgeschichte der Menschen voraus. Vor allem die klassischen kirchlichen Amtshandlungen (Kasualien) und seelsorgerlichen Bemühungen der Kirchen wie Taufe, Hochzeit, Krankenhausseelsorge oder Beerdigung mit Trauergespräch stellen diese Verknüpfung ausdrücklich her. Sie sind zudem mit Gesprächen verbunden, in denen versucht wird, die konkrete Lebensgeschichte der Menschen innerhalb der Heilsgeschichte Gottes wahrzunehmen. In absolut klarer Eindeutigkeit ist das allerdings gar nicht möglich – ein Problem, mit dem der Glaube von jeher ringt. Man kann sagen, dass sich in diesem Ringen beides vollzieht: die Wahrnehmung von Gottes Schöpfungskraft, Leben in überraschender Fülle zu geben, und die (befähigende) Herausforderung für die Glaubenden, tatsächlich darauf zu setzen – gegen die Erfahrung von angeblich unvermeidbarer Lebensbeschränkung im Kampf um Ressourcen in der Welt. Ein Leben in der Wahrnehmung der großen Geschichte Gottes zu gestalten, heißt letztlich, aus der Verheißung der Auferstehung heraus zu leben. Sie gründet im Glauben an die Auferstehung Jesu, nach dem Jesus Christus nicht nur eine Figur der Vergangenheit ist, sondern die gegenwärtig lebendige und uns ansprechende Selbstmitteilung Gottes.
Gibt es Kriterien oder praktische Hilfestellungen, wie sich Gottes erlösendes, tröstendes oder aufrüttelndes Wirken, wie es aus der Heilsgeschichte bekannt ist, im eigenen Leben zeigt? Sowohl in der theologischen Wissenschaft als auch in der kirchlichen Praxis wird über diese Verknüpfung bei der Lebensdeutung nachgedacht. Solche »Verknüpfungsarbeit« geschieht auch konkret, wenn Glaubende oder nach Gott Suchende miteinander ihr Leben deuten. Wenn sie über ihr Leben im Rahmen der Heilsgeschichte Gottes sprechen, können sie das als einen Nährboden von wachsender Gewissheit, Glauben und letztlich wachsender Gotteserfahrung erleben. Gerade die christliche Ökumene mit ihren verschiedenen kirchlichen Traditionen bietet eine Vielfalt an Deutungsschwerpunkten, die sich in den jeweiligen »Lebensgeschichten« der Kirchen und Konfessionen entwickelt haben. Diese Deutungsschwerpunkte zeigen sich in bestimmten liturgischen oder spirituellen Traditionen – z. B. bei der Segnung der Schöpfung in der Orthodoxie, in kontextuell unterschiedlicher Praxis der Heiligenverehrung, Marien-Wallfahrten, aber auch in Bibelstunden und Predigtnachgesprächen, in christlich motiviertem sozial-politischen Engagement sowie bei charismatischen Gottesdiensten, in denen die Gegenwart des Heiligen Geistes den Teilnehmenden gewiss wird. In all diesen Formen wird das konkret gelebte Leben mit der großen Geschichte, die Gott mit seinen Geschöpfen geht, verknüpft. In einer »Ökumene des Lebens« können heute solche Deutungstraditionen jenseits der Trennungen und Spaltungen immer wieder im Gespräch gehalten werden – in den Ortsgemeinden, im schulischen Religionsunterricht, in der kirchlichen Erwachsenenbildung oder im theologischen Nachdenken innerhalb von Caritas und Diakonie. Eine bewusste ökumenische Zusammenarbeit in diesem Sinne bietet den Glaubenden und den nach Gott Suchenden eine Chance, den Reichtum christlicher Lebensdeutung neu zu erschließen und seine Vielfalt für die persönliche Lebensdeutung zu nutzen. Hier liegt eine ökumenische Hauptaufgabe der Kirchen heute, und sich ihr zu stellen, kann sehr wertvoll sein, gerade in einer Zeit, in der eine »Normalbiographie« aufgrund des hohen Grades an Individualisierung und dem Verlust vorgegebener Identitäten zu einem Mythos zu werden scheint: Vorgegebene Lebenswege und -gestalten scheinen heute zugunsten einer pluralisierenden je individuellen Formung des eigenen Lebens in den Hintergrund zu treten.
Freilich ist in der Christentumsgeschichte auch immer wieder darüber gestritten worden, ob die Verknüpfung von allgemeiner und persönlicher Geschichte des Wirkens Gottes jeweils angemessen vorgenommen wird. Auch die Konfessionen haben gerade darüber manche Differenzen ausgetragen. Gefürchtet wird eine doppelte Gefahr: Dass eine jeweils kontextuell erlebte »kleine« Geschichte die »große« Geschichte in den Schatten stellt bzw. dass umgekehrt die von der Kirche verkündigte große Heilsgeschichte die kleine unsichtbar werden lässt. Man kann die Angst vor diesen beiden Gefahren zum Beispiel im Streit der Reformatoren mit spiritualistisch orientierten Täufern wahrnehmen: Die Reformatoren warfen Letzteren vor, zu direkt von der Gegenwart des Geistes auszugehen und ihn zu wenig an das »Wort« zu binden, wie es aus der großen Geschichte zu hören ist. Im Grunde lautete der Vorwurf, die Verknüpfung von gegenwärtigem Leben und allgemeiner Heilsgeschichte Gottes werde aufgelöst und der Eindruck einer falschen, nämlich selbstkonstruierten Gottunmittelbarkeit des Menschen erweckt. Die Täufergruppen wiederum warfen der Hauptströmung der Reformation vor, dass sie durch eine Überbetonung der Rechtfertigung »allein aus Glaube« kaum noch die konkrete Lebenspraxis des Einzelnen in der Nachfolge Christi im Auge hätten und dadurch unglaubwürdig würden. In der römisch-katholischen Kirche zog man es im Wissen um diese Schwierigkeiten lange vor, von Gottes Heilswillen vornehmlich in Bezug auf die Schöpfung als ganzer zu sprechen, in die sich der einzelne Mensch durch Gebet und gemeinschaftliche Kontemplation »einschwingen« könne. Mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil im 20. Jahrhundert wurde schließlich auch die Gewissensentscheidung des Einzelnen theologisch ausdrücklich gewürdigt, wobei an die Überzeugung von der bindenden Kraft des Gewissens angeknüpft werden konnte, die schon vor dem Konzil gelehrt wurde.
Trotz dieser Beobachtungen kann man jedoch sagen, dass das individuelle Leben der Gläubigen in allen Konfessionen nie aus den Augen verloren wurde. Man hat es von frühester Zeit der Christenheit an bis heute eingewoben gesehen in ein ganzheitliches, sehr komplexes kirchliches Leben. Im Idealfall leben die einzelnen Gläubigen im kirchlichen Lebens-Raum in einer permanenten Verflechtung mit der großen Geschichte Gottes – neben dem Feiern von Gottesdiensten z. B. durch häusliche Schriftlesung, Gebet, Meditation, Kirchenmusik, gemeindliche Bibelkreise, kirchliche Feste, Wallfahrten und besondere Formen der Glaubenspraxis wie z. B. der Heiligenverehrung. Exemplarisch kann hier auf die kontemplative Tradition insbesondere der katholischen Kirche und der orthodoxen Kirchen verwiesen werden. Auch sie stellt einen spirituellen Weg dar, mit dem eine angemessene Verknüpfung von großer und kleiner Geschichte Gottes mit den Menschen gesucht wird. Sie ermöglicht eine Vergewisserung der geglaubten, aber meist nicht direkt erfahrenen Gegenwart Gottes im Inneren des einzelnen Menschen im Horizont des universalen Geschichtsverlaufs.17 In dieser Vergewisserung soll die direkte Zuwendung Gottes »erlebbar« werden, so dass sie auch ausstrahlen kann in das zwischenmenschliche Handeln.
Unser ökumenisches Nachdenken über die Frage nach Gott hat weiter die Einsicht erbracht, dass die evangelische Vorsehungslehre vor allem in der Theologie des 20. Jahrhunderts auf die Vergewisserung des Heilswillens Gottes und des Trostes in Krisenzeiten abzielt.18 Sie stellt damit einen Weg der Verknüpfung von großer und kleiner Geschichte Gottes dar, der mit der Tradition der Kontemplation durchaus vergleichbar ist: Der Weg der Kontemplation und die Aneignung der Lehre von Gottes Vorsehung stehen für eine Spiritualität, in der die Lebenserfahrung des einzelnen Menschen aufgehoben und eingeordnet ist in die große Geschichte Gottes. Ebenfalls verwandt mit der Kontemplation sind die Wege der Verknüpfung in reformatorischer Tradition, die sich mit dem Aufkommen von biographisch orientierter Theologie und Frömmigkeit in Täufertum, Pietismus und pentekostalen Bewegungen entwickelt haben. In ihnen wird die individuelle emotionale Gottes-Erfahrung des einzelnen Menschen in ihrem konkreten Lebensbezug besonders profiliert. Im 20. Jahrhundert tritt, vornehmlich durch postkoloniale Theologien außer-europäischer Herkunft, für alle Kirchen nicht nur die Lebensgeschichte des einzelnen Menschen, sondern treten auch spezifische historisch-regionale Lebenssituationen bestimmter Gruppen von Menschen gesondert ins Zentrum der Frage nach Gott. Nicht zuletzt hier wird das Ringen mit den sozialen Problemen der Menschheit in eine lebensweltlich orientierte Frage nach Gott integriert.
In allen hier erwähnten Strömungen wird die Frage nach Gott nicht abstrakt mit Blick auf den universalen Anfang des Lebens gestellt, sondern in konkreter Beziehung zur Lebensgeschichte von Menschen relevant. Eine Ermutigung dazu erfolgt nicht zuletzt durch die in den biblischen Texten enthaltenen Erzählungen, in denen Gott als beteiligt an der Lebensgeschichte von Menschen geschildert wird. Mit Eric Voegelin kann man zwischen pragmatischen und paradigmatischen biblischen Geschichten unterscheiden.19 Den pragmatischen, d. h. sachbezogenen Geschichten geht es um die Schilderung (vermeintlich) faktischer Ereignisse. Bei paradigmatischen, d. h. modellhaften Geschichten hingegen handelt es sich um einen Interpretationsvorgang, bei dem Geschehnisse aus der Vergangenheit innerhalb eines bestimmten Deuteschemas ausgewählt und erzählt werden. Als sinnstiftende Geschichten bewegen sie sich in einem transzendenten Bezugsrahmen und haben eine identitätsstiftende Funktion für den Einzelnen und für Gemeinschaften. Durch diese Art von modellhaften Erzählungen vergewissert sich eine religiöse Erinnerungsgemeinschaft ihrer Gottesbeziehung. Darum kommen manche Begebenheiten, wie z. B. das Exodusgeschehen, in der Bibel mehrmals vor und werden zu verschiedenen Zeiten jeweils neu und anders erzählt.
Die biblische »große« Heilsgeschichte präsentiert sich als eine Zusammenstellung von kleineren Geschichten über Gottes Leben mit dem Volk Israel und allen Menschen sowie über sein Handeln in Jesus Christus – von Noahs Arche und dem anschließenden Bund mit Gott, den Väter- und Müttergeschichten von Sara und Abraham, Isaak und Rebekka und vielen mehr, dem Exodus aus der Sklaverei, der an Mose vorbeiziehenden Herrlichkeit Gottes, dem Bundesschluss am Sinai, den Warnungen der Propheten, der Vorgeschichte der Geburt des Samuel durch Hannah, der Verkündigung der Geburt Jesu an Maria, den Geschichten von Geburt, Leben, Sterben und Auferweckung Jesu. Was man von Gott sagen kann, erfährt man durch diese Geschichten, so wie Menschen auch über sich selbst und über ihre Mitmenschen durch Geschichten erklären können, wer sie sind oder waren. Der Philosoph Paul Ricoeur spricht diesbezüglich von »narrativer Identität«.20 Den Gläubigen wird die biblische Groß-Erzählung in je spezifischer Zuordnung ihrer Einzelgeschichten zum Bezugsrahmen für ihre eigene Lebensgeschichte.
Für die Theologie ergeben sich dadurch Bezüge zu anderen Wissenschaften, die sich mit der Rolle des Erzählens für das Leben der Menschen beschäftigen, etwa zur sozialwissenschaftlichen Biographienforschung oder auch zu Reflexionen über Sinn und Funktion des Narrativen in der Philosophie.21 Manche unterscheiden auch innerhalb der Theologie einen ontologischen von einem narrativen Aspekt.22
2.LEBENSDEUTUNG UND LEBENSGESTALTUNG IN DER GEGENWART GOTTES
Mit der Verflechtung von »großer« und »kleiner« Geschichte Gottes mit den Menschen hängt zusammen, was wir unter Gotteserfahrung verstehen können. Es handelt sich dabei immer um in der Gegenwart Gottes gedeutete Erfahrung innerhalb der eigenen Lebensgeschichte, die durch die große, biblisch bezeugte Geschichte Gottes mit der Menschheit verstanden und interpretiert wird. Die Frage: »Was hat Gott mit meinem / unserem / dem Leben zu tun?«, ist nicht ausschließlich eine Frage nach den Möglichkeiten der Erkenntnis Gottes. Sie wird vielmehr zu einem großen Teil in sehr praktischen Wegen der Vergewisserung Gottes gestellt und beantwortet. Eine tragende Rolle als spiritueller Erfahrungsschatz spielt dabei die Gemeinschaft der Gläubigen. Im Folgenden werden vier christliche Konzepte von Gottes Lebensbegleitung (Kontemplation, Heiligung und Leben in der Bundespartnerschaft mit Gott sowie ein Leben in der Prägung durch Christus) geschildert. Sie dienen nur als Beispiele, die leicht durch Konzept...