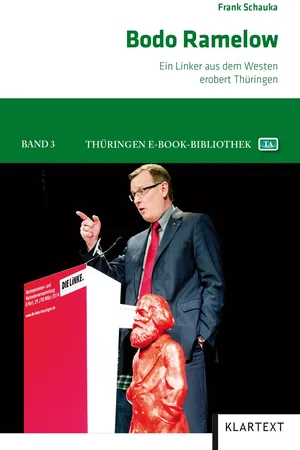![]() Teil 1: Der lange Weg bis zur gescheiterten Wahl zum Ministerpräsidenten 2009
Teil 1: Der lange Weg bis zur gescheiterten Wahl zum Ministerpräsidenten 2009![]()
Kapitel 1
Der Start eines Politikers – Bodo Ramelows erste Frau erzählt
Ramelow fährt eine 750er Yamaha, findet in Marburg seine erste große Liebe und startet in die Politik.
Schwül ist es in Marburg. Ein Rückhaltebecken für Wassermassen hat die Lahn nicht nötig. Sie schleppt sich dahin, schwitzt sich hin zum Rhein. Vorbei an Tretboten, die wie angeklebt am Ufer liegen. Vorbei an Holzbänken vor einfachen Tischen. Vorbei an den wenigen, die am Wasser Erfrischung suchen.
Leonie Ramelow greift zur Litschi-Bio-Brause.
„Das erste Mal“, sagt Bodo Ramelows erste Ehefrau, „hatte ich ihn bei einer Schülervollversammlung getroffen.“ 38 Jahre ist das her, ein halbes Leben. Sie war 17, er 20. Sie war auf dem beruflichen Gymnasium, er auf der Fachoberschule. „Da hat Bodo im Hintergrund gestanden, aber mehrere gute Redebeiträge gehalten. Er hat mich sofort beeindruckt.“
Offensichtlich nicht nur sie. Auch die Mitschüler erkannten und würdigten seine Gewandtheit und wählten ihn zum Schulsprecher. Ein „guter, schulpolitisch und politisch engagierter Schüler“ sei er gewesen, erinnert sich Steffi Wolf, seine damalige Lehrerin. Kein Wunder. Schon damals war Bodo Ramelow in der Gewerkschaft „Handel, Banken und Versicherungen“ (HBV) tätig. An politischen Themen war er schon in jungen Jahren interessiert.
Und dass er bereits Auto fuhr, fand Leonie geb. Schwarz 1976 auch nicht verkehrt. „Meine Freundin und ich waren froh, ältere Freunde zu haben, die schon ein Auto hatten.“
Leonie Ramelow sinniert. „Bodo hatte damals einen weißen oder hellgrauen Käfer von seiner Mutter gehabt.“ Anni Ramelow hieß die Mutter, da ging es ihr noch gut.
Der Kugelporsche war ideal für die Stunde nach dem gemeinsamen Sportunterricht. „In der Freistunde konnte man dann noch mal zum Kaffeetrinken in die Mensa fahren. So sind wir uns nähergekommen und auch abends gemeinsam weggegangen.“
„Bodo fuhr eine 750er Yamaha“, sagt sie. „Ich hatte eine 250er. Wir hatten meine gedrosselt.“ Sicherheit geht vor. Und Stil. Sobald Fräulein Schwarz die schwere Ledermontur ablegte, kam meist ein Kleidchen zum Vorschein. Zeugen der Entpuppung befiel dabei oft Erstaunen. „Ich fuhr damals Motorrad und trug aber auch gern Kleider.“ Frau Ramelow, die erste, lacht.
Auch jenseits der Vergnügen in der Freizeit waren sie einander zugeneigt. Es herrschte Gleichklang in der politischen Weltsicht, in der Art, wie sie Gerechtigkeit verstanden. „Wir waren unsere Jugendlieben.“ Nicht nur politisch, doch politisch eben auch.
„Ich war von zu Hause aus politisch geprägt. Meine Mutter war in der Kirche aktiv, und mein Vater war freigestellter Personalrat“, erklärt Leonie Ramelow. „So bin auch ich mit der Gewerkschaft großgeworden.“
Die Gewerkschaft. Hätte 1982 bei der Hochzeit jemand gefragt „Wollt ihr … bis dass der DGB euch scheidet?“ – wer von den etwa 250 Gästen bei der Party im Gemeinschaftshaus der Marburger Hansenhausgemeinde hätte sich gewundert. Selbst der Standesbeamte war am Tage vor dem Jawort noch auf einer Großkundgebung mitmarschiert.
Doch vorgezeichnet war die Karriere als Funktionär der HBV-Gewerkschaft, deren Landesvorsitzender Ramelow 1990 in Thüringen wurde, keineswegs. Jedenfalls nicht damals, 1977, als er die Kaufmännischen Schulen in Marburg mit der Fachhochschulreife verließ.
Wäre alles so verlaufen wie geplant, Bodo Ramelow stünde heute wohl nicht auf der politischen Bühne, sondern würde Wein anbauen, vermutlich in Rheinhessen, vielleicht in der Pfalz.
Winzer zu werden, „das war einer meiner Lebensträume“, sagt er. „Ich bin heute noch Großgrundbesitzer und besitze ein Morgen Land. Dafür kriege ich jährlich 9,98 Euro Pacht und eine Flasche Wein.“
„Mit Weinbau großgeworden“ sei er in Rheinhessen, wo damals die Herbstferien begannen, wenn im Wingert die Reben reif waren und die Schüler bei der Lese helfen mussten. Von dort stammte das alte protestantische Geschlecht der Fresenius, die Ahnen seiner Mutter Anni.
Schon immer, sagt Ramelow, hatte er den „Wunsch: Ich will nach Geisenheim und Weinbau studieren.“ Zunächst ging er nach Hainfeld in die Pfalz. Auf dem Scherrhof wollte er vor dem Studium ein Praktikum absolvieren.
Pfalz, südliche Weinstraße. Kein natürlicher Wohlfühl-Landstrich für einen in Osterholz-Scharmbeck in Niedersachsen geborenen protestantischen Junggewerkschafter mit einer gewissen Schlagseite zu Marburger DKP-Leuten.
Auch der Senior-Chef auf dem Scherrhof hatte ein gewisses Problem mit dem rotgefärbten Mann aus dem rotgetränkten Marburg. Als der alte Scherr in seinem Haus in der Post des Praktikanten die Gewerkschaftszeitung fand, gab es Ärger. Es hieß, erinnert sich Ramelow: So ein rotes Zeug kommt mir nicht ins Haus. Scherr Junior regelte die Angelegenheit mit diplomatischem Geschick. Karl Ludwig Scherr sorgte dafür, dass Ramelows Gewerkschaftsblätter dem Vater nicht mehr in die Hände fielen.
Aber im Prinzip, erinnert sich Ramelow, sei alles prima gewesen. „Ich habe meine Arbeit gemacht und war begeistert.“
Dann schlug das Schicksal zu. Manchmal ist der Teufel ein Eichhörnchen, auf dem Scherrhof steckte es im Trecker. „Die Trecker waren damals nicht so gut gepolstert wie heute“, sagt Leonie Ramelow. Den kurzen harten Stößen beim Rumpeln durch den Weinberg und der schweren Arbeit im Wingert hielt Ramelows Rücken nicht stand. „Ich habe ein Ganzkörperkorsett tragen müssen und konnte die Arme nicht mehr bewegen.“
Als er sich nicht einmal mehr die Strümpfe anziehen konnte, diagnostizierte der Orthopäde einen angeborenen Wirbelsäulenschaden und empfahl Ramelow, die Beamtenlaufbahn anzustreben.
Die Mittsiebzigerjahre. Da kommt manches zusammen, was Bodo Ramelow prägt: Seine Gewerkschaft, die HBV. Die Bekannten und Freunde von der Deutschen Kommunistischen Partei, die als verfassungsfeindlich gilt. Einer von ihnen, Robert Sabo, wird sein Trauzeuge. Das alte Marburg mit seinen Fachwerkhäusern und verschlungenen Gassen. Das universitäre Marburg, das in den 60ern zu einer marxistischen Denk- und Gedenkstätte wird. 1972 ist Marburg die erste westdeutsche Stadt mit DKP-Leuten im Stadtparlament. Die DPK bleibt dort bis 1993 vertreten, ununterbrochen 21 Jahre lang.
Beamter wurde Ramelow nicht.
![]()
Kapitel 2
Kindheit und Jugend
Ramelows Vater stirbt früh; die Mutter, alleinerziehend, zieht mehrmals um. Ramelow leidet an Schreibschwäche und will sie zuerst verstecken, er lernt bei Karstadt und fällt auf durch „Gewissenhaftigkeit, Gerechtigkeit und Leistung“.
Bodo Ramelow wurde am 16. Februar 1956, einem Donnerstag, in der niedersächsischen Kleinstadt Osterholz-Scharmbeck bei Bremen als jüngstes von vier Kindern geboren. Seine Geschwister heißen Hedi, Anette und Hans Joachim, Joschka genannt. Der Februar ’56 war einer der eisigsten der deutschen Wettergeschichte. Bitterkalter Ostwind. Sibirischer Kälteschock.
Das Dasein war gleich hart und blieb es. Daheim wehte protestantischer Geist. Sparsam, genügsam, hart gegen sich und stets gerecht. Hohe Ansprüche.
Bodo Ramelow war noch klein, als er eines Winters fast ertrunken wäre. Was war „Ihr schönstes Erlebnis“ wurde er einmal gefragt. Seine Antwort: „Mein Bruder hat mir mal das Leben gerettet. Als Kinder haben wir in Norddeutschland gelernt, auf großen Eisflächen Schlittschuh zu laufen. Bei einer solchen Gemeinschaftstour mit vielen Freunden bin ich im Eis eingebrochen. Da hat mein Bruder rasch und beherzt eingegriffen. Die Jungs lagen flach auf dem Eis, und ein ausgezogener Pullover wurde schnell zur Rettungsleine.“
Als der Vater, Erwin Otto Walter Ramelow, am 12. Oktober 1967 an den Folgen einer Kriegsverletzung starb, war Bodo elf Jahre alt. Es muss ein Schock gewesen sein. „Er starb in meinen Armen, da ich alleine zu Hause war“, sagt Bodo Ramelow.
Anni Ramelow „aus dem alten protestantischen Geschlecht der Fresenius“, so schreibt es Bodo Ramelow, zog anschließend in ihre pfälzische Heimat zurück. Bei Alzey nahe Worms ließ sich die Familie für kurze Zeit nieder.
„Bodos Mutter war sehr tatkräftig und fröhlich gewesen.“ Vielleicht kommt seine Art von ihr. „Er kann unheimlich fröhlich und lustig sein. Ich habe einige launige Streiks mit ihm gemacht, wo er sich quasi zum Kasper gemacht hat, um die Stimmung zu heben“, sagt Leonie Ramelow.
Anni Ramelow sei eine aufrechte, tapfere Frau gewesen, erinnert sich Ex-Frau Leonie. „Sie war eine der wenigen Frauen aus der Kriegsgeneration, die eine Ausbildung gemacht hatten. Sie war studierte Hauswirtschafterin.“ Das half, die Kinder zu ernähren. Aber „sie hatte ein schweres Leben, weil sie früh allein für die Kinder sorgen musste.“
Bodo Ramelow selbst hat es vor Jahren so beschrieben: „Ich bin Opfer einer Entwicklung, bei der die Mutter versucht, vier Kinder durchzubringen. Es gibt einen Vater, der ausfällt und ständig im Krankenhaus liegt, Geld, das nicht laufend reinkommt, eine Mutter, die nachts in die Spülküche ins Hotel geht.“
Nur wenige Jahre verbrachte Anni Ramelow mit den Kindern in der Pfalz. Bodo war etwa 14, als der nächste Umzug anstand. Der brachte ihn in die Gegend von Marburg, wo er die nächsten 20 Jahre wirkte und seine Karriere begann.
Aus der Pfalz hatte sich Anni Ramelow 1970 erfolgreich auf die Stelle einer Hauswirtschafterin im Internat auf Burg Nordeck beworben. Das Anwesen liegt im Lumdatal bei Rabenau, knapp 25 Kilometer südlich von Marburg. Bodo, jüngstes Kind, zog selbstverständlich mit.
„Ohne Schwierigkeiten“, sagt Leonie Ramelow, „ist Bodo von Karstadt Gießen in die Ausbildung zum Lebensmittelkaufmann übernommen worden.“ Die Ausbildung zum Verkäufer vor allem für Wild und Geflügel begann 1970 und endete 1974. Vom Ausbilder sei er „richtig getriezt“ worden, gab Bodo Ramelow später zu Protokoll.
Eine harte, aber ausgezeichnete Lehrzeit sei das gewesen, blickt er zurück – erkennbar mit Stolz: „Ich war Bester des ganzen Kammerbezirks.“ Bei Karstadt habe er „alles über Wein gelernt“. Auch über Erbsen. „Wir mussten lernen, wie dick eine Erbse zu sein hat, damit sie A-Klasse, B-Klasse oder C-Klasse ist.“ Und über Hummer. „Wie man ihn kocht, wie man ihn isst.“ Sahra, sagt Ramelow und meint Sahra Wagenknecht, Oskar Lafontaines Frau, bekennende Champagner-Kommunistin: „Sahra hätte ihre Freude daran.“
Bereits in der Lehre bei Karstadt ging es um seine Sache: um Qualität, ums Wohl der Kunden. Später, als Bodo Ramelow als HBV-Gewerkschafter Arbeitskämpfe führte, als er, bereits in Thüringen, für die Kali-Kumpel von Bischofferode bis zur Erschöpfung kämpfte und nach der letzten Verhandlung mit dem Auto gegen die Leitplanke prallte, war das ähnlich. Nur hießen die Kunden jetzt Arbeitnehmer.
„Ungerechtigkeit“, sagt Ex-Frau Leonie, „war für ihn immer ein entscheidendes Thema. Er ist ein Mensch, der mit Ungerechtigkeiten nicht klarkommt.“
Woher das kommt? „Es sind ja meistens die Mütter dafür verantwortlich. Vielleicht war das die „Schuld“ von Anni Ramelow. „Ich denke“, sagt Ex-Gattin Leonie, „dass sich Bodo und alle seine Geschwister für andere Menschen einsetzen. Seine ältere Schwester ist zum Beispiel ehrenamtlich in der Kirche aktiv. Diesen Geist gibt es in der Familie ganz einfach.“
Suche nach Gerechtigkeit – einerseits. Andererseits: „Seine Legasthenie ist eine seiner Triebfedern“, sagt Philip Ramelow, 31 Jahre alt.
Bodo Ramelows ältester Sohn spricht aus, wofür sein Vater sich jahrzehntelang schämte. Er, der Perfektionist, der von sich sagt: „Ich bin in der Lage, mir eine Redekonzept von 50 Seiten zu überlegen, und kann das komplett runterdiktieren.“ Diktieren. Bodo, der Diktierer?
„Er hatte immer Angst, dass er entdeckt wird, dass man ihn an einer Stelle trifft, von der er nicht möchte, dass sie gesehen wird“, sagt Philip Ramelow.
Sein Vater, weiß Philip, habe auch „immer das Gefühl gehabt, anderen ein Stück weit unterlegen zu sein“. Also habe er sich „die Mühe gem...