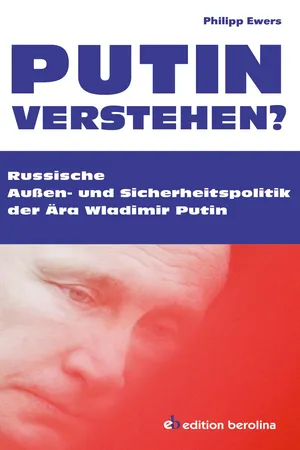![]()
Vorbemerkungen
Ende August 2014, Iwangorod, russisch-estnische Grenze.
Ein wunderschöner Spätsommernachmittag. Ich stehe an einem der westlichsten Zipfel Russlands, auf den Zinnen der mächtigen altrussischen Festung Iwangorod (ИвангоÏрод), hoch über einer Biegung des Narwa-Flusses, kurz vor dessen Mündung. Ich befinde mich auf der Rückreise nach einem Arbeitsaufenthalt in Russland, Recherchen in russischen Archiven und Gesprächen mit russischen Politikern und Historikern. Fast zweitausend Kilometer südöstlich von hier spielt sich währenddessen ein blutiges Drama ab, das in der umfassenden Niederlage der ukrainischen Streitkräfte und den mit ihr verbündeten (?), von Oligarchen finanzierten und aus der Hooliganszene von Kiew und Lemberg rekrutierten Freikorps bei Ilowaisk im Kampf gegen die Donbass-Separatisten seinem vorläufigen Wendepunkt entgegengeht.
Bei einem Zwischenstopp in Iwangorod an der russisch-estnischen Grenze blicke ich nun von hier oben, hoch über dem flachen Umland, auf ein Idyll. Die Narwa fließt gemächlich Richtung Westen, von der nahen Ostsee streicht ein sanfter warmer Wind herüber, das estnische Städtchen, das den Namen des Flusses trägt, liegt hinter grünen Bäumen versteckt, in der Ferne meint man das etwa zehn Kilometer entfernte Meer in der Sonne blinken zu sehen. Direkt gegenüber, am anderen Flussufer, erhebt sich eine etwas kleinere, ältere Burg, die so genannte Hermannsfeste (Hermanni linnus), erbaut um die Mitte des 13. Jahrhunderts, rund 150 Jahre vor der Feste Iwangorod. Die Hermannsfeste war im Mittelalter die östlichste Befestigung des Deutschen Ordens. Das Gewässer zwischen beiden Bollwerken markiert seit über tausend Jahren die Grenze zwischen russischem und estnischem Siedlungsgebiet, und damit seit 2004 auch die Außengrenze von NATO und Europäischer Union.
Das scheinbar so friedliche Idyll steht jedoch für ein Jahrtausend blutiger Konfrontationen zwischen Russland und seinen westlichen Nachbarn. Es steht für den deutschen (westeuropäischen) Drang nach Osten, für »Missionierung«, für »Kolonisierung«, aber auch für die russischen Abwehrbemühungen, für militärische Eroberungen, für die Erkenntnis, dass die eigene Sicherheit entscheidend von der eigenen militärischen Stärke und Verteidigungsbereitschaft abhängt. Das friedliche Idyll trügt also, denn in der Vergangenheit überwogen hier Schlachtgetümmel und menschliches Leid, zuletzt gerade mal vor fünfundsiebzig Jahren im entsetzlichen Zweiten Weltkrieg (wenn man die Scharmützel bei der Auflösung der Sowjetunion mal außen vor lässt).
Wird die Ukraine tatsächlich EU- und NATO-Mitglied, so wird sich die Grenze des Bündnisses um anderthalbtausend Kilometer nach Osten verschieben, liegt Moskau gerade mal noch vierhundert Kilometer von der nächsten NATO-Grenze entfernt. Es gehört schon ein erhebliches Maß an historischer Verblendung dazu, russische Bedenken gegen eine solche Veränderung als unverschämte Anmaßung zu verurteilen, wie das in der westlichen Presse regelmäßig passiert. Dass die Vereinigten Staaten von Amerika zunächst Nord- und Südamerika, später die gesamte Welt unwidersprochen zur amerikanischen Einflusssphäre erklären durften (Monroe-/Truman-/Wolfowitz-Doktrin), fast schon nach Gutdünken weltweit politisch und militärisch eingreifen, so gut wie jeden Erdenbürger umfassend auszuspionieren in der Lage sind, per Joystick jedes Jahr Dutzende vermeintlich Schuldiger ermorden (und dabei »Kollateralschäden« mit Tausenden von toten Zivilisten in Kauf nehmen), sich selbst dabei sogar das Recht zu völkerrechtswidrigen Präventivkriegen zusprechen, wird dabei ebenso unterschlagen wie die traumatischen russischen Erfahrungen der letzten anderthalb Jahrtausende mit Feinden, die vor den Grenzen aufmarschieren und ausnahmslos früher oder später losschlagen.
Das Jahr 2014 markiert eine Epochenwende. Sechs Monate Ukraine-Krise und Bürgerkrieg zwischen Februar und August genügten, um ein Vierteljahrhundert Entspannung in den Ost-West-Beziehungen zu beenden, alle zwischenzeitlich erreichten Fortschritte in den Ost-West-Beziehungen zunichte zu machen und die finstersten Zeiten des Kalten Krieges wieder auferstehen zu lassen. Standen damals die Westmächte unter Führung der USA gegen die Ostmächte unter Führung der Sowjetunion, so stehen jetzt die Westmächte unter Führung der USA gegen das international scheinbar isolierte Russland. Während Russland trotz allem noch von »unseren Partnern im Westen« spricht, haben EU, NATO und die USA die alte Blockkonfrontationssprache wieder ausgepackt, Duktus und Stil der Rhetorik um 25 Jahre zurückgestellt, scharfe wirtschaftliche Sanktionen in Kraft gesetzt, wobei Russland unter kompletter Missachtung der Veränderungen des letzten Vierteljahrhunderts gleichsam automatisch als Feindbild an die Stelle der Sowjetunion und der gesamten Warschauer Vertragsstaaten gesetzt wurde.
Wie konnte es dazu kommen? Das vorliegende Buch versucht, hierauf Antworten zu finden. Im Mittelpunkt des ersten Teils steht die neue russische Außen- und Sicherheitspolitik seit dem Amtsantritt von Präsident Wladimir Putin im Jahr 2000. Mit seinem Erscheinen auf der internationalen Polit-Bühne begann ein neues Zeitalter, da sind sich das pro- und das antirussische Lager einig. Im angelsächsischen Raum ist er schon zum Namensgeber einer neuen Epoche geworden, wird die Zeit seiner Herrschaft schon als »Putinismus« bezeichnet. Nur werden die seitdem von ihm in Gang gesetzten Veränderungen in beiden Lagern sehr unterschiedlich beurteilt. Gilt Putin eingefleischten Russophobikern als Verkörperung ihres Alptraums in Person eines Mannes, der die alte Sowjetunion unter Einsatz aller legalen und illegalen Mittel imperial wieder auferstehen lassen will, so gilt er dem russophilen Lager als Wundertäter, der ein bankrottes Land am Rande des Zusammenbruchs, auf bestem Weg zu einem failed state, wieder zu einer der führenden Weltmächte machte, der dafür sorgte, dass Sozialleistungen und Renten nicht nur wieder ausgezahlt, sondern auch auf ein vernünftiges Maß erhöht wurden.
Putin wird von ihnen gepriesen als Reorganisator der seit dem Zerfall der Sowjetunion orientierungslosen und chronisch unterfinanzierten russischen Streitkräfte, als Sieger im Kampf gegen die unumschränkte Herrschaft und Selbstbedienungsmentalität der Oligarchen, die seit 1989 zu Spottpreisen und häufig genug unter Einsatz krimineller Mittel sowjetische Staatskonzerne und Rohstofflagerstätten in ihren Besitz gebracht hatten und sich seitdem in den Hochglanzgazetten der westlichen Welt als neue Mitglieder der Milliardärskaste feiern ließen, und schließlich als jemand, der der Innen- und Außenpolitik des Landes erstmals wieder seit dem Zerfall der Sowjetunion so etwas wie eine Generalrichtung, eine übergreifende Zielsetzung verlieh. Er repräsentiert für sie denjenigen, der Russland nach außen wieder eine Stimme unter den führenden Weltmächten verschaffte, die Funktion Russlands als Selbstbedienungsladen für westliche Konzerne und Spin Doctors beendete, und nach innen Ruhe und Ordnung wieder herstellte. Russland stand 1998 tatsächlich kurz davor, nach der Entlassung aller übrigen Teilrepubliken der Sowjetunion in die Unabhängigkeit selbst in seine Bruchstücke zu zerfallen.
Wozu das im Zweifelsfall geführt hätte, lässt sich in allen Regionen studieren, in denen die Westmächte seit den 1980er Jahren »führend« eingegriffen haben, im Namen von Demokratie, Freiheit, Menschenrechten und Marktwirtschaft: von der Finanzierung der antisowjetischen Peschmerga und Taliban in Afghanistan über die Förderung sämtlicher Unabhängigkeitsbewegungen im nahen und mittleren Osten – wobei Unabhängigkeit hier für eine Abkehr der Orientierung auf die Sowjetunion bzw. Russland stand, und deren umgehenden Ersatz durch eine Orientierung auf das Lager der westlichen Industrienationen samt einer Öffnung der Märkte, der Rohstoffpotenziale und der Industrieproduktionszentren für westliche Banken und Konzerne –, bis hin zu den humanitären Katastrophen, die durch die direkte »Einflussnahme« westlicher Player in Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien und vielen anderen Ländern zu verzeichnen sind. Stabile, soziale, säkulare Staatsorganisationen, zugegebenermaßen teilweise – nach westlichen Maßstäben – »diktatorischen Zuschnitts«, wurden zerschlagen, weil sie sich nicht direkt und bedingungslos den westlichen bzw. saudi-arabischen Vorstellungen unterordneten. Letztlich diente die Zerschlagung der Staatlichkeit dieser Länder dazu, die verbliebenen Staatsruinen im Kampf beispielsweise gegen Russland zu instrumentalisieren, das zuvor auf der Welle des hohen Ölpreises immer stärker geworden war, immer gigantischere Reservefonds angehäuft hatte und damit immer weniger erpressbar geworden war.
Die zuständige Ministerin in Russland hat Ende 2014 vorhergesagt, dass die staatlichen Reservefonds durch den künstlich niedrig gehaltenen Ölpreis und die damit verbundene drastische Reduzierung der Staatseinnahmen Russlands sowie infolge der wirtschaftlichen Sanktionen seitens USA, EU und den üblichen Verdächtigen längstens 2017 bis zur letzten Kopeke für Ausgleichsmaßnahmen aufgebraucht sein werden. Sollte sich der Ölpreis also in den kommenden zwei Jahren nicht wieder erhöhen, sprich deutlich Richtung 100 Dollar pro Barrel bewegen, würde Russland auf Dauer erpressbar bzw. durch die fehlenden Einnahmen und die dadurch erzwungenen Sparmaßnahmen destabilisiert. Der Ausgang dieses weltgeschichtlichen Ringens ist also noch offen. Vorerst hat sich der Ölpreis im Frühjahr 2015 allerdings bei 60 Dollar eingependelt und ist nicht weiter gefallen, gleichzeitig hat sich auch der Rubelkurs deutlich erholt. Die weitere mittelfristige Entwicklung wird zeigen, wohin die Reise geht.
Zum Verständnis der aktuellen Außen- und Sicherheitspolitik Russlands ist – wie schon erwähnt – die Kenntnis zumindest der Grundzüge russischer Landesgeschichte unerlässlich. Daher enthält der zweite Teil des Buches eine überblicksartige Zusammenstellung der Geschichte Russlands sowie eine Analyse der Beziehungen Russlands zu anderen führenden Weltmächten im Lauf der vergangenen Epochen. Russland mit seiner über tausendjährigen Geschichte wurde – das gerät im Westen gern in Vergessenheit – von bestimmten Ereignissen geprägt, die in der nationalen Erinnerung fest verankert sind, die also das eigene »Narrativ« bestimmen, ohne dass dies im Westen normalerweise in der notwendigen Weise berücksichtigt wird. Lässt man diese Ereignisse und ihre Auswirkungen bis in die Gegenwart außer Acht, muss jeder Versuch, die russische Außenpolitik angemessen zu beurteilen, scheitern.
Noch zwei letzte Vorbemerkungen: Auf die aktuellen Ereignisse in der Ukraine gehe ich im vorliegenden Buch insofern ein, wie sie für die russische Außenpolitik von Bedeutung sind. Für eine aktuelle Betrachtung der jüngeren Geschichte der Ukraine verweise ich auf das unlängst in diesem Verlag erschiene Buch von Reinhard Lauterbach: Bürgerkrieg in der Ukraine – Geschichte, Hintergründe, Beteiligte (Berlin 2014). Die düsteren Seiten des Kommunismus werden in diesem Buch nur am Rand gestreift, da ich sie einerseits als bekannt voraussetze, andererseits die 74 Jahre seit der Oktoberrevolution in der tausendjährigen Geschichte Russlands aber auch nur eine kurze Phase darstellen.
Philipp Ewers
im Frühjahr 2015
Teil 1
Wladimir Putin
![]()
Das Wendejahr 2000 – Wladimir Putin betritt die Bühne
Das nachsowjetische Russland hatte gerade den Tiefpunkt seiner Geschichte, den Staatsbankrott von 1998, durchschritten. Da erklärte Boris Jelzin, Präsident des Landes, der »Zertrümmerer der Sowjetunion«, in einem letzten der von ihm so geliebten Überraschungscoups, im Dezember 1999 seinen Rücktritt. Schon länger hatte es deutliche Anzeichen dafür gegeben, dass der von jahrzehntelangem schweren Alkoholismus geschädigte Körper des 68-Jährigen den Belastungen eines Spitzenamts nicht mehr gewachsen war. Immer länger waren die Krankenhaus-, Rehabilitations-, Sanatoriums-, »Erholungs«-Aufenthalte fernab der großen Politik geworden in den letzten Amtsjahren. Und schon länger hatte die »Familie«, das Geflecht von Günstlingen, Beratern, Förderern und echten Familienmitgliedern um den Präsidenten herum, beratschlagt, auf welchem Wege es zu bewerkstelligen sei, dass man auch bei einem Austausch der Person auf dem obersten Posten Russlands weiter Zugriff auf die Fleischtöpfe der Macht behalten könne. Im Dezember 1999 hatte man offenbar eine Lösung gefunden. Man präsentierte zeitgleich zum Rücktritt einen Nachfolger, der genau dies für die »Familie« sicherstellen sollte: weiteren, uneingeschränkten Zugriff auf die milliardenschweren Ressourcen des Landes.
Amtierender Präsident des Landes wurde der kurz zuvor – in Vorbereitung dieses Coups – zum Ministerpräsidenten ernannte, bis zu diesem Zeitpunkt als unscheinbarer Apparatschik aus dem russischen Provinzial-Politikbetrieb geltende Wladimir Putin. Sein Name sagte den meisten nationalen und internationalen Kommentatoren überhaupt nichts. Bei seiner Ernennung zum Ministerpräsidenten war man noch davon ausgegangen, es handle sich um eine jener austauschbaren Servilitäten, die in Jelzins Spätphase als Präsident sich in immer schnellerer Abfolge auf dem Amt des Ministerpräsidenten ablösten. Doch Jelzin hatte zugleich mit seinem Rücktritt auch eben diesen Wladimir Putin in einem Rückgriff auf Mechanismen imperial-russischer Zeiten zu seinen Wunschnachfolger erklärt. Putin galt zu diesem Zeitpunkt als tumber Jelzin-Gefolgsmann, als Jelzinist, der die Amtszeit seines Vorgängers virtuell verlängern und dem Jelzin-Clan künftig dienen sollte. Doch sowohl der Jelzin-Clan als auch die Beobachter, die Putin als Zählkandidat für das Amt des künftigen Präsidenten Russlands ansahen, hatten sich getäuscht. Mit Putin stand jemand in den Startlöchern, der die Geschichte Russlands grundsätzlich verändern sollte, der einer ganzen Epoche seinen Namen verleihen und den Wiederaufstieg des Landes unter die führenden Weltmächte bewerkstelligen sollte. Wie war Putin an diese Position gelangt, was hatte er vorher gemacht, und wie hatte er die »russische Wende« bewerkstelligt, vom Absturz ins allgemeine Elend zum Wiederaufstieg, was sind also die Eckpunkte seiner Politik, seiner Ideologie, letztlich also seiner Außen- und Sicherheitspolitik, die untrennbar mit der allgemeinen bzw. der Innenpolitik verbunden ist – diesen Fragen soll im Folgenden nachgegangen werden.
![]()
Aufstieg in Jelzins Entourage
Der gebürtige Leningrader Wladimir Wladimirowitsch Putin, Jahrgang 1952 (geboren am 7. Oktober, für die, die es genau wissen wollen), aus einfacher Familie, schloss sein Jura-Studium an der örtlichen Universität 1975 mit einer Facharbeit über die Meistbegünstigungsklausel im internationalen Rechtsvergleich ab. An der Leningrader Universität gehörte er zu den Studenten von Jura-Professor Anatoli Sobtschak, der später noch einmal eine wichtige Rolle in seinem Leben spielen sollte. Der damals 23-jährige Putin, der schon als Schüler eine Vorliebe für die Spionage-Serien im sowjetischen Fernsehen hatte, bewarb sich nach dem Studium beim KGB und wurde für ein Jahr Auszubildender an der 401. KGB-Schule in Ochta (Stadtteil von Leningrad, an der Mündung von der Ochta in die Newa), was auch eine militärische Ausbildung einschloss. Putin arbeitete zunächst in der Leningrader Abteilung für Gegenspionage (2. Hauptdirektorat), bevor er zum Ersten Hauptdirektorat der KGB-Vertretung in Leningrad versetzt wurde, zu dessen Aufgabe die Überwachung von Ausländern und dem Konsularpersonal in der Stadt gehörte. Nach zehn Jahren beim Leningrader KGB-Büro wurde der mittlerweile 33-jährige Putin 1985 ins »befreundete sozialistische Ausland« versetzt, nach Dresden in die Deutsche Demokratische Republik. Versetzungen in die DDR gehörten damals zu den beliebten Auslandsstationen innerhalb des KGB, da der Lebensstandard höher als in der UdSSR war und ein Teil des Lohns in Valuta (Dollar) ausgezahlt wurde. Zuvor hatte Putin noch seine Freundin Ludmilla geheiratet, die ihn ins Ausland begleitete. In Dresden arbeitete Putin für das Direk...