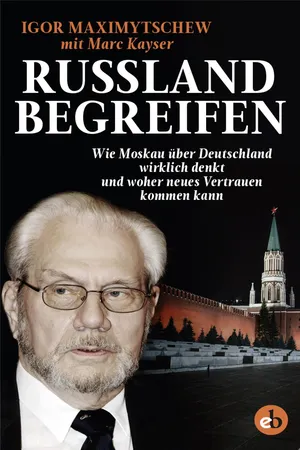![]()
1. Kapitel
Wovon wir ausgehen
Vor die Entscheidung gestellt, ob sich ein weiterer Versuch lohnen würde, das heutige Russland für die Deutschen begreiflicher zu machen, verspürte ich eine ziemliche Unschlüssigkeit. Ich war mir nicht auf Anhieb im Klaren darüber, ob diesbezügliche Anstrengungen – eingedenk dessen, sich in einer fremden Sprache zu äußern – einen praktischen Sinn haben oder nur verlorene Mühen sind. Gewiss ist das Ziel, das gegenseitige Verständnis zwischen den Völkern zu fördern, edel und konstruktiv, zumal es sich um die beiden zahlenmäßig größten Nationen Europas handelt. Der Frieden des Kontinents und damit der Frieden der Welt ist zu einem wesentlichen Teil nur zu erhalten, wenn die Deutschen und die Russen zusammen dafür stehen. Die Zeugnisse der Geschichte sprechen eine klare Sprache. Um der friedlichen Ordnung in Europa und in der Welt willen müssen Deutschland und Russland am gleichen Strang der gemeinnützigen Kooperation ziehen.
Andererseits sind westliche Voreingenommenheit und aberwitzigste Vorurteile Russland gegenüber so weit fortgeschritten, dass einem starke Zweifel kommen müssen, ob eine Gegenwirkung – mit Chancen, gehört zu werden – überhaupt noch möglich wäre. Die Wellen der Russophobie schlagen heute so hoch, dass im Westen ein Blick nach vorn fast komplett verstellt ist. Die Situation scheint viel schlimmer zu sein als zu den Zeiten des Kalten Krieges. Damals hatte der Westen noch Achtung vor der Sowjetunion, und eine gemeinsame Lösung der Weltprobleme lag, wenigstens teilweise, im Bereich des Möglichen. Heute zieht man es vor, mit Russland mittels Sanktionen zu kommunizieren und alles, was es sagt, sogleich als hinterlistige Finte zu verschreien. Es ist buchstäblich zum Heulen: Wenn ich mit den Deutschen – auch mit den gutmeinenden, weltoffenen Deutschen – spreche, prallen in der Regel meine Plädoyers am Panzer von Befangenheit ab. Die nächste Phase nach dem Dialog der Gehörlosen ist gewöhnlich eine komplette Verstummung beiderseits, und die wäre die gefährlichste Phase im internationalen Kontext.
Warum ich dieses Buch schreiben musste
So hatte ich mich zur positiven Stellungnahme wortwörtlich durchzuringen – mit aller Kraft gegen meinen verständlichen Hang zum Pessimismus kämpfend. Ich tat das Äußerste, um aus der Geschichte – so wie sie ist und bleibt – ein bisschen Hoffnung zu schöpfen. Die schwierigste Zeit für das deutsch-russische Verhältnis war bestimmt der Zweite Weltkrieg mit dem Holocaust und all seinen anderen Nazi-Gräueltaten. Während ich 1944 als Viertklässler zum ersten Mal eine Deutschstunde besuchte (damals war Deutsch als Fremdsprache in allen Schulen der Sowjetunion Pflicht), sagte uns die Lehrerin: »Ich verbitte mir, eine Deutsche genannt zu werden. Ich bin eine Russin, wie ihr es auch seid. Ich werde euch aber Deutsch beibringen, da ihr die Sprache des Feindes beherrschen müsst.«
Die wichtigste historische Bilanz der Jahre, die seitdem ins Land gegangen sind, ist, dass Deutsch sich für die Russen längst von der »Sprache des Feindes« in die »Sprache des guten Nachbarn«, bisweilen auch die »Sprache des Freundes«, verwandelt hat. Der große Verdienst fällt dabei dem antifaschistischen Wesen der DDR zu, die von Anfang an von den meisten Russen als Freund und Verbündeter empfunden wurde.
Ich hatte die Ehre, diesen Prozess der Gesundung des deutsch-russischen Verhältnisses mitzugestalten. Nach der Schule habe ich mein Deutschstudium am Moskauer Institut für Internationale Beziehungen fortgesetzt. 1956 trat ich meinen ersten diplomatischen Job im Konsulat in Leipzig an. Leibhaftige DDR-Bürger lernte ich bereits im Studentenheim des Instituts kennen. In Leipzig gab es einen breiteren Raum für die Bekanntschaften in allen Schichten der Bevölkerung. Unsere kleine Tochter Anja begann zu sächseln, noch bevor sie richtig russisch sprach. In der DDR beziehungsweise in den ostdeutschen Ländern nahm meine diplomatische Laufbahn auch ihr Ende: 1987 bis 1992 war ich Gesandter und Stellvertreter des Botschafters in der Botschaft der UdSSR/Russlands in Berlin in der Straße Unter den Linden. In der Zwischenzeit war ich zweimal in der Bundesrepublik amtlich akkreditiert: zuletzt 1976 bis 1984 als Kulturattaché an der Botschaft in Bonn. So darf ruhig angenommen werden, dass ich nicht nur eine Art Kenner Deutschlands geworden bin, sondern auch ein Experte für die Entwicklungen im deutsch-russischen Verhältnis der vergangenen sechzig Jahre. Umso mehr, da ich ab 1993 am Europa-Institut der Russischen Akademie der Wissenschaften in Moskau als Forscher im Bereich der europäischen Sicherheit tätig war und bin; Deutschland spielt hier eine herausragende Rolle.
Langer Rede kurzer Sinn: Mit so einer Qualifikationsurkunde konnte ich mich unmöglich der Aufgabe entziehen, zu beschreiben, was nach dem 22. November 2005, als Angela Merkel Bundeskanzlerin wurde, allmählich in akute Gefahr geriet. Zu beginnen wäre jedoch logisch mit der Zeitenwende 1999.
Wer ist der wirkliche Herr der Ringe?
Die Aufgabe, an die Wurzeln der west-östlichen Entfremdung nach der Idylle der demonstrativen Friedfertigkeit der neunziger Jahre zu gehen, ist und bleibt verdammt kompliziert. Der Westen, Deutschland inklusive, hat erst nach einem ganz unerwartet heftigen russischen Protest gegen die NATO-Bombardements auf Jugoslawien 1999 zu seinem großen Erstaunen entdeckt, dass Russland weiterexistiert. Als der russische Premierminister Jewgenij Primakow seinen vereinbarten offiziellen Besuch in Washington beim Bekanntwerden des NATO-Angriffs absagte – und sein Flugzeug eine demonstrative Kehrtwende vor der Küste Amerikas vollbrachte –, geschah etwas Einmaliges für die Sieger im Kalten Krieg. Bis dahin war man in den westlichen Hauptstädten der fröhlichen Überzeugung, Russland sei auf dem besten Wege, das Schicksal der Sowjetunion zu wiederholen. Der Abschlusstag des Abzugs der Westgruppe der russischen Truppen von deutschem Boden 1994 wurde insbesondere von der deutschen Regierung als Beginn der Begräbniszeremonie für den Hauptnachfolgestaat der Sowjetunion empfunden. Nein, formell war alles in Ordnung. Man hat sogar Staatspräsident Boris Jelzin zu den G8-Gipfeln eingeladen. Nur hatte niemand vor, die Interessen Russlands, vor allem seine Sicherheitsinteressen, ernst zu nehmen. Der Verlierer sollte jederzeit die schwere Hand der Herren der Lage zu spüren bekommen.
Dabei ignorierten die oberen Etagen der Regierungsämter der Westmächte, dass Russland nicht nur ein Nachfolger war, sondern auch und vor allem ein ganz neuer Staat – mit der dem Westen verwandten Staatsideologie und Wirtschaftsphilosophie, mit völlig neuen Leuten am Staatsruder, mit brennendem Wunsch, als Teil der neuen globalen Welt anerkannt zu werden. Stellte die Sowjetunion eine Alternative zur im Westen bestehenden kapitalistischen Weltordnung dar – ob diese Alternative gut oder weniger gut war, ist eine andere Frage –, war das neue Russland bereit und willig, sein Haus »wie im Westen« einzurichten. Man ahmte alles nach: wirtschaftliche Grundlagen, politische Spielregeln, Allmacht des Geldes, globale Pax-Americana-Vorstellungen. Vom Westen wurden auch typische kapitalistische Schwächen und Sünden übernommen – wie etwa der Gegensatz zwischen Arm und Reich, die soziale Unsicherheit, Arbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit.
Das Streben der Führung des neuen russischen Staates, sich bei den westlichen Lehrmeistern lieb Kind zu machen, zog unausweichlich katastrophale Folgen für die Masse der russischen Bürger nach sich. Die Politik des Westens und das Agieren seiner russischen Anbeter riefen einen allgemeinen Notstand im Land hervor. Statistiker haben festgestellt, dass der Schaden, den Russland nach dem Zerfall der Sowjetunion erlitt, mit den Verlusten vergleichbar ist, die im Ergebnis der Revolutionen von 1917 und des nachfolgenden Bürgerkriegs sowie im Großen Vaterländischen Krieg 1941–1945 entstanden sind. Die neunziger Jahre sind ins russische Volksgedächtnis als eine »böse Zeit« eingegangen, da sie Ruin der Wirtschaft, Verelendung der Bevölkerung, Zügellosigkeit der Oligarchen, Wüten der Kriminalität, Entfesselung von Politiker- und Beamtenwillkür, Zertrümmerung der Streitkräfte (mit Ausnahme des Nuklearpotentials, Gott sei Dank!), offene ausländische Einmischung in die Innen- und Außenpolitik des Landes (so hat die US-Botschaft in Moskau mehrmals den Autokraten Boris Jelzin von der Absetzung ihres Favoriten Andrej Kosyrew vom Posten des russischen Außenministers abgehalten, zum größten Missvergnügen Jelzins) und Massenverbrechen internationaler, hauptsächlich islamistischer, Terroristen im ganzen Staatsgebiet gebracht haben. Und kein einziger Hoffnungsschimmer in Sicht!
Verständlicherweise rief diese bedrückende Situation nach dem Zerfall der UdSSR eine eindeutig ablehnende Haltung der russischen Gesellschaft gegenüber einem blinden Kopieren der westlichen Lebensordnung hervor. Es blieb unbekannt, ob die »Armeen« der westlichen Berater und Konsultanten, die damals Russland überflutet zu haben schienen, etwas vom Anwachsen derartig negativer Stimmungen an ihre Hauptquartiere berichteten. Wenn ja, blieben diese Warnungen unbeachtet. Die Politik des Westens, der NATO-Ostfeldzug inklusive, blieb die gleiche. Kein Wunder: Russland war für den Westen völlig bedeutungslos geworden – sein Schicksal schien vorbestimmt, das Ende schien unmittelbar bevorzustehen. Die Panzer, die 1993 auf das russische Parlament im Zentrum Moskaus unter Applaus des Westens feuerten – was sollte noch Schrecklicheres geschehen, damit ein kompletter Zusammenbruch anerkannt werden würde?
Zwei Schlussfolgerungen aus dieser Zeit stehen für die Russen fest: Erstens: Der Westen mag die russischen Politiker nur, wenn diese schwächlich und unterwürfig sind. Zweitens: Je schlimmer es Russland geht, desto besser scheint sich der Westen zu fühlen.
Solange diese Linien die Weltlage beherrschen und weiterhin bestimmen, bleibt ein vernünftiges gemeinsames Herangehen an die brennendsten globalen Probleme unmöglich. Die vielversprechenden Versuche der Regierung Jewgenij Primakow, ein bisschen Ordnung im außenpolitischen Bereich sowie in der Wirtschaft Russlands zu schaffen, schlugen fehl, da man ihm von innen wie auch von außen keine Zeit ließ, sie zu vollenden. Der russische Protest gegen den NATO-Krieg in Jugoslawien – der erste Krieg in Europa seit 1945 – verhallte ergebnislos. Ohne Konsequenzen blieb auch der wagemutige Vorstoß der russischen Fallschirmjäger nach Pristina in Kosovo. Enttäuschung, Zorn und Empörung griffen in Russland um sich. Zum ersten Mal trat eine nostalgische Erinnerung an die Sowjetzeit zutage, wo das Leben vielleicht verhältnismäßig grau, aber gesichert war und die Stimme des Landes doch nicht so einfach vom Westen überhört werden konnte.
Und dann kam Wladimir Putin
Wenn es allemal stimmt, dass er seiner russischen Heimat den persönlichen Stempel aufsetzte, muss auch gleichzeitig zugegeben werden, dass Wladimir Putins Charakter von Russland geformt worden ist. Am Ende des vorigen Jahrhunderts brauchte das Land dringend einen Chef, der imstande war, einen Ausweg aus der Katastrophe zu finden, die über Russland und die Russen hereinbrach. Einen Chef, der die Volksseele, die sagenhafte russische Seele, verstehen und achten konnte und etwas für ihr Gerechtigkeitsgefühl unternahm. Einen, der das Wohlergehen des Landes über seine persönliche Prosperität stellte und danach handelte – im Rahmen der vorliegenden Möglichkeiten gewiss, aber zielbewusst und mit Nachdruck. Boris Jelzin gebührt ein nachhaltiger Dank der Nation dafür, dass er Wladimir Putins Kandidatur für den Posten des Präsidenten Russlands vorschlug. Das war vielleicht seine einzige positive Tat als russisches Staatsoberhaupt.
Dem absoluten Neuling an der russischen politischen Spitze hingen keine Bindungen zu den Mafiosi um Jelzin nach, deren Machenschaften allgemein bekannt waren. Er wurde sofort zum Hoffnungsträger des Landes. Als solcher wurde er vom Wähler akzeptiert. Vorschusslorbeeren mussten sich nachträglich als verdient erweisen. Zwar stand Putin noch eine längere Periode des staatsmännischen Heranreifens bevor, doch er arbeitete viel und gern. Er lernte das Land mit all seinen vielschichtigen Problemen und Schmerzen kennen. Andererseits lernte das Land Putin kennen – seine umsichtige Methode, mit Widrigkeiten fertigzuwerden, seinen Hang zu überraschenden Gegenzügen und seine Abneigung, Vertrauensleute aus seiner Umgebung bloßzustellen. Man schätzte schnell seine Gesetzestreue und seine Art, sanft und gleichzeitig beharrlich vorzugehen. Letztlich bildete sich eine Art verlässlicher Verschmelzung des Präsidenten und seines Landes.
Putin bereist regelmäßig das ganze Land. Zweimal im Jahr stellt er öffentlich einen direkten mehrstündigen mündlichen Kontakt zur Bevölkerung beziehungsweise zu Journalisten aller Schattierungen her, dessen Verlauf das Fernsehen an jeden Interessierten heranbringt. Nicht alle Politiker, auch in den wohlhabendsten Ländern der Welt, können von sich behaupten, sie kennen die Stimmung ihrer Mitbürger. Putin kann das, und er handelt danach. Das ist der Grund dafür, dass er wie kein anderer in Russland das Vertrauen der überwältigenden Mehrheit seiner Landsleute besitzt. Es ist ein seltenes Phänomen nicht nur für Russland, dass ein Spitzenpolitiker nach so vielen Jahren des Regierens solch eine phantastische Popularität genießt wie Putin.
Dabei ist es für jeden in Russland kein Geheimnis, dass das Land auch heute einen Haufen von Problemen hat. In der Wirtschaft rühren die einen noch aus der Sowjetzeit her – zum Beispiel die Abhängigkeit des Staatshaushalts von den Einnahmen von Erdöl- und Erdgasausfuhren. Die anderen sind neu: Da Russland zielbewusst ein konstitutiver Teil der Weltwirtschaft geworden ist, wirken sich die Krisen der internationalen Märkte auch direkt auf den Zustand der russischen Wirtschaft aus. Aus den neunziger Jahren stammt die besonders schmerzhafte Unsitte der Verzögerung von Lohnauszahlungen in den Privatbetrieben, wenn dort finanzielle Schwierigkeiten aufkommen – und das passiert oft.
In der Innenpolitik bedingt die föderative Struktur des russischen Staates (85 Gebiete, Regionen und Nationalrepubliken) eine begreifliche Kompliziertheit der täglichen Verrichtung der Staatsangelegenheiten...