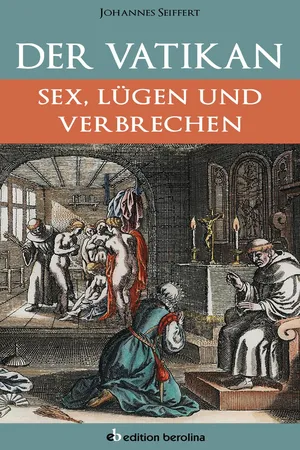
- 352 pages
- English
- ePUB (mobile friendly)
- Available on iOS & Android
eBook - ePub
About this book
Der Vatikan - Sex, Lügen und Verbrechen. Johannes Seiffert untersucht unvoreingenommen und detailgenau die düstersten Kapitel aus 2000 Jahren Kirchengeschichte. Wie sieht es wirklich hinter den dicken Mauern aus? Wie hält man es dort mit der Wahrheit, dem Zölibat, dem Sex? Der Autor analysiert das Lügengebilde, auf dem die Katholische Kirche aufgebaut ist, überprüft die angebliche Heiligkeit führender Kirchenvertreter kritisch und benennt die zahllosen Verbrechen, die im Namen des Gekreuzigten begangen wurden und werden.
Frequently asked questions
Yes, you can cancel anytime from the Subscription tab in your account settings on the Perlego website. Your subscription will stay active until the end of your current billing period. Learn how to cancel your subscription.
No, books cannot be downloaded as external files, such as PDFs, for use outside of Perlego. However, you can download books within the Perlego app for offline reading on mobile or tablet. Learn more here.
Perlego offers two plans: Essential and Complete
- Essential is ideal for learners and professionals who enjoy exploring a wide range of subjects. Access the Essential Library with 800,000+ trusted titles and best-sellers across business, personal growth, and the humanities. Includes unlimited reading time and Standard Read Aloud voice.
- Complete: Perfect for advanced learners and researchers needing full, unrestricted access. Unlock 1.4M+ books across hundreds of subjects, including academic and specialized titles. The Complete Plan also includes advanced features like Premium Read Aloud and Research Assistant.
We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.
Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.
Yes! You can use the Perlego app on both iOS or Android devices to read anytime, anywhere — even offline. Perfect for commutes or when you’re on the go.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Yes, you can access Der Vatikan by Johannes Seiffert in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in History & World History. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.
Information
Zölibat
Von Jesus selbst ist im Matthäus-Evangelium nur ein Satz überliefert, der allgemein beschreibt, dass es Menschen gebe, die in Ehelosigkeit lebten »um des Himmelreiches willen« – dabei handelt es sich aber keinesfalls um ein Gebot, und schon gar nicht um ein Gebot der Ehe- und Sexlosigkeit für Kirchenvertreter.
Dagegen heißt es im 1983 verabschiedeten und bis heute gültigen kirchlichen Rechtscodex (Codex Iuris Canonici) im eklatanten Gegensatz zur Sinnenfreude und Körperbetontheit des Urchristentums in Canon 277, Absatz 1: »Die Kleriker sind gehalten, vollkommene und immerwährende Enthaltsamkeit um des Himmelreiches willen zu wahren; deshalb sind sie zum Zölibat verpflichtet, der eine besondere Gabe Gottes ist, durch welche die geistlichen Amtsträger leichter mit ungeteiltem Herzen Christus anhangen und sich freier dem Dienst an Gott und den Menschen widmen können.« Damit steht die Kirche – nicht zum ersten- und nicht zum letzten Mal – in diametralem Gegensatz zu dem, was von der mythisch-mystischen Figur Jesus »dem Gesalbten« (Christus) an Äußerungen überliefert ist. Ob diese Verbindung von »Katholischer Kirche« und Zölibat bzw. sexueller Enthaltsamkeit, sexueller Selbstkasteiung und allgemeiner Körper- und Sinnenfeindlichkeit damit zu tun hat, dass eben gerade auf dem Vatikanischen Hügel, etwa an der Stelle, wo heute der Petersdom steht, in römisch antiker Zeit eines der wichtigsten Heiligtümer des Kybele- und Attiskults lag, das so genannte Phrygianum, wäre noch zu erforschen. Auffällig ist, dass es sich bei diesem Kult ausgerechnet um einen Kult der Selbstkasteiung und des freiwilligen Zölibats handelte, der in seinem kultischen Furor so weit ging, die Selbstentmannung, die Autokastration seiner Priester und Anhänger zu fördern und zu fordern. Teil des Phrygianums war das Taurobolium, ein großer Opferaltar, auf dem in regelmäßigen Abständen Ochsen geschlachtet wurden. Das Blut lief durch ein offenes Gitter hinunter und floss auf die unter dem Altar befindlichen Neophyten und Neuanhänger, die sich darauf hin, von der wirbelnden, ekstatischen Musik animiert, nun selbst zu kasteien und zu kastrieren begannen. Möglicherweise sind Geist und Gebot dieses Kults als Teil des Genius Loci auf die Katholische Kirche und ihre obersten Vertreter übergegangen, mit Auswirkungen bis heute.29
Paulus
Man kann nicht über Petrus sprechen, ohne Paulus zu erwähnen. Betrachtet man die Sache nüchtern, müsste man die »Katholische Kirche« eigentlich »Paulinische Sekte« nennen. Niemand vorher oder nachher hat den ursprünglichen Gedanken der angeblichen Jesus-Figur, wie man sie mühsam aus den am wenigsten verfälschten, frühesten Schriften herausfiltern muss, stärker verändert, drastischer in ihr Gegenteil verkehrt als Paulus. Eben nach diesem als Sha’ul (latinisiert Saulus) getauften Mensch wird seit mehr als hundert Jahren eine eigene, die »paulinische Theologie« benannt.30 Würden die entsprechenden Fachwissenschaftler ihre jeweiligen Kurzschlüsse weiterdenken, käme man gar nicht umhin, die gesamte »Katholische Kirche« in »Paulinische Kirche« oder »Paulinische Sekte« umzubenennen.
»Paulus«, von Beruf Zeltmacher, setzte einige der verheerendsten Verfälschungen des ursprünglichen Gedankens ins Werk. Und das Erstaunliche ist, dass ihm dabei fast zweitausend Jahre lang so viele Menschen unkritisch folgten. Er machte aus einer lebensbejahenden, kosmopolitischen, frauenfreundlichen, körperfreundlichen Philosophie ein Theorem des Frauenhasses, der Feindseligkeit, des Chauvinismus, der Lebensverachtung und der Leibfeindlichkeit. Durch ihn gewann die Askese ihre völlig ahistorische, nichts desto weniger jedoch überdominante Stellung in der Katholischen Kirche, durch ihn wurde die Frau in der Kirche zu einem Wesen zweiter (oder dritter) Klasse, durch ihn wird der entsetzliche Irrweg des Mönchtums in die Welt gesetzt. Diese Reihe ließe sich noch lange fortführen. Es dauerte jedenfalls nicht lange, und Frauen waren vom Priesteramt – das sie bis dahin häufig ausgeübt hatten – komplett ausgeschlossen (bis heute). Doch damit nicht genug. Bald wurden auch menstruierende oder schwangere Frauen als »unrein« vom Gottesdienst insgesamt ausgeschlossen, durften diesem also auch nicht mehr als einfache Gläubige beiwohnen.
Paulus verdrehte und verfälschte den ursprünglichen Sinn, die Zielsetzung des Christentums auf einzigartige Weise. Und hatte damit fast zweitausend Jahre lang Erfolg. Erst seit dem 20. Jahrhundert setzte mit der Säkularisierung, mit der Erosion der Anhängerschaft, mit der zunehmenden Entkirchlichung der westlichen Industriegesellschaften eine Entwicklung ein, an deren Ende die Marginalisierung der Katholischen Kirche, ihre Reduktion zu einer von vielen Sekten auf der Welt stehen dürfte. Dass Paulus aber dennoch so erstaunlich lang anhaltenden Erfolg mit seinen Sinnesfälschungen hatte, sollte man nicht als Rechtfertigung für sein Tun heranziehen. Auch andere verbrecherische Ideologeme weisen eine lange Erfolgsgeschichte auf. Damit lässt sich also keine historische Vormachtstellung, kein Anspruch auf Ehre und Ruhm begründen. Stattdessen muss er bei nüchterner Betrachtung als Initiator einer 2000-jährigen Leidensgeschichte angesehen werden, die bis heute andauert: der Geschichte der Katholischen Kirche und der von ihr ausgehenden repressiven Moralvorstellungen, die zu Unterdrückung, Leiden, Folter, Mord und Völkermord führte.
Im Namen dieser paulinischen Kirche wurden »Ungläubige« »missioniert«, indem man sie umbrachte, so zum Beispiel in zahllosen »Kreuzzügen« zur »Befreiung« der damals längst regulär in arabischem Besitz befindlichen Stadt Jerusalem, wurden ganze Kontinente entvölkert (Nord- und Südamerika), wurden »Ungläubige« als »Ketzer« ins Gefängnis geworfen, degradiert, oder gar verbrannt, wurden der Empfängnisverhütung kundige weise Frauen als »Hexen« verbrannt, wurde mit der Inquisition eine der verabscheuungswürdigsten Institutionen geschaffen, wurde die Geschichte zensiert (durch den von der Kirche zusammengestellten »Index der verbotenen Bücher«, der nur noch kirchenfreundliches Schrifttum für die Gläubigen zuließ, die in ewiger Unmündigkeit gehalten werden sollten).
Im Namen dieser repressiven, moralinsauren Kirche wurden viele Generationen ihrer Anhänger im Glauben an die eigene Schlechtigkeit, die eigene Sündhaftigkeit gehalten, eine von Paulus in die Welt gesetzte Wahnvorstellung, die vermutlich auf eine eigene Impotenz, auf seinen mangelnden Erfolg bei Frauen zurückzuführen ist, die ihn dazu brachte, alles Weibliche, alles mit Sexualität verbundene zu hassen und zu verdammen und allen seinen Anhängern rundheraus zu verbieten. Die auf der Basis seiner verqueren Weltanschauung geschaffene »Amtskirche« kooperierte willig mit Diktaturen, förderte die Ausbeutung der Unterschichten in Staaten, in denen sie als Staatskirche das Sagen hatte, forderte ihre Anhänger wörtlich zu kritiklosem, unbedingten Gehorsam auf, und verbot zeitweise jegliche Freudenempfindung als »unchristlich«. Die von Paulus begonnene Hierarchisierung der vorher basisdemokratischen Glaubensgemeinschaft führte zu der heute noch existierenden »Amtskirche« mit ihrer Verschwendung, dem aufgeblähten, überflüssigen Apparat an »Würdenträgern«, dem maßlosen Anspruch, über Wohl und Wehe aller Menschen auf dieser Erde zu entscheiden. In seinem Namen entstand nicht zuletzt das Papsttum, von dessen Verfehlungen, Abirrungen und Verbrechen auf den folgenden Seiten die Rede sein wird.
Auch Paulus soll in Rom zum Märtyrer geworden sein, im Umfeld des großen Brandes und der anschließenden Christenverfolgung. Als römischer Bürger wurde er wohl nicht gekreuzigt, sondern mit dem Schwert enthauptet. Sein Grab soll sich in der Kirche Sankt Pauk vor den Mauern befinden.31 Anderen Überlieferungen zufolge kam Paulus nicht in Rom ums Leben, sondern reiste munter weiter bis nach Spanien.
Die ersten Päpste nach »Petrus« kann man getrost übergehen, da sie – wie gezeigt – pure Erfindung sind, nachträglich ausgedacht als Belege für die ununterbrochene Liste der apostolischen Sukzession in der Nachfolge des ersten Papstes »Petrus«. Zu diesen historischen Konjekturen gehört auch der »heilige« Soterus (angeblich im Amt 166–175), auf den – so die Sage – die Erfindung des kirchlich gesegneten Instituts der Ehe zurückgeht (war vorher eine rein weltliche Angelegenheit), bestimmte er doch angeblich, dass Ehen ohne kirchlichen Segen ungültig seien.
Ansatzweise historisch zuverlässige Nachrichten, wenn auch noch im sehr überschaubaren, teilweise nachträglichen Erfindungen geschuldeten Bereich, gibt es dann um die Wende zum dritten Jahrhundert:
»Heiliger« Viktor I.
(Bischof von Rom 189–199(?))
Unter »Viktor« soll es zu ersten direkten Verbindungen der als Untergrundreligion entstandenen Katholischen Kirche und dem regierenden Herrscherhaus unter Kaiser Commodus (161–192, Kaiser 180–192, Sohn von Marc Aurel) gekommen sein. Bindeglied war in diesem Fall eine angeblich christliche Prostituierte namens Marcia. Aufgewachsen in einem vom Eunuchen Hyacinthus geleiteten Mädchenheim für Nachwuchs-Huren, wurde sie im Alter von 14 Jahren als Sexsklavin dem Kaiserneffen Marcus Claudius Ummidius Quadratus zugeführt. Dieser wurde allerdings wenig später als Mitglied einer Verschwörung der Kaiserschwester Lucilla gegen Commodus hingerichtet. Commodus übernahm Marcia mit der »Erbmasse« seines Neffen für die nächsten zehn Jahre in seinen eigenen Harem.
Marcia gehörte zum Bekanntenkreis des Papstes Viktor. Sie setzte sich angeblich wegen Sympathien für den christlichen Kult für die Freilassung zahlreicher Christen ein, die zur Sklavenarbeit in den Bergwerken Sardiniens verurteilt worden waren. Dazu spielte sie dem Kaiser wiederholt von Viktor zusammengestellte Listen verurteilter Christen zu, die angeblich ungerechtfertigt auf der Insel schufteten. Zu den Begnadigten gehörte auch der spätere Papst Calixt I. (s. u.). Marcia zählte angeblich zu den Drahtzieherinnen eines weiteren Anschlags auf Kaiser Commodus, dem dieser zum Opfer fiel. Er wurde von einem anderen Geliebten Marcias, dem Gladiator Narcissus, im Bad erwürgt. Marcia hatte den nackten Kaiser zuvor offenbar mit erotischen Handreichungen abgelenkt und durch die Gabe von Narkosegiften betäubt.
Allerdings konnte sie sich ihrer Machtstellung am Hof seines Nachfolgers nicht lange erfreuen, da sie wenig später selbst als angebliche Verschwörerin im Alter von 25 Jahren hingerichtet wurde.32
Calixt I.
(um 160–222, Bischof von Rom 217–222(?))
Als verurteilter Finanzbetrüger zählte er zu den Bergwerkssklaven auf Sardinien, die im Zuge der von der Prostituierten Marcia eingefädelten Begnadigungen in den 180er Jahren freigelassen wurden. Geprägt ist seine angebliche Amtszeit durch den von ihm verkündeten, mutmaßlichen »Generalablass«, den Erlass der Sündenstrafen durch tätige Reue. In den Genuss dieses »Schulderlasses« kamen bei ihm auch Mörder, die ihre Tat bereuten, Ehebrecher und sonstige Sexualsünder, was ungemein zu seiner Beliebtheit beitrug. Bis zu diesem Zeitpunkt waren solche »Todsünden« auf Erden nicht mehr gut zu machen gewesen. Gleichzeitig sorgte dieses laxe Amtsverständnis dafür, dass es zu einer puristischen Gegenbewegung unter dem Heiligen Hippolytos kam. Dieser ebenfalls aus dem Nahen Osten stammende Vertreter der reinen Lehre wirkte ab 192 Presbyter in Rom, und ab 217 als erster Gegenbischof zu dem laxen Calixt. Hippolytos sprach sich gegen den Erlass der Strafen für Todsünden aus. Außerdem beschuldigte er Calixt, verschiedentlich Gelder der Kirche unterschlagen und zu seinem eigenen Vergnügen missbraucht zu haben.
Der Vielschreiber Hippolyt, von dem unter anderem eine »Apostolische Überlieferung« (Traditio Apostolica) stammt, eine erste »Kirchenordnung«, welche das erste bekannte Hochgebet enthält (Ebenso nahm er auch den Kelch und sprach: Dies ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Wenn ihr dies tut, tut ihr es zu meinem Gedächtnis, etc.), ist er vor allem für seine Sammlung bekannter häretischer Bestrebungen bekannt, die Refutatio omnium haeresium oder Philosophumena. Darin schildert er auch berühmte Zaubertricks einschlägig bekannter Häretiker. Bedeutsam ist seine Beschreibung der gesamten ihm bekannten antiken griechischen Philosophie bis hin zu indischen Brahmanen und keltischen Druiden.
Der damalige Kaiser Varius Avitus Bassianus, nach der von ihm propagierten Gottheit Elagabal genannt, stammte von seinen Eltern her aus Syrien. Schon sein Urgroßvater war im heutigen Homs in Syrien (damals Emesa) Priester des Gottes Elagabal gewesen. Nach der Ermordung Caracallas wurde Varius samt seiner Familie nach Homs verbannt. Dort übernahm er mit 13 Jahren das seiner Familie erblich zustehende Amt des Elagabal-Priesters. Ein Jahr später wurde er mit 14 Jahren in Rom zum Kaiser gekürt. Inwieweit er tatsächlich selbstbestimmt die Macht ausübte, ist ungewiss, zog im Hintergrund doch seine einflussreiche Großmutter Julia Maesa die Fäden. Diese hatte in ihrer Jugend in die kaiserliche Familie Roms eingeheiratet. Traditionell werden die Entscheidungen, die Varius traf, allerdings meist nur ihm selbst zugeschrieben. So etwa im folgenden Fall, als Varius bestimmte, dass nun auch in Rom der Elagabal (Gott Berg, abgeleitet von einem bienenstockförmigen schwarzen Kultstein, möglicherweise einem Meteoriten, der kultisch verehrt wurde, und den Varius aus Homs nach Rom mitgebracht hatte) verehrt werden solle, und zwar nicht nur als eine, sondern als die oberste, sogar dem bisherigen Staatsgott Jupiter übergeordnete Macht.
Zum ekstatischen Kult des Elagabals gehörte der Genuss von Rauschmitteln wie Alkohol und der laszive Tanz spärlich bekleideter Priesterinnen. Dazu spielte ohrenbetäubende Musik von Zimbeln und Trommeln. Das Blut der Tieropfer wurde mit Wein vermischt und getrunken. Dabei sollen auch regelmäßig Menschenopfer dargebracht worden, möglicherweise sogar Kinderopfer. Varius hatte zu diesem Zweck einen riesigen Tempel auf dem Palatin errichten lassen, wo die tägliche Gottesdienst-Ekstase stattfand. Doch damit war es Varius angeblich nicht genug. Dem konservativen antiken Historiker Cassius Dio zufolge, der ihn nachträglich zu verdammen suchte, zog Varius als Frau verkleidet durch die Bordelle Roms und bot sich dort wahllos Freiern an, schlief er mit unzähligen Frauen, um weibliche Sexualtechniken zu lernen, ließ er sich von seinem Lieblingssklaven Hierokles schlagen und vergewaltigen. Als Ursache für diese spezielle Form des Cäsarenwahns machten schon die antiken Historiker seine orientalische Herkunft dingfest, die auch seine Vorliebe für Schauspieler, Wagenlenker und Komödianten erkläre. So habe der Kaiser bei einem Gelage tonnenweise Rosenblüten von der Decke regnen lassen, so viele, dass einige seiner Gäste daran erstickten.
Anterus (Bischof von Rom 235/236)
Erst mit Nr. 19 haben wir den ersten historisch einigermaßen gesicherten römischen Bischof vor uns. Die Christen in Rom erlebten in dieser Ägide eine eher ruhige Zeit, waren sie doch als noch zahlenmäßig kleine Sekte nicht im Fokus des römischen Machtapparates, der ohnehin eher liberal eingestellt war, was die Praktizierung anderer Glaubensrichtung anging, und nur dann einschritt, wenn die geforderten, obligatorischen Opfer für die Staatsgötter verweigert wurden (was dann Sanktionen gegen ausschließliche, monotheistische Kulte wie das Christentum nach sich zog, was aber immer regional und zeitlich beschränkt blieb). Eine letzte Welle der Christenverfolgung spielte sich gegen Ende des dritten Jahrhunderts und zu Beginn des vierten Jahrhunderts ab, kurz vor dem endgültigen Durchbruch des Christentums zur Staatsreligion im römischen Reich.
Cornelius (Bischof von Rom 251–253)
Wie schon bei Viktor, so rief auch die laxe Herrschaftspraxis von Cornelius direkt einen strenggläubigen Gegenbischof hervor, in diesem Fall einen Herrn namens Novatian (200–258). Zu den von ihm geäußerten Vorwürfen gegen Cornelius zählte jener, Cornelius habe sich das Bischofsamt durch Bestechung verschafft, noch zu den harmloseren. Seinen besonderen Zorn hatte Cornelius hervorgerufen, indem er gegen die bis dato gängige Praxis auch vom Glauben abgefallene Christen wieder in die Kirche aufnahm (was sich in der Folge als gängig durchsetzte, und zur Popularisierung des Kults beitrug). Zuvor zählte der Abfall vom Glauben zu den Todsünden, die auf Erden nicht zu tilgen sind, und die im Fegefeuer gebüßt werden müssen. Zwar gewann Novatian rasch Anhänger, aber Cornelius schaffte es, über sechzig italienische Bischöfe hinter sich zu bringen (möglicherweise wieder mithilfe von Bestechungsgeldern), und noch 251 einen Beschluss zur Exkommunikation Novatians herbeizuführen.
Das dritte Jahrhundert ist dann eine Zeit der Ruhe für die Christen, die sich speziell in Rom immer mehr den Herrscherhäusern annähern. Um den Beginn des vierten Jahrhunderts kommt es dann – nach mehreren Anschlägen auf den Kaiser – unter Diokletian zu erneuten, letzten Christenverfolgungen.
Sixtus II. (Bischof von Rom 257–258)
Zwischenzeitlich wird mit Sixtus II. (um 257) der erste römische Bischof in den kirchlichen Darstellungen erwähnt, der einen bislang schon von einem anderen Bischof geführten Namen übernimmt, und dessen Name daher mit der Ordnungszahl römisch zwei versehen wird.
Marcellinus (Bischof von Rom 304)
In seiner angeblichen Grabesinschrift wird dieser Bischof erstmals als Papst bezeichnet. Doch es dauert noch bis zur regelmäßigen Verwendung dieses Begriffs für den jeweiligen römischen Bischof, nämlich bis zur Wende zum siebten Jahrhundert.
Die Wende zum vierten Jahrhundert ist durch eine Kaiserpersönlichkeit geprägt, die nachhaltige Folgen für die Entwicklung der Katholischen Kirche haben sollte – Konstantin (270–337, Kaiser von 306–337, davon ab 324 als Alleinherrscher). Noch ist die Kirche keine Staatsreligion. Doch unter
Miltiades (Bischof von Rom 310–314)
erhält die Kirche bereits bedeutende Schenkungen materieller Art vom regierenden Herrscherhaus, beispielsweise auch den seither als Amtssitz genutzten Palast der Laterani (Lateranspalast), einen riesigen antiken Stadtpalast, der in seiner damaligen Form von Marc Aurel über älteren Ruinen erbaut worden war. Dort fanden im 12. Jahrhundert die bedeutenden Lateranischen Konzile statt. Der Palast gehört bis heute zu den exterritorialen Besitzungen des Vatikans, obwohl er auf italienischem Staatsgebiet liegt. Die zugehörige, auf Befehl Konstantins errichtete Kirche San Giovanni in Laterano (im 17. Jahrhundert barockisierend umgebaut) ist seit konstantinischen Zeiten ranghöchste Patriarchalbasilika (päpstliche Kirche) Roms, und steht im Rang offiziell noch über dem Petersdom. Zu ihr geh...
Table of contents
- Cover
- Titel
- Impressum
- Widmung
- Inhalt
- Einleitung
- Der Beginn
- Zölibat
- Nachwort
- Danksagung
- Endnoten