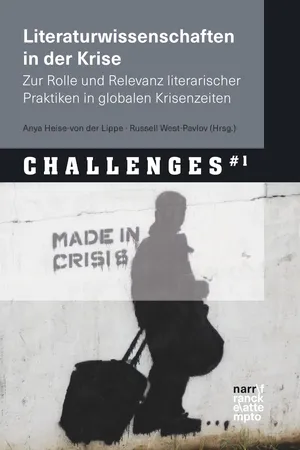Im Anfang war die Krise
Die erste literaturwissenschaftliche Fachpublikation, die ich 1992, im Jahr meines Studienbeginns, erwarb, war der im selben Jahr erschienene Band Literaturwissenschaft – Ein Grundkurs. Darin erörtern die Herausgeber die »Legitimationskrise der Literaturwissenschaft« und konstatieren ein »tiefgreifende[s] Krisenbewußtsein« unter Literaturwissenschaftler*innen (Brackert und Stückrath 1992: 690). Und 2017, ein Vierteljahrhundert später, zeigt ein Spiegel-Artikel (vgl. Doerry 2017) und die dadurch ausgelöste Debatte in den deutschsprachigen Feuilletons (vgl. Kastberger 2017; Drügh et al. 2017; Martus 2017; Börnchen 2017), dass dieses ›Krisenbewusstsein‹ weiter anhält. Die Krise wird dabei in erster Linie darin gesehen, dass der Wert und die gesellschaftliche Relevanz des literaturwissenschaftlichen Tuns angezweifelt wird; und Erklärungsversuche zielen grosso modo immer in die folgenden Richtungen: »Schuld ist entweder die vermittlungsunfähige Literaturwissenschaft oder der Ökonomismus und die Zweckrationalität der modernen Industriegesellschaft, welche die Literatur und die Literaturwissenschaft zunehmend marginalisieren.« (Brackert und Stückrath 1992: 695) Anders gesagt: Die Literaturwissenschaft verpasst es einerseits, ihre Erkenntnisse didaktisch sinnvoll aufzubereiten und auf diese Weise gesellschaftlich verfügbar zu machen; und andererseits werden diese Erkenntnisse in der Gesellschaft auch gar nicht nachgefragt. Derart entsteht das desolate Bild eines Fachbereichs, der emsig an Dingen herumwerkelt, sich dabei aber im gesellschaftlichen Abseits befindet und derart überhaupt nicht wahrgenommen wird.
Ich möchte mich im vorliegendem Beitrag in einem ersten Schritt vertieft auf dieses ›Krisenbewusstsein‹ einlassen und aufzeigen, dass es tatsächlich genuin und systembedingt zur Literatur und zum professionellen Umgang mit ihr gehört. Vor diesem Hintergrund werde ich darauf darlegen, wie Literaturwissenschaft und Literaturdidaktik aussehen können, wenn sie diese Krise selbstbewusst zum Ausgangs- und Fluchtpunkt des eigenen Tuns machen und entsprechend ›krisenbewusst‹ agieren. Hierzu sollen Schlaglichter auf zwei Szenarien geworfen werden: Einerseits auf eine spezifische literaturwissenschaftliche Forschungsrichtung, die sich als wertvoller Beitrag an die Klimawandelforschung versteht; und andererseits – etwas ausführlicher – auf einen konkreten Vermittlungsprozess im gymnasialen Literaturunterricht, der einen Kafka-Text mit der gegenwärtigen Flüchtlingskrise in Bezug zu setzen versucht. Die Zusammenstellung der beiden Szenarien mag dabei zufällig anmuten, ist aber immerhin erfahrungsgesättigt, ergibt sie sich doch aus meinen eigenen Tätigkeitsbereichen.
Die Krise als konstitutives Merkmal der Literatur(-wissenschaft)
Der Begriff der ›Literatur‹ ist voraussetzungsreich und daher nicht einfach zu bestimmen. Ich möchte Literatur mit Luhmann im Sinne eines Teilsystems der Gesellschaft verstehen, das sich im Zuge der funktionalen Differenzierung dieser Gesellschaft herausgebildet hat, ihr gegenüber spezifische Leistungen erbringt und dabei auf das Beobachten von Beobachtungen abstellt (vgl. Luhmann 1996). Oder in eigenen Worten (vgl. für das Folgende Hofer 2007: 178–221): Mit Literatur sind in diesem Beitrag Texte gemeint, die ästhetisch gestaltet sind und über die reine Informationsvermittlung hinaus auch auf diese Gestaltung und die darin gründende Eigengesetzlichkeit aufmerksam machen wollen. Literatur ist demnach als Zusammenspiel sprachlicher Formen anzusehen, die sich wechselseitig kommentieren und ein Ganzes ergeben; dabei kann man als Beobachter*in erkennen, dass etwas künstlich hergestellt und mit Mitteilungscharakter versehen wurde, also als kommunikatives Angebot zu sehen ist. Aber man erkennt auch, wenn man sich wirklich auf die literaturspezifische Kommunikation einlässt, dass die Botschaft generell mehrdeutig und mehrdimensional ist: Die Reduktion auf nur eine Deutung würde dem literarischen Text nicht gerecht. Literatur bietet damit keine einfache Information über die ›Welt‹, stellt eine ›Welt‹ vielmehr erst eigentlich her. Und sie sagt damit nicht: So ist es, sondern: So könnte es sein – und es wäre auch ganz anders möglich, womit das (potentielle) ›Nichtwissen‹ als Horizont immer präsent bleibt. Sie kümmert sich derart um die Herstellung von Weltkontingenz, trainiert die Leser*innen darin, mit Vorläufigkeiten und ungesichertem Wissen umzugehen. Und sie fordert einen geradezu auf, in kreativer Weise Deutungshypothesen auszuprobieren, zu verwerfen und neu zu bilden.
Doch die Literatur leistet noch mehr. Denn das Lesen von Literatur erfordert, indem es zur Verlangsamung und Intensivierung des Beobachtens anhält, das Aktualisieren und Vergleichen verschiedener Sichtweisen und damit das Denken in Alternativen. Und dieses Denken führt auf die Denkenden selbst zurück, die die Alternativen setzen und gegeneinander abwägen. Daraus folgt dann: Genau so, wie ich die Literatur beobachte, beobachte ich im Prinzip auch die Welt: Auch hier setze ich Deutungshypothesen, und auch hier muss ich diese immer mal wieder verwerfen. Nur merke ich dies in der Auseinandersetzung mit der Welt – im Gegensatz zur Literatur – kaum, denn diese ist eben nicht ›zwecklos‹ wie die Kunst, bindet meine Wahrnehmung dementsprechend weniger. Ich beobachte mit anderen Worten viel flüchtiger und gleichzeitig gezielter im Hinblick auf eine spezifische Information, die ich für die Bewältigung des Alltages brauche. Und ich bin also kaum zwingend dazu aufgefordert, meine eigenen Beobachtungen zu hinterfragen und Rückschlüsse zu ziehen; darauf, dass die Welt an sich unbeobachtbar ist und dass ich stattdessen nur Formen beobachte – meine eigenen Unterscheidungen –, die ich grundsätzlich selbst in diese Welt einbringe. Das ›literarische Beobachten‹ eröffnet also im Sinne einer ›epistemologischen Irritation‹ die Erkenntnis, dass ein ›unverstellter‹ und objektiver Blick auf die Welt nicht möglich, dieser vielmehr immer durch die eigene Beobachtungsleistung ›kontaminiert‹ oder – positiv gesprochen – mitgestaltet ist. Dies wird in der Auseinandersetzung mit Literatur erfahrbar. Und die Literaturwissenschaft – verstanden als »Reflexionswissenschaft der Literatur« (Berendes 2005: 69) – kann diese spezifische Leistung der Literatur herausarbeiten und begrifflich fassbar machen.
Aus dieser genuinen Leistung der Literatur bzw. der Literaturwissenschaft ergibt sich nun das oben konstatierte ›Krisenbewusstsein‹, das zwei eng miteinander verbundene Konsequenzen hat. Erstens muss die Literaturwissenschaft das ›Nichtwissen als Ausgangspunkt und Horizont‹ und also die Kontingenz und Vorläufigkeit des Verstehensprozesses und damit des eigenen Tuns im Forschungsprozess implementieren und ganz auf das immer wieder neue Ausprobieren von Deutungshypothesen abstellen, wenn sie ihrem Gegenstand gerecht werden will. Sie kämpft also gewissermaßen damit, dass ihr Gegenstand prinzipiell nie ausbeobachtet ist und jede Erkenntnis immer das Sigel der Vorläufigkeit trägt. Und daraus folgt, dass die Literaturwissenschaft keine gesellschaftlichen Probleme lösen kann, auch nicht momenthaft; ihre Erkenntnisse sind entsprechend schwieriger gesellschaftlich zu vermitteln als solche aus stärker solutionistisch orientierten Wissenschaften. Und zweitens dürfte sich die Gesellschaft im Prinzip durch die genannte epistemologische Irritation dazu veranlasst sehen, ihr Beobachten laufend zu reflektieren, zu revidieren und damit im Sinne von Kontingenz offen zu halten. Doch offenbar kann die Gesellschaft nicht allzu viel anfangen mit diesem Angebot, das sich aus der spezifischen Beschaffenheit der Literatur ergibt, und bekundet wenig Interesse an dieser Erkenntnis, die die Literaturwissenschaft herausarbeitet. Denn im täglichen Umgang mit der Welt sind wir gewohnt, einen direkten Zugang zu ihr zu pflegen, schnell Entscheidungen zu fällen und derart Situationen zu meistern und Probleme zu lösen. Und diesen Zugang zur Welt suchen wir daher beizubehalten – auch dann, wenn wir mit komplexen gesellschaftlichen Problemen konfrontiert sind, die sich einer ›einfachen Lösung‹ entziehen. Entsprechend haben Literaturwissenschaftler*innen »große Schwierigkeiten, im Wettbewerb mit den naturwissenschaftlich-technischen Disziplinen und ›harten‹ Humanwissenschaften ihre Existenznotwendigkeit öffentlich zu legitimieren« (Brackert und Stückrath 1992: 690). Doch dem müsste nicht so sein, wie gleich aufgezeigt werden soll.
Der Beitrag der Literaturwissenschaft an die Klimawandelforschung
Als eine der größten Herausforderungen im Zeitalter des Anthropozän (vgl. Crutzen und Stoermer 2000) gilt die menschengemachte globale Klimaerwärmung. Diese bedroht die Zukunft der Menschheit auf der Erde; dementsprechend unternimmt der Mensch große Anstrengungen, um die Klimaerwärmung und ihre katastrophalen Folgen einzudämmen. Prinzipiell sind alle Wissenschaftsbereiche bei der »Transformation zur klimaverträglichen Gesellschaft« (WBGU 2011: 341) gefordert. Diese transformative Forschung wird zwar im Grunde interdisziplinär verstanden; de facto ist sie jedoch gegenwärtig klar von den positivistischen Disziplinen der Natur- und Technikwissenschaften geprägt, so dass die Herausforderungen des anthropogenen Klimawandels vorwiegend als Fragen technischer Innovation und politisch-ökonomischer Steuerung behandelt werden. Und wenn Angebote zur Zusammenarbeit erfolgen, dann wird statt wechselseitigem interdisziplinären Austausch eher eine Integration angestrebt; den Geistes- und Kulturwissenschaften kommt darin lediglich die Aufgabe zu, Akzeptanz und Verständnis für das in den Natur- und Technikwissenschaften generierte Wissen zu fördern und damit Vermittlungsarbeit zu leisten (vgl. Hulme 2011; Lövbrand et al. 2015). Diese einseitige Engführung von Wissenschaft auf das Lösen gesellschaftlicher Probleme und das ›Bearbeiten von Welt‹ sollte kritisch betrachtet werden, weil derart die andere Seite von Wissenschaft, das ›Verstehen von Welt‹, ausgegrenzt wird. Zudem bleibt in...