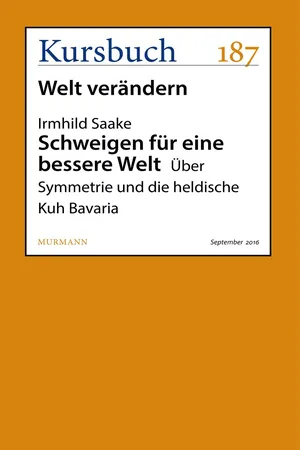![]()
Irmhild Saake
Schweigen für eine bessere Welt
Über Symmetrie und die heldische Kuh Bavaria
Auf einer theologischen Tagung konnte ich einmal zuhören, wie die Redner diskutiert haben, ob es bis zum Ende der Tage noch Hilfebedürftigkeit und Armut geben werde oder ob solche Probleme schon vorher gelöst sein würden. Eschatologie nennt sich die Lehre von den letzten Dingen, die Lehre vom Anbruch der Gottesherrschaft. Die Frage ist gut. Wie stellen wir uns eigentlich das Ergebnis unserer Bemühungen, hier auf Erden die Welt zu verbessern, vor? Kann man sich das überhaupt vorstellen? Werden einmal alle Menschen als freie und gleiche ein zufriedenes Leben führen? In Einklang mit der Natur? Ohne Krieg und Not? Eher plausibel erscheint vermutlich vielen, dass wir von einer übermächtigen Natur, die uns den Klimawandel übel nimmt, überwältigt werden. Gibt es zwischen Erlösung und Apokalypse noch etwas? Aber ja: Es gibt die sachliche Auseinandersetzung mit den Problemen der Gesellschaft. Dabei werden Problembeschreibungen angefertigt, Expertengruppen zusammengestellt, Projekte gefördert und evaluiert, um herauszufinden, was besser und was schlechter funktioniert.
Jetzt müssen vermutlich alle lachen, weil jeder zu wissen glaubt, dass das nichts bringt. Wir haben ein viel besseres Mittel entdeckt, um die Welt zu verändern: die Praxis der Symmetrisierung. Wir machen uns mit den Hilfebedürftigen der Welt, mit den Unterdrückten und Schlechtergestellten, mit allen, deren Leben anders als unseres verläuft, zu Gleichen. Dieser neue Aktivismus des Veränderns, des Mitmachens, des Sich-Engagierens in Bezug auf Arbeitsplätze irgendwo in der Welt, den Klimawandel, die Anerkennung von Diversität, die Hilfe für Flüchtlinge und den Einsatz für Tierrechte macht Schluss mit der gelehrten Eschatologie. Die alten Debatten sind beendet, den Argumenten trauen wir nicht mehr. Die Ungleichheit zwischen Männern und Frauen existiert immer noch, die Akkumulation von Geld in den Händen weniger Menschen nimmt zu, der Verbrauch unserer natürlichen Umwelt wird mit technologischen Mitteln gesteigert und all das fühlt sich falsch an.
Was machen wir eigentlich, wenn wir der Welt so die Temperatur messen? Wir tun etwas, wir fühlen, aber wir interessieren uns nicht mehr für Begründungen. Wir wollen die Welt verändern und wollen sehen, dass sich etwas tut. Die sachlichen Argumente scheinen uns viel zu umständlich zu sein. Wer wirklich die Welt verändern will, der muss etwas tun. Es fühlt sich gut an, etwas zu unterstützen, zu teilen, zu liken und überhaupt: selber zu machen. Wie radikal anders diese neue Welt des Fühlens ist, lässt sich am besten verstehen, wenn man sie als eine besondere Form des Redens ernst nimmt. In all den gegenwärtigen Debatten darüber, dass wir jetzt sofort etwas ändern müssen, gibt es eine Gemeinsamkeit: die Betonung der Anerkennung des anderen, der Wunsch nach Gleichheit. Von der Sachebene sind wir unbemerkt auf die Sozialebene gewechselt und interessieren uns vor allem dafür, wie wir mit der Ungleichheit des anderen umgehen können. Um es noch einmal deutlicher zu sagen: In unseren aktuellen Debatten geht es nicht um entweder Gleichheit oder Ungleichheit, sondern um unsere Fixierung auf Gleichheit und Ungleichheit im Unterschied zu sachlichen Debatten darüber, wie Ungleichheit entsteht. Ganz zwanglos entsteht eine solche Art des Denkens, wenn man mit ethischen Fragestellungen beginnt. Das ethische Reden ist die Reflexion darüber, ob unser Handeln gut ist und ob das auch in den Augen anderer der Fall ist. Ethik ist eine ständige Einübung in die Relativierung von Aussagen. Alles kann aus der Perspektive des anderen anders aussehen, aber nicht nur, weil der andere anders ist, sondern auch, weil schon wieder Zeit vergangen ist und weil der andere tatsächlich andere Probleme lösen muss als man selbst. Aus einer Perspektive der Ethik werden diese Unterschiede zu Generatoren von Ungleichheiten.
Die Möglichkeiten des ethischen Redens sind unbegrenzt steigerbar. Jede universitäre Disziplin kann ihr eigenes Fach noch einmal neu aus ethischer Perspektive reflektieren, jede Fakultät braucht eine eigene Ethikkommission, und wer sich gedacht hatte, dass schon Feminismus allein bedeutet, die Berücksichtigung des anderen einzufordern, der muss sich verwundert belehren lassen, dass es auch noch eine feministische Ethik gibt. Aber es sind nicht nur die Universitäten, die sich ethisch neu aufstellen, sondern auch die Wirtschaftsorganisationen, die Krankenhäuser, die Politik, unser Alltag. Mehr Ethik scheint die Welt automatisch besser zu machen. Ethik als besondere Form des Redens geht gerne aus sic...