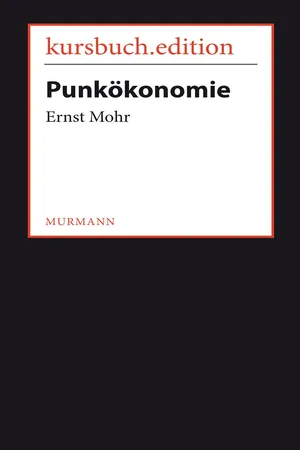![]()
Teil I
STILISTISCHE INNOVATION
![]()
1. Der produktive Rand der offenen Gesellschaft
»It’s terrible to say, very often the most exciting outfits are from the poorest people.«
Christian Lacroix
»In mancher armen Hütte wohnt der Geschmack angenehmer als im überladnen Palast; in einer anständigen Kleidung kann er sich edler zeigen als im buntesten Flitterstaat; an einer einfachen Tafel reizender als beim Krönungsfest des römischen Kaisers.«
Johann Gottfried Herder
»Nicht vom Zentrum aus geschieht die Entwicklung, die Ränder brechen herein.«
Ludwig Hohl
Stil und Postmoderne
Was einem Modeschöpfer unserer Tage, Christian Lacroix, wert ist, festgehalten zu werden – dass innovativer Stil besonders am sozialen Rand einer Gesellschaft gedeiht –, war bereits dem Philosophen Johann Gottfried Herder vertraut: Stilistische Qualität findet weniger im wirtschaftlichen Zentrum der Gesellschaft statt – ob nun mit dem Adel aus Herders Zeit oder dem heutigen Mainstream besetzt – als außerhalb davon. Der Philosoph Ludwig Hohl gibt Herders und Lacroix’ Feststellung eine verallgemeinernde Wendung: Sie gilt nicht nur für Reich und Arm, sondern ganz allgemein für Mainstream und Rand der Gesellschaft. Nicht der Mainstream, sondern der Rand ist die Quelle von Veränderung, die aus ihm heraus in den Mainstream hineinfließt.
Dabei bricht der Rand – entgegen Hohls Aussage – weniger in den Mainstream herein, sondern wird als Inspirationsquelle vom Mainstream systematisch genutzt. Anstatt selbst Neues zu schaffen, begibt sich eben zum Beispiel der Modeschöpfer aktiv auf die Suche nach stilistischen Anregungen, um sie dem Mainstream später anzudienen. Dieser Prozess, das Hereinholen der am Rand der Gesellschaft aufkommenden stilistischen Innovation in den Mainstream, ist der Gegenstand der Stilökonomik und das Charakteristische der Punkökonomie. In ihr wird er konkret mit der Hypothese untersucht, dass soziale Normen, Konventionen und Tabus das menschliche Verhalten ebenso beeinflussen wie staatliche Ge- und Verbote oder Steuern und finanzielle Anreize. Die Stilökonomik erweist sich so als Teilgebiet der Institutionenökonomik an den Schnittstellen zur Soziologie und Konsumanthropologie. Sie versucht den Prozess der stilistischen Innovation zu verstehen, indem sie dem Sinn nachgeht, den Menschen am Rand der Gesellschaft ihrem stilistischen Handeln geben. Die Stilökonomik sucht mithin wie die ökonomische Neoklassik nach dem rationalen Kern menschlichen Verhaltens – aber nicht im Sinne eines theoretischen Konstrukts, sondern in dem von den Menschen ihrem Handeln gegebenen Sinn. Die Modelladäquanz der ökonomischen Neoklassik wird in der Stilökonomik also ersetzt durch Sinnadäquanz.
Der Rand der Gesellschaft besteht aus Subkulturen, die sich durch eine quasi natürliche Zugehörigkeit beispielsweise zu einer ethnischen oder religiösen Gruppe auszeichnen, Neostämmen, die für eine Art freiwilliger Wahlverwandtschaft wie zum Beispiel beim Hipster stehen, und aus Jugendkulturen, die durch eine natürliche Temporalität der Zugehörigkeit charakterisiert sind. Wichtig daran ist der Umstand, dass sie alle in einer mehr oder weniger starken Opposition zum gesellschaftlichen Mainstream stehen. Es wird sich in den nachfolgenden Überlegungen zeigen, dass gerade diese Opposition eine katalytische Wirkung auf die stilistische Innovation hat. Denn in dem Moment, in dem ein Stil vom gesellschaftlichen Rand in den Mainstream »hereinbricht«, verliert er am Rand als Mittel zur Abgrenzung an Bedeutung. Und je mehr die Geschmacksindustrie den Rand als Quelle stilistischer Innovation nutzt, umso mehr muss diese sprudeln, um immer neue Mittel zur Differenzierung vom Mainstream zu erschaffen. Stile kommen und gehen und mit ihnen die Gruppen, die sich an ihrem Stil erkennen lassen. Was bleibt, ist die Opposition gegenüber dem Mainstream, die sich in immer neuen Formationen zeigt.
Stile, wie sie zum Beispiel aus dem Hipstertum, dem Punk, Beat, Rock, den Teddy Boys, Mods, Skinheads und aus den Boarder-Kulturen herausgewachsen sind, wurden alle von Unternehmen der Geschmacksindustrie als Quellen für neue stilistische Angebote an den Mainstream entdeckt. Das Trendscouting der Geschmacksindustrie sucht gezielt nach ihnen, und Funde werden planvoll domestiziert, um sie in goutierbarer Form dem Mainstream anzudienen. Da Stilökonomik auch die Ökonomik der offenen, postmodernen Gesellschaft ist, in der die gesellschaftliche Position des Einzelnen weniger vorgespurt als frei gesucht und gefunden ist, stehen mehr oder weniger ausgeprägte Wahlverwandtschaften außerhalb des Mainstreams – Neostämme und Jungendkulturen – im Fokus der Stilökonomik und finden geschlossene (wie zum Beispiel religiöse) Subkulturen weniger Berücksichtigung.
Wo die Wahl die Verwandtschaft macht, ist das Kommen und Gehen nicht deren Substanz. Eine Wahlverwandtschaft braucht etwas, was sie – für die Zeit ihrer (vielleicht flüchtigen) Existenz – als Gemeinsames nach außen anzeigt, was aber zugleich auch als Zeichen der Zusammengehörigkeit wirkt. Dieses Etwas muss nach innen als Kitt genauso wirken wie nach außen als Trennmittel.
»Das Spezifische eines postmodernen Stamms ist ganz klar seine Ästhetik«, stellt der französische Neostammexperte Michel Maffesoli fest. Viel mehr als ihre Ästhetik steht einer solchen Wahlverwandtschaft in einer im Fluss befindlichen Gesellschaft auch nicht zur Verfügung. Mit Blick auf den identitätsspezifischen, der Ästhetik vorangehenden Geschmack formuliert es der deutsche Soziologe Hans-Peter Müller so: »In dem Maße, in dem verbindliche religiöse und moralische Wertsysteme als Orientierungsinstanzen ausfallen, ist der Einzelne auf seinen Geschmack, dieses intuitive, spontane und ›quasi-instinktive‹, praktische Urteilsvermögen, verwiesen.« Das Wiederfinden ihres konstituierenden Stils im Mainstream zwingt die Mitglieder einer Wahlverwandtschaft also zu einer Reaktion, ohne die ihre Identität in Gefahr geriete.
Eine sinnadäquate stilistische Theorie braucht keine ausgefeilte ästhetische Theorie als Grundlage, denn die Mitglieder von Wahlverwandtschaften haben und brauchen auch keine. Ihnen geht es lediglich ums selektive Dazugehören und darum, es lernend und praktizierend sich selbst und anderen zu demonstrieren. Die sinnadäquate Theorie muss demzufolge ebenfalls um Kernbegriffe wie Ein- und Abgrenzung, Lernen und Praktizieren kreisen. Die ökonomischen Grundkonzepte für Produkteigenschaften – die Komplementarität und die Substitution – sowie die Grundidee der Konvention als handlungsleitende Restriktion reichen dafür aus.
Stiltechnisch gehört zu einem Stil die Gesamtheit aller Dinge, mit denen sich eine Wahlverwandtschaft umgibt, und aller Verhaltensweisen, die er zeigt. Dabei kann eine solche Ansammlung von Dingen und Verhaltensweisen nur durch Wiederholung der Mitglieder zu einer Gesamtheit und als solche verstanden werden. Denn nur durch (auch von außen beobachtbare) Wiederholung ist es sowohl den Mitgliedern einer Wahlverwandtschaft wie auch Dritten möglich, den Dingen und den Verhaltensweisen als Ganzes einen Sinn zu geben. Sinn geben heißt konkret, die Elemente einer solchen Gesamtheit als Komplementaritäten zu verstehen, als etwas, was zusammengehört und ein Ganzes ergibt. Ein Stil ist somit eine einzelne Struktur von Komplementaritäten in der viel größeren Welt aller wiederholt gezeigten Dinge und Verhaltensweisen. Er baut auf ein durch Wiederholung entstandenes, eine spezifische Wahlverwandtschaft anzeigendes Wissen und zeigt alles, was eine Wahlverwandtschaft als solche erst erkennbar macht. Durch Wiederholung werden Hipster, Punker, Rocker und Skinheads an ihrem spezifischen Stil erkennbar.
Weil durch Wiederholung entstanden, ist ein Stil eine Konvention. Konventionen zeichnen sich dadurch aus, dass sie genauso gut anders lauten könnten. Es ist egal, was genau als Konvention wiederholt wird, solange es nur wiederholt wird und jeder, der dazugehört, sich daran hält. Am Ende kommt eine Struktur von Komplementaritäten heraus, die erkannt wird, allein weil sie oft genug wiederholt worden ist. So stand eine Zeit lang die Sicherheitsnadel im Ohr für den Punker, weil sie mit anderen, immer denselben Zeichen immer wieder zusammen gezeigt wurde.
Jeder Stil weist einen Grad an Beliebigkeit auf. Auch die Queen bliebe die Queen, zeigte sie nur hartnäckig genug ihre Sicherheitsnadel im Ohr. Auch der Punker bliebe der Punker, zeigte er sich hartnäckig genug immer mit pastellfarbenem Hut und Handschuhen. Queen und Punker dürfen nur nicht beide dasselbe zeigen, sie müssen sich an die jeweilige Konvention halten. »Daran halten« heißt, die Ordnung, wie sie die Konvention unmerklich zustande bringt, einzuhalten. Stil schafft Ordnung, so beliebig er auch ist.
Stil existiert also nicht absolut, sondern immer nur relativ zu mindestens einem anderen Stil. Hipster kann Hipster nur relativ zu Punk, Skinhead oder Mainstream sein. Sein Stil steht in einem Spannungsverhältnis zu einem anderen Stil: Während die Dinge und Verhaltensweisen eines Stils als Struktur von Komplementaritäten verstanden werden, stehen verschiedene Stile einander als Substitute gegenüber. Das »Das gehört auch dazu!« innerhalb eines Stils kontrastiert immer mit dem »Entweder-oder!« im Vergleich der Stile miteinander. Komplementarität innerhalb eines Stils und Substitution zwischen den Stilen fügen die Stile einer Gesellschaft zu einem ganzen Stilsystem zusammen. Punker, Hipster, Hip-Hopper, Nerds, Emos, Skinheads, Rastafaris, Surfer usw. bilden zusammen mit dem Mainstream dieses soziale System von Stilen, dessen Entstehung durch Wiederholung und Verankerung als Konventionen nur im sozialen Prozess möglich ist.
Die praktische Zweckmäßigkeit eines Stils liegt darin, dass er dem Einzelnen bei der Selbsterhöhungsarbeit helfen kann. Mit einem gemeinsamen Stil (auf Zeit) finden Menschen sich in Gruppen (auf Zeit) zusammen und konstruieren durch Wiederholung ihren Stil als Repräsentanz ihrer selbst. Sie selbst und die anderen Gruppen, von denen sie sich allein durch ihn unterscheiden, interpretieren ihn als eben diese Repräsentanz. Eine ästhetische Theorie braucht es in dieser stilistischen Praxis nicht. Das Streben nach Selbsterhöhung, die Bauernschläue, sich dabei von anderen helfen zu lassen, und das Mittel des wiederholten Zeigens immer derselben Dinge und Verhaltensweisen reichen vollkommen aus, um Stile in der Praxis entstehen zu lassen und sie als solche erkennbar zu machen. Die sinnadäquate Bedeutung von Stil ist demnach, das Mittel zur gruppenspezifischen Differenzierung von anderen Gruppen zu sein.
Ein Stil enthält erstens Bestandteile, die man, wie die Irokesenfrisur des Punkers, in keinem anderen Stil findet. Man findet zweitens aber auch immer Bestandteile, die ein Stil mit anderen Stilen teilt. So zeigte sich der Mod, der britische Büroarbeiter-Dandy der 1960er-Jahre, stets mit Schlips, genauso wie der Londoner Mainstream-Banker. Ein Stil kann deshalb in seinen Kern und seine Peripherie eingeteilt werden. In seiner Peripherie sind Komplemente, die zugleich Komplemente in anderen Stilen sind. Es gibt allein schon aus dem praktischen Grund der Differenzierungseffizienz keinen Stil ohne eine solche Peripherie. Seinen Kern jedoch bilden Komplemente, die sonst in keinem anderen Stil zu finden sind....