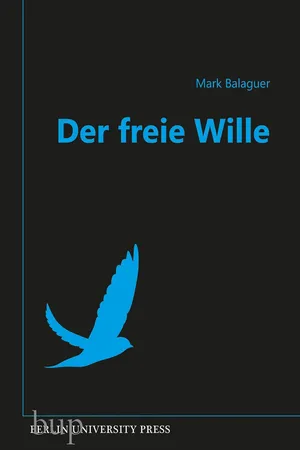![]()
1
EINLEITUNG
Die Wissenschaft hat bewiesen, so wurde in den letzten Jahren vielfach und auf unterschiedliche Weise behauptet, dass Menschen keinen freien Willen haben. Leute wie der Harvard-Psychologe Daniel Wegner und Sam Harris, ein Neurowissenschaftler und Autor verschiedener »populärphilosophischer« Bücher, erklären aufgrund gewisser wissenschaftlicher Befunde unsere Willensfreiheit zur Illusion.
Wenn das stimmen würde, wäre das alles andere als erfreulich. Es wäre außerdem überraschend, denn es scheint doch so, als ob wir über einen freien Willen verfügen. Anscheinend wird das, was wir von einem auf den anderen Moment tun, von bewussten Entscheidungen bestimmt, die wir frei treffen. Nehmen wir zum Beispiel an, ich liege auf dem Sofa, sehe fern und beschließe unverhofft, aufzustehen und einen Spaziergang zu machen. Anscheinend ist der Grund, warum ich aufgestanden bin, um spazieren zu gehen, dass ich eine bewusste Entscheidung getroffen habe, genau das zu tun. Ich hätte auch weiter fernsehen oder etwas ganz anderes tun können. Teufel, ich hätte mich grün anmalen und so tun können, als wäre ich der unglaubliche Hulk im Kampf auf Leben und Tod mit einer bösen Truppe litauischer Trapezkünstler. Aber das habe ich nicht; ich bin spazieren gegangen. Und als ich das getan habe, habe ich meinen freien Willen ausgeübt. Oder so jedenfalls kommt es uns vor. Doch wenn Leute wie Wegner und Harris recht haben, dann ist dieses Gefühl der Freiheit, das wir alle haben, eine Illusion. Ihrer Auffassung nach haben wir keinen echten freien Willen. Mit anderen Worten, wir haben keine echte Wahl bei dem, was wir tun; all unser Tun wird vielmehr von Antrieben verursacht, die völlig außerhalb unserer Kontrolle liegen. Und, sagen wieder dieselben Leute, dass wir keine Willensfreiheit haben, das ist sogar wissenschaftlich bewiesen.
Ich traue diesen Leuten nicht über den Weg. Es ist nicht so, dass ich der Wissenschaft nicht traue. Im Gegenteil, ich vertraue ihr unbedingt. Ich halte sie für den besten Weg, den wir haben, um Wissen über die Welt zu erlangen. Ich traue nur eben den Leuten nicht, besonders dann nicht, wenn sie mir weiszumachen versuchen, die Wissenschaft habe irgendeine verrückte Behauptung bewiesen. Verstehen Sie mich nicht falsch: Es bin mir durchaus bewusst, dass bereits viele zunächst irrwitzig erscheinende Behauptungen wissenschaftlich bewiesen worden sind. Aber auf jeden einzelnen Fall, wo die Wissenschaft zu Recht die Wahrheit eines verrückt klingenden Ergebnisses festgestellt hat, kommen tausend Fälle, bei denen fälschlicherweise behauptet wird, die Wissenschaft habe verrückt klingende Resultate bewiesen. Die Moral von der Geschichte ist also: Nur weil uns jemand mit einem Doktorgrad und einem Laborkittel erzählt, dass irgendeine hirnrissige Schlussfolgerung wissenschaftlich bewiesen sei, muss das noch lange nicht stimmen. Natürlich heißt das nicht, dass sie falsch sein muss. Ich sage nur, wir sollten die Behauptung erst einmal selbst überprüfen.
Ich stehe also der Idee, dass die Wissenschaft beweisen könnte, dass wir keinen freien Willen haben, völlig offen gegenüber. Schließlich handelt es sich bei unseren Entscheidungsabläufen um Hirnprozesse, insbesondere um neuronale Prozesse, und die fallen offenkundig in die Domäne wissenschaftlicher Forschung. Genau das ist es ja, was die Neurowissenschaft tut: Sie untersucht neuronale Prozesse. Es besteht also die reale Möglichkeit, dass Neurowissenschaftler entdecken könnten, dass wir keinen freien Willen besitzen. Ich bin mir nur nicht sicher, ob sie das auch tatsächlich geschafft haben. Daher will ich mir die Sache genauer anschauen, um zu sehen, ob sie recht haben.
Davon handelt dieses Buch. Ich werde darin die verschiedenen Argumente und wissenschaftlichen Experimente erörtern und bewerten, die als Beweise vorgebracht werden, dass Menschen keinen freien Willen besitzen. Am Ende des Buchs werden wir dann in der Lage sein, die Frage zu beantworten, ob die verschiedenen Argumente dafür etwas taugen; mit anderen Worten, wir werden beurteilen können, ob wir wirklich gute Gründe dafür haben, unseren Glauben an den freien Willen aufzugeben.
Bevor ich fortfahre, möchte ich ein Problem ansprechen, dass für unsere Diskussion relevant ist. Grob gesagt können wir zwei verschiedene Standpunkte über das Wesen des Menschen beziehen. Diese beiden Auffassungen lassen sich wie folgt zusammenfassen:
Die spirituelle, religiöse Auffassung des Menschen: Jede Person besitzt eine unsterbliche Seele oder einen immateriellen Geist, der sich vom physischen Körper unterscheidet und den Körper irgendwie »antreibt« oder »dem Körper sagt, was er tun soll«. Wenn man zum Beispiel durstig ist und sich bewusst entscheidet, in die Küche zu gehen und ein Glas Wasser zu trinken, dann ist es unsere Seele, die diese bewusste Entscheidung trifft und den Körper veranlasst, aufzustehen und sich in die Küche zu begeben.
Die materialistische, wissenschaftliche Sicht des Menschen: Am Menschen ist nicht mehr dran als sein physischer Körper, er besitzt jenseits seiner materiellen Leiblichkeit keine immaterielle Seele. Daher findet man alles, was einen Menschen zu dem macht, was sie oder er ist, im Gehirn. Ihre Überzeugungen und Wünsche, Hoffnungen und Ängste, Ihre Erinnerungen und Gefühle wie Liebe oder Hass: das alles hat, kodiert in neuronalen Pfaden, seinen Sitz in Ihrem Gehirn.
Es besteht also die reale Möglichkeit, dass Neurowissenschaftler entdecken könnten, dass wir keinen freien Willen besitzen. Ich bin mir nur nicht sicher, ob sie das auch tatsächlich geschafft haben.
Und wenn wir wissen wollen, warum wir aufgestanden und in die Küche gegangen sind, müssen wir nur in unser Hirn schauen. Man kann nirgendwo sonst nachsehen, weil wir keine immaterielle Seele besitzen. Ihr Durst war etwas Physisches, neuronal kodiert in Ihrem Gehirn. Ebenso war Ihre bewusste Entscheidung, aufzustehen und sich ein Glas Wasser zu holen, physisch – ein physikalisches, neuronales Ereignis, das sich in Ihrem Hirn ereignete. Und dieses neuronale Ereignis setzte Ihre Muskeln in Bewegung und so weiter und so fort.
Zwischen diesen beiden Anschauungen findet offensichtlich schon für sich genommen eine sehr hitzige und kontroverse Debatte statt, und ich werde hier nicht den Versuch unternehmen, sie beizulegen. Aber der Unterschied zwischen diesen beiden Auffassungen des Menschen ist aus einer Reihe von Gründen für unser Thema wichtig. Zunächst ist anzumerken, dass die wissenschaftlichen Feinde des freien Willens – Leute wie Wegner und Harris, die glauben, die Wissenschaft habe bewiesen, dass wir keine Willensfreiheit besitzen – im Allgemeinen eine materialistische, wissenschaftliche Sicht des Menschen vertreten.
Angesichts dessen könnten Gläubige denken: Ich glaube an Gott, und da ich überzeugt bin, eine immaterielle Seele zu besitzen, muss ich mir keine Sorgen über die Argumente machen, die diese Leute vorbringen. Ich muss keine Bange haben, dass ich keinen freien Willen besitze.
Aber dieser Schluss ist durchaus nicht offensichtlich. Es könnte sein, dass der Glaube an die Seele das Problem gar nicht löst. Mit anderen Worten, es könnte sein, dass selbst wenn man sich die spirituelle, religiöse Sicht zu eigen macht – selbst wenn man also glaubt, dass wir alle eine immaterielle Seele besitzen, die unseren Körper antreibt –, dieser Glaube nichts nützt, um sich aus den Argumenten gegen den freien Willen herauszuwinden. Diese Argumente könnten sich trotzdem als tragfähig erweisen. Wir werden darauf zurückkommen müssen.
Auf alle Fälle werde ich – unabhängig davon, ob sich die spirituelle, religiöse Sicht dazu benutzen lässt, die Argumente gegen den freien Willen auszuhebeln – viel mehr Zeit darauf verwenden, nach einer Erwiderung auf die Argumente gegen den freien Willen zu suchen, die alle benutzen können, ganz gleich, ob sie an eine immaterielle Seele glauben oder nicht. Dem Argument zuliebe will ich davon ausgehen, dass die materialistische, wissenschaftliche Sicht des Menschen zutreffend ist. Ich werde also der Frage nachgehen, ob wir ausgehend von der Annahme, dass Menschen keine immaterielle Seele besitzen, gute Argumente gegen die Feinde des freien Willens finden können. Wenn sich, das ist meine Idee, ein Weg für eine materialistische Antwort auf die Argumente gegen den freien Willen auftäte, dann sollten die Verfechter einer spirituellen, religiösen Sicht in der Lage sein, eine ähnliche Antwort zu geben. Mit dieser Vorgehensweise suchen wir also eine Erwiderung, die alle gleichermaßen nutzen können.
Doch im Geist der Freimütigkeit will ich, damit Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben, meine Karten auf den Tisch legen. Ich glaube nicht an Gott, und ich glaube nicht an eine immaterielle Seele. Ich bin kein wütend schnaubender Atheist mit Schaum vor dem Mund, aber ich glaube einfach nicht, dass es so etwas wie Gott oder eine immaterielle Seele gibt. Doch wird diese meine Auffassung in diesem Buch keine wirkliche Rolle spielen, denn ich werde hier, wie gesagt, nach einer Antwort auf die Argumente gegen den freien Willen suchen, die wir alle benutzen können, ja, mehr noch, ich werde die Frage stellen, ob wir den Argumenten gegen den freien Willen entgehen können, indem wir den Materialismus aufgeben und uns die Idee einer immateriellen Seele zu eigen machen.
Bevor wir zum Wesentlichen kommen, ist wohl eine Anmerkung über die Tatsache angebracht, dass uns der freie Wille so am Herzen liegt. Auf diese Frage gehen Autoren, die Bücher über das Thema schreiben, häufig ein und erklären uns, wie ungemein wichtig der freie Wille für Moral, Religion, Politik und unser Rechtssystem sei. Tatsächlich erzählt man uns, dass der freie Wille eine entscheidende Bedeutung für unser Selbstverständnis als Menschen habe.
Das mag ja alles stimmen, aber irgendwie riecht da etwas faul. Für mich klingen solche Erklärungen vorgeschoben, so als müsse man den Versuch rechtfertigen, über den freien Willen zu schreiben. Mehr noch, ich glaube, solchen hochgestochenen, hehren Räsonnements entgeht der Hauptgrund, warum uns die Frage nach dem freien Willen auf den Nägeln brennt. Der wichtigste Grund dafür ist nämlich, dass wir einen freien Willen wollen. Wir wollen ihn aus demselben Grund wie Eiskrem, Glück und Sex: weil er gut ist. Der freie Wille ist schlicht eine in sich gute Sache, die wir alle wollen. Wenn sich also herausstellen würde, dass wir ihn nicht haben und das Gefühl des freien Willens eine Illusion ist – nun, das wäre einfach schlecht.
Auch wenn der freie Wille schon für sich genommen zutiefst wünschenswert ist, mag es natürlich stimmen, dass er auch als Mittel zur Erlangung anderer Dinge bedeutsam ist. Man kann zum Beispiel der Auffassung sein, dass wir den freien Willen brauchen, um unseren Umgang mit Kriminellen zu rechtfertigen, denn wenn niemand Willensfreiheit besitzt, verdient vielleicht auch niemand Strafe. Nehmen wir zum Beispiel Bruno Hauptmann, der verurteilt wurde, das Baby von Charles Lindbergh entführt und ermordet zu haben. Die meisten Menschen würden sagen, dass es Hauptmann, falls er tatsächlich schuldig war, verdienen würde für sein Verbrechen bestraft zu werden. Doch wenn er keinerlei freien Willen hatte – wenn seine Handlungen von etwas verursacht wurden, das völlig außerhalb seiner Kontrolle lag, sodass er keine echte Wahl hatte –, dann ist schwer einzusehen, warum es fair sein sollte, ihm dafür die Schuld zu geben. Wir könnten trotzdem solche Kriminelle einsperren – zu unserem Schutz –, aber wenn sie keinen freien Willen haben, bleibt unklar, wieso sie ihre Behandlung »verdient« haben sollten.
Die moralische Überlegung hier mag richtig sein, aber es fällt mir schwer zu glauben, dass sie irgendeinen echten pragmatischen Nutzen hat. Selbst wenn wir felsenfest überzeugt wären, dass Menschen keinen freien Willen haben, würde das nicht viel ändern. Ein paar Tage lang käme es groß in den Schlagzeilen, doch bald schon würden wir uns mit dem Thema langweilen und uns der nächsten Sensation zuwenden – dass die Schauspielerin Lindsay Lohan mit Alkohol am Steuer erwischt wurde oder etwas in der Art. Und wenn ein Entführer nach der Entdeckung, dass Menschen keinen freien Willen besitzen, Ihr Baby raubt und ermordet, wette ich mein letztes Hemd darauf, dass Sie in Ihrer Wut und Empörung von ganzem Herzen fühlen werden, dass der Mörder seine Strafe verdient – freier Wille hin oder her.
Die Menschen sind, wie sie sind, und wenn wir entdecken würden, dass wir keinen freien Willen besitzen, glaube ich nicht, dass sich dadurch viel ändern würde. Das heißt nicht, dass es keine große Meldung wäre. Die Nachricht würde zweifellos groß herauskommen. Allerdings wäre es eine schlechte Nachricht. Es wäre so, wie zu erfahren, dass es keine Schokolade mehr gibt. Sicher wäre es nicht das Ende der Welt, wenn uns klar werden würde, dass wir von nun an ohne Schokolade auskommen müssen, und binnen weniger Tage würden wir uns anderen Leckereien zuwenden, würden stattdessen mehr Vanille und Karamell essen, und damit hätte es sein Bewenden. Nur ändert das nichts an der Tatsache, dass wir Schokolade mögen und nicht ohne sie leben möchten. Und das Gleiche gilt für den freien Willen.
(Ein anonymer Gutachter dieses Buches wandte hier ein, dass nicht alle Menschen Schokolade mögen. Wenn das wahr wäre, so wäre das für mein Argument natürlich vernichtend, aber ich glaube keine Sekunde daran. Die meisten Menschen, die behaupten, keine Schokolade zu mögen, sind miese Lügner, die man meist auf dem Parkplatz hinter dem Müllcontainer mit einem Schokoriegel erwischen kann, und die wenigen Übrigen, die glauben, sie nicht zu mögen, sind schlicht verwirrt. Sie haben Schokolade wohl nur noch nicht in der richtigen Umgebung probiert. Wenn Sie in diese Kategorie fallen, versuchen Sie es mit einer Schokoladentorte unter der Bettdecke bei zugezogenen Vorhängen, während Sie die Wiederholung ihrer Lieblingsserie schauen. Sie werden vom Ergebnis überrascht sein.)
![]()
2
WAS GEGEN DEN FREIEN WILLEN SPRICHT
Beginnen wir mit den Argumenten gegen den freien Willen. Später werde ich untersuchen, ob an ihnen etwas dran ist, doch in diesem Kapitel möchte ich die Argumente lediglich in der eindrücklichsten Weise so formulieren, wie sie die Feinde des freien Willens verstehen.
Die zentrale Idee hinter den Argumenten gegen den freien Willen ist die Idee des Determinismus, daher beginne ich bei ihr.
Der Determinismus
Stellen wir uns ein Billardspiel vor. Sie stoßen die weiße Kugel gegen die Acht und versenken diese dadurch in einem Eckloch. Angesichts der Art, wie die weiße Kugel die Acht getroffen hat – die exakte Kraft des Aufpralls, der genaue Drall der weißen Kugel und so weiter –, hat es den Anschein, dass es nur eine Möglichkeit gab, wie sich die Acht verhalten konnte. Mit anderen Worten, es scheint, dass die genaue Art des Aufpralls der weißen Kugel auf die Acht den darauf folgenden Lauf der Acht determiniert hat. Die Acht, so scheint es, hätte gar nicht anders rollen können. Stellen wir es uns im Sinne einer physikalischen Gesetzmäßigkeit vor: Anscheinend war die Acht durch die Gesetze der Physik oder der Natur gezwungen, sich so zu verhalten, wie sie es tat.
Der Determinismus ist die Auffassung, dass es sich bei allen Ereignissen so verhält. Er vertritt die Ansicht, dass jedes physikalische Ereignis im Einklang mit den Naturgesetzen ganz und gar von vorangehenden Ereignissen verursacht ist. Oder, um es andersherum zu formulieren, der Determinismus ist die Auffassung, dass jedes Ereignis eine Ursache hat, die es auf die einzige Art und Weise eintreten lässt, in der es geschehen kann.
(Tatsächlich ist diese Darstellung des Determinismus etwas grob. Genauer müsste man sagen: Der Determinismus ist die Auffassung, dass eine vollständige Darlegung der Naturgesetze zusammen mit einer vollständigen Beschreibung des Universums zu einem gegebenen Zeitpunkt logisch die komplette Beschreibung des Universums zu allen späteren Zeiten enthält.)
Doch wie immer wir den Determinismus definieren, worauf es mir hier vor allem ankommt, ist, dass er intuitiv richtig klingt, ja dass er geradezu selbstverständlich erscheint. Um zu sehen, warum das so ist, betrachten wir ein anderes Billardbeispiel. Nehmen wir an, wir legen zwei Kugeln genau nebeneinander und Sie und ich...