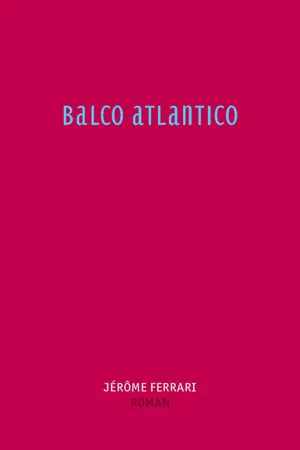![]()
TRAUM EINES JUNGEN MÄDCHENS
(1991–1996)
![]()
– Nein, schau mich nicht an! Ich, ich schaue, aber du nicht!
Splitternackt ausgestreckt auf ihrem Bett schließt Virginie ihre Augen, sie schließt sie fügsam und voller Inbrunst. Sie gehorcht Stéphanes Stimme und rührt sich nicht, als höre sie zugleich ihre eigene verwunderte Stimme, die in der Stille ihrer Seele spricht. Er sitzt auf einem Stuhl ihr gegenüber. Er betrachtet sie über Minuten hinweg. Er stürbe eher, als sie zu berühren. Er verspürt jedoch keinerlei Unbehagen dabei, sich dergestalt mit ihr in ihrem Zimmer einzuschließen. Marie-Angèles Missbilligung ist ihm völlig einerlei. Nein, da gibt es überhaupt keinen Grund für Unbehagen oder Scham in dem, was er da tut. Er schwebt zusammen mit Virginie weit oberhalb der gewöhnlichen Kriterien moralischen Urteils, in den ätherischen Dämpfen einer andauernden Trunkenheit des Geistes. Auf der Brunnenmauer war Virginie schlagartig weiblich geworden, ohne aufzuhören, ein Engel zu sein. Das ist vollkommen unerklärlich. Als sie wiederholte, dass sie ihn liebe, gab er der Kraft der Wahrheit nach und musste antworten, dass auch er sie liebe. Denn er liebt sie. Aber wie? Was soll dies heißen? Er will sie spüren, nah bei sich, er will sie sehen, sich an ihrer Schönheit laben, aber nichts will er entweihen. Als sie ihm das erste Mal vorschlägt, sich zu entkleiden, willigt er umgehend ein, ohne zu zögern, ohne zu erröten. Er hat große Augen gemacht und sie gesehen, sie, die ihn in seiner Betrachtung belauerte. Es schien ihm, als läge in dieser Redundanz, in diesem Spiel der Spiegel, etwas Schlechtes, das er um jeden Preis zu meiden hatte. Er bat sie darum, die Augen zu schließen. Er wird sie noch monatelang darum bitten. Sie hat das Recht, zu sprechen.
– Wirst du mit mir schlafen?, fragt sie.
– Ja, aber nicht sofort. In ein paar Jahren.
– Aber wann? Ich bin bereit. Wann?
– In einigen Jahren. Wenigen Jahren.
– Aber du hast gesagt, du liebst mich.
– Ja. Eben deshalb. Eben weil ich dich liebe.
Er ist so unglaublich ernst. Virginie schließt die Augen und scheint es zu glauben. Während Stéphanes Blick über ihren Körper gleitet und sie erbeben lässt, stellt sie sich vielleicht das erste Mal vor, da sie miteinander schlafen werden. Das erste Mal, da er sie bitten wird, die Augen zu öffnen. Nachdem er sie lange angesehen hat, bittet er sie, sich wieder anzuziehen. Als sie es getan hat, nimmt er sie in seine Arme, drückt sie mit aller Kraft an sich, atmet ihren Duft ein und gibt ihr zärtlich Küsse auf die Stirn.
Das Jahr verstrich, Vincent fühlte sich immer müder und sehnsüchtiger. Die Spaltung hatte ihn erschöpft. Aufgestützt auf den Tresen lächelte er Hayet wohlwollend an, die neue Kellnerin, die Marie-Angèle eben erst eingestellt hatte. Sie war von makelloser Schönheit, aber es war, sichtbarer noch als ihre Schönheit, ihre Melancholie, die sie in Vincents Augen so umwerfend erscheinen ließ. Er mochte Kellnerinnen. In jeder von ihnen erahnte er eine Geschichte des Scheiterns, etwas Stechendes, von dem er, der alte Romantiker, sich erträumte, sie würden es ihm schließlich anvertrauen. Er liebte es, sie anzuschauen und im Tone brüderlicher Anteilnahme zu ihnen zu sprechen. Das wog mehr als dieser spürbare Hass, den er nicht mehr ablegen konnte, seit die Spaltung vollzogen war, Vincent konnte einfach nicht glauben, dass er einen so heftigen Hass gegenüber Männern empfinden konnte, die er jahrelang als seine Brüder geachtet hatte. Zudem war ihm klar, dass sein Hass nicht in persönlichen oder auch nur konkreten Gründen zur Klage begründet lag. Er hasste sie als Gruppe, und zwar nur, weil sie sich abgespalten hatten und nicht mehr auf der gleichen Seite standen wie er. Vincent war viel zu intelligent, um über solch einen Beweggrund Genugtuung zu empfinden, zu seiner großen Überraschung jedoch blieb sein Hass deswegen nicht minder heftig. Und dennoch fragte er sich, ob dieser nicht ebenso irreal war wie die einstige Brüderlichkeit. Schließlich sprach er mit Dominique darüber, der entschied:
– Du hasst sie, weil sie hassenswert sind. Die verdienen bestenfalls unsere Verachtung. Ich gebe mir nicht die Mühe, sie zu hassen. Die sollen mir bloß nicht querkommen, das ist alles. Sie schießen fünfzehn Jahre Kampf in den Wind.
Vincent haderte.
– Die dürften von uns das Gleiche denken.
– Weil sie falsch liegen. Bist du dir etwa nicht sicher, dass du recht hast?
– Doch, bin ich. Das Problem ist nur, dass ich nicht weiß, warum ich mir da so sicher bin. Ich will sie weder in Schutz nehmen noch sonst irgendwas, du weißt, was ich von ihnen halte. Aber genau das irritiert mich.
Dominique zuckte mit den Schultern. Vincent beneidete ihn ein wenig. Er bemerkte an ihm eine unerschütterliche und leuchtende Überzeugung, die ihm selbst, er wusste es nur zu gut, nicht eigen war. Dominique glaubte, das Gute wie das Böse seien stets klar zu benennen. Und dabei war er ja kein Volltrottel. Er war eine reine Seele. Damit seine Welt nicht zu Staub zerfiele, musste er annehmen, dass die von anderen gefällten Entscheidungen schlecht waren, ebenso wie die Beweggründe, die sie dazu gebracht hatten, diese Entscheidungen zu fällen. Das war alles. Und doch, Vincent hätte es schwören können, litt er furchtbar unter der Spaltung. Sie traf ihn noch in den Grundfesten seines Lebens. Die Gewissheit jedoch, auf der richtigen Seite zu stehen, half ihm, sein Leid zu ertragen. Vincent konnte die Dinge einfach nicht so sehen. Ihm schien, es handele sich gar nicht um politische Überzeugungen oder Entscheidungen. Da war etwas Tiefes und Bestialisches, etwas wie die rohe Gewalt eines Hordeninstinkts, ein wildes Begehren, sein eigenes Leben gegen das des anderen zu behaupten. Aus der Tiefe eines animalischen Gedächtnisses drangen lang gedehnte Kriegsschreie zu ihm herauf und Hordenrufe, das freudige Gebrüll erregter Raubtiere, die Klage der zu Tode erschrockenen Beute, blutrünstige Festmahle. Der Hass ist fröhlich, im Grunde seines Wesens, voller Vitalität. Liebende bedauern die verlorene Einheit nicht. Sie beten um Krieg. Im Lärm der aufkommenden Kriege hörte Vincent das dunkle Herz nicht mehr schlagen, er hörte die aufflutenden Ströme der Traurigkeit nicht mehr fließen, gegen die anzukämpfen er doch nie aufgegeben hatte.
Grenzen zeichneten sich ab. Die vertraute Physiognomie der Welt war brutal verwandelt worden von der Feindschaft der Menschen. Es gab unzählige Arten von Orten, Straßen, Cafés, Restaurants, ganze Dörfer, die man nicht aufsuchen konnte, da die anderen dort in der Mehrheit waren – und es war, als wären sie von der Karte getilgt. Corte vor allem war von einem unsichtbaren eisernen Vorhang durchzogen und die Stimmung war besonders bleiern. Hatten sie sich auch alle in ihre jeweiligen Bars verschanzt, so konnten die Studenten beider Seiten es doch nicht vermeiden, sich auf dem Cours Paoli über den Weg zu laufen oder sich im Hörsaal zu begegnen. Die Plakatierer und Flugblattverteiler der beiden verfeindeten Studentenschaften stießen häufig aufeinander, Auge in Auge. Schlägereien, denen Todesdrohungen folgten, brachen von Zeit zu Zeit aus. Alte Freundschaften waren zunichtegemacht. Die Spannungen hielten an. Alles in allem jedoch schlug die Situation nicht wirklich um. Jedes Mal, wenn Stéphane sich zur Universität begeben musste, war Virginie krank vor Sorge. Sie bat ihn, bei ihr zu bleiben. Wenn er ablehnte, Mal um Mal, indem er ihr freundlich erklärte, dass er zu gehen habe, begann sie zu weinen, warf ihm aber zugleich einen Blick verzweifelter Bewunderung zu, als bewiese er übermenschlichen Mut. Sie flehte ihn an, er möge doch zumindest Acht auf sich geben und niemals ohne Waffe das Haus verlassen. Kein Mal fasste er den Mut, ihr zu sagen, dass sie übertrieb. Er mochte es, derart bewundert zu werden. Und doch empfand er sich selbst nicht als bewundernswert. Dominique und Vincent setzten ihn nach wie vor nur aufgrund seiner intellektuellen Fähigkeiten ein. Tatsächlich hatten sich seine illegalen Aktivitäten auf die regelmäßige Teilnahme an den damals sehr häufig abgehaltenen Pressekonferenzen im Untergrund beschränkt. In einen schwarzen Zweiteiler gekleidet und mit einer Wollmaske über, die ihm auf der Haut kratzte, stand er neben anderen, ebenso wie er gekleideten Aktivisten aufrecht und regungslos da, eine Pumpgun in der Hand, während ein Pseudoverantwortlicher (in Wahrheit nur ein ob der vollkommenen Banalität seines Stimmtimbres erwählter Aktivist aus der Basis) hinter einem behelfsmäßigen, mit der korsischen Mohrenkopfflagge bedeckten Tisch einen Text vortrug vor versammelten Journalisten, die man in die Macchia geführt hatte. Das war kein besonders erhebendes Ritual. Am Folgetag, da Stéphane sich auf dem in der Zeitung publizierten Foto wiedererkannte, wirkte er auf sich selbst dämlich. Stillos. Er schnitt das Foto dennoch aus und gab es Virginie. Sie stieß Schreie kindlicher Verzückung aus und warf sich ihm um den Hals. Und dann legte sie sich splitternackt auf das Bett und achtete peinlich darauf, die Augen nicht zu öffnen. Wie hätte er ihr sagen können, dass er sich wie eine Niete behandelt vorkam? Er ließ sie glauben, was sie glauben wollte. Doch er belog sie nicht. Er hatte, konnte er ihr doch die Umarmung von Liebenden, die sie erwartete, nicht gewähren, von Anfang an den Eindruck, ihr etwas weitaus Größeres schuldig zu sein und Selteneres, die Wahrheit. Er hatte ihr also nichts verheimlicht von seinen Aktivitäten. Hätte man ihm seinen Mangel an Vorsicht zum Vorwurf gemacht, er hätte es nicht verstanden. In seinen Augen wäre Vorsicht unverschämt gewesen, ja nicht einmal denkbar. Mit dem, was er ihr anvertraute, errichtete Virginie ihm einen Ruhmestempel. Stéphane war geschmeichelt und verlegen. Es wäre ihm lieb gewesen, hätte man ihm die Gelegenheit eingeräumt, zu beweisen, dass er all diese Inbrunst zumindest auch ein wenig verdiente. Woche um Woche nach Corte hochzufahren, war dies etwa des Mutes nicht Beweis genug? Mag sein, doch dessen wurde er sich nicht bewusst. Es schien ihm noch immer, dass diese ganze Unruhe fiktiv war und niemand sie im Grunde ernst nahm oder gar wirklich fürchtete. Es schien ihm wesentlich wichtiger, weiterhin seine Broschüren zu verfassen. Er hatte eben erst mit seiner Doktorarbeit zur Geschichte der Gewalt begonnen und Hilfe erbeten bei Professor Théodore Moracchini, der gerade erst in Corte angekommen war und sich bereit erklärte, ihm die wichtigen ethnologischen Präzisierungen zu liefern sowie die methodologischen Ratschläge, die er benötigte. Die Treffen fanden regelmäßig statt und verliefen außerordentlich gut. Stéphane hatte keinerlei universitären Ehrgeiz. Er konnte sich kein anderes Leben vorstellen als eines innerhalb der Bewegung. Er wollte seine intellektuellen Bestrebungen jedoch befriedigen und sie der Konstruktion einer Vergangenheit widmen, die alle mit Stolz zu erfüllen vermochte. Wenn die Führung der Studentenschaft ihm die Zeit dazu ließ, ging er in die Archive. Er vergaß die Bedrohungen der Gegenwart, derweil er in die dunklen Familienkonflikte der Vergangenheit eintauchte. Er zog daraus abscheuliche Geschichten von Rache und Mord, Geschichten unerhörter Brutalität, die er Virginie erzählte, der so glückseligen und verträumten Virginie.
Eines Abends dann in Corte, da findet er sich im Anschluss an eine Versammlung im Zimmer eines Mädchens wieder. Seit den zwei Jahren, in denen er mit Virginie zusammen ist, hat er kein Sexualleben mehr. Die einzige Nacktheit, die er beschaut, ist die einer heranwachsenden Heiligen. Er kennt nur die spirituelle Ekstase. In jener Nacht ist sein Ergötzen unvergesslich. Und am Morgen, da sind es die Schuld und die Migräne, die ihn wecken in diesem Bett im Wohnheim der Studentin. Der nackte Körper des Mädchens widert ihn an. Er steht auf und macht sich so schnell er kann davon. Sein Kopf lässt ihn furchtbar leiden, ihm ist ununterbrochen übel. Er hat den Eindruck, eine wohlverdiente Strafe abzubüßen. Virginie erwartet ihn im Dorf. Als er ankommt, errät sie aufgrund seines fahlgrauen Teints, dass er, wie es ihm häufig geschieht, den ganzen Tag über gelitten hat, und sie drückt ihre frischen Handballen gegen seine Stirn, um ihn zu erleichtern. Er hat sie nie belogen, er hat ihr nie etwas verhehlt. Er sagt zu ihr, dass er mit einem Mädchen geschlafen hat. Sie wird so blass, dass er glaubt, sie werde sterben und dass auch er darüber sterben werde. Die Liebe und das Mitgefühl zerreißen ihn. Er redet ununterbrochen auf sie ein, drückt sie an sich, sagt zu ihr, dass das nichts Schlimmes sei, dass es nichts zu bedeuten habe, dass er betrogen worden sei von den Bedürfnissen seines Körpers, dann schlaf doch mit mir, sagt Virginie, ich bin jetzt fünfzehn Jahre alt, er sagt aber Nein zu ihr, er sagt zu ihr, dass dies nicht möglich sei, dass sie noch zu jung sei und er sie nicht beschmutzen möchte, er sagt zu ihr, dass sie sich Illusionen mache, dass das nicht so schön sei, wie sie glaube, er sagt zu ihr, dass selbst wenn einer so liebe, wie er sie liebt, es doch immer auch noch schmutzig bleibe. Weil du mich liebst, liebst du mich noch immer?, fragt Virginie flehentlich, und er spürt das Gift der Liebe durch seine brennenden Adern schießen. Ich liebe dich über alles. Ich kann es nicht einmal ausdrücken. Ich werde sterben, wenn du unglücklich bist. Ja, sagt Virginie, ja. Ich weiß, dass du mich liebst.
In der darauffolgenden Woche dann, in Corte, da schläft er mit einem anderen Mädchen, und mit noch einem anderen. Die Schuld ist nun verschwommener, beinahe unwirklich. Das zählt nicht, tatsächlich. Das hat so wenig zu tun mit dem unfassbaren Maß seiner Liebe. Nichts ist Virginie genommen. Nichts kann ihr genommen werden. Ich liebe dich, man nimmt dir nichts, niemand kann dir etwas nehmen, die Dinge sind so erhaben, die dir eigen sind, dass die anderen nicht einmal wissen, dass sie existieren, sie können nicht einmal davon träumen, du musst mir glauben, du weinst umsonst und du brichst mir das Herz, sie wissen nicht einmal, dass das existiert, und du, du besitzt es, es gehört dir, hör mir zu, schau mich an, schau mich an und sieh, ob ich dich belüge, habe ich dich je belogen? Nie, sagt Virginie und wischt ihre Tränen weg. Diese Mädchen, das ist nichts, rein gar nichts, das ist so was von nichts, dass ich sie dir nie verhehlen werde, die anderen belügen einander, sie alle belügen die Frau, die sie lieben, und ich, ich belüge dich nicht, ich werde dich nie belügen, das ist es, was zählt, du besitzt die Wahrheit, sie gehört dir, du musst einsehen, der Körper kennt Bedürfnisse, man kann sie nicht übergehen, es ist nichts, bist du etwa eifersüchtig, wenn ich esse?, eifersüchtig auf die Nahrung? Nein, sagt Virginie. Na also, genau das ist es, es ist genau das. Aber werden wir miteinander schlafen? Ja, wenn du achtzehn bist, dann werden wir miteinander schlafen, das ist in drei Jahren, drei Jahre, für dich und für mich, das ist nichts, und wenn wir miteinander geschlafen haben werden, werde ich niemals mehr mit jemand anderem schlafen als mit dir. Ich schwöre es.
Tony Versini fand Hayet immer anziehender. Gleichzeitig ging sie ihm unglaublich auf die Nerven.
– Die spielt sich auf, behauptete er. Ich sage euch, die spielt sich auf.
– Glaube ich nicht, widersprach Vincent, glaube ich wirklich nicht. Erstens ist sie sehr, sehr schön, und das, das vermittelt immer den Eindruck leichter Arroganz, und dann, dann ist sie zudem noch traurig. Und von daher glauben die kleinen Arschlöcher deines Schlages, die rein gar nichts verstehen, nichts von der Traurigkeit, nichts von der Schönheit, genau die glauben dann, dass eine sich aufspielt.
Alle lachten, nur Tony wollte nicht ablassen: Hayet spielte sich auf.
– Und dann, fügte Stéphane hinzu, wähnst du dich derart unwiderstehlich, dass sich ein Mädchen, das sich nicht um dich schert, für dich aufspielt. Obwohl du es wahrscheinlich selbst bist, der sich für Wunder was hält, und nicht sie, die Ärmste. Wenn du dieses Mädchen willst, musst du dich anstrengen. Du weißt noch nicht einmal, was das heißt, sich anzustrengen. Du bist nur zum Nuttenprellen zu gebrauchen.
– Egal, sagt Tony, ob nun Nutte oder nicht Nutte, ich, ich kann keine Araberinnen vögeln.
– Warte mal, dass ich dich richtig verstehe, fragte ihn Vincent, hast du nicht eben erst behauptet, du findest sie attraktiv?
– Doch, gab Tony zu.
– Und sehr schön?
– Doch.
– Also, was soll der Scheiß dann?
Tony versuchte sich zu erklären. Es ginge nicht darum, ob das Mädchen schön sei oder nicht, auch nicht darum, ob sie ihm gefalle, er könne eben nur keine Araberinnen vögeln, und Schwarze auch nicht, im Übrigen, aber er sei nicht rassistisch, eine Chinesin könne er, wenn er wolle, vögeln, es sei eben nur so eine körperliche Sache, eine Unmöglichkeit. Er fand das krankhaft. Ganz abgesehen davon, dass die Araberinnen, soweit er wisse, seltsame Angewohnheiten hätten, wie sich die Möse zu rasieren oder in den Arsch ficken zu lassen beim erstbesten Anlass.
– Wo hast’n das aufgeschnappt?, fragte Vincent betroffen. Hast du Studien darüber gelesen? Und dann, auch wenn es wahr wäre, bist es ja nicht du, der in den Arsch gefickt wird, und was eigentlich hast du gegen rasierte Mösen?
– Überhaupt nichts, gab Tony zu.
– Na, und also?
– Es ist nur, dass ich nicht glaube, dass ich eine Araberin vögeln könnte.
Vincent schaute ihn an mit einer Mischung aus Ekel und irrer Zuneigung, wie einen kleinen, zurückgebliebenen Bruder. Er zog ihn am Ohr.
– Du bist wirklich der Obertrottel, Tony! Ist dir das klar, ist dir wenigstens das klar?
Jedes Mal fällt er zurück auf diesen Stuhl, dem Bett gegenüber, auf dem der nackte Körper von Virginie ausgestreckt liegt. Damit sie nicht länger ermüdet vom Zusammenkneifen der Lider, hat er ihr eine Binde aus schwarzer Seide gekauft, die sie um ihren Kopf gebunden trägt, solange er sie betrachtet. Er hat sein aktives Sexualleben wieder aufgenommen, und die Erinnerungen an all die weiblichen Leiber spritzen Schmutz auf Virginies Körper und lassen ihn wundbrandig werden. Noch immer ist es der Körper eines Fleisch gewordenen Engels, doch kleinste Schatten, Flecken der Fäulnis gleich...