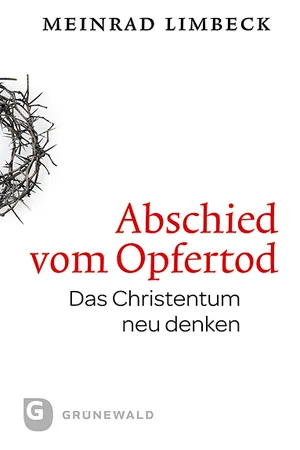
- 160 pages
- English
- ePUB (mobile friendly)
- Available on iOS & Android
eBook - ePub
About this book
Jesus ist am Kreuz zur Sühne unserer Sünden gestorben - seit Jahrhunderten bestimmt diese Überzeugung den Glauben vieler Christen wie auch Lehre und Liturgie der Kirche. Kann das Christentum als Religion der Liebe wirklich auf solch einem Opfer gründen und darin seinen Sinn haben? Nach dem Neuen Testament jedenfalls kam Jesus nicht, um zu sterben, sondern um die frohe Botschaft vom Reich Gottes zu verkünden. Meinrad Limbeck erschließt überraschend und biblisch fundiert, dass nicht ein von Gott gewollter Opfertod Jesu den Sinn des Christentums ausmachen kann. Er entwickelt Grundlinien eines christlichen Glaubens, der konsequent die Botschaft vom liebenden und befreienden Gott ins Zentrum stellt.
Frequently asked questions
Yes, you can cancel anytime from the Subscription tab in your account settings on the Perlego website. Your subscription will stay active until the end of your current billing period. Learn how to cancel your subscription.
At the moment all of our mobile-responsive ePub books are available to download via the app. Most of our PDFs are also available to download and we're working on making the final remaining ones downloadable now. Learn more here.
Perlego offers two plans: Essential and Complete
- Essential is ideal for learners and professionals who enjoy exploring a wide range of subjects. Access the Essential Library with 800,000+ trusted titles and best-sellers across business, personal growth, and the humanities. Includes unlimited reading time and Standard Read Aloud voice.
- Complete: Perfect for advanced learners and researchers needing full, unrestricted access. Unlock 1.4M+ books across hundreds of subjects, including academic and specialized titles. The Complete Plan also includes advanced features like Premium Read Aloud and Research Assistant.
We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.
Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.
Yes! You can use the Perlego app on both iOS or Android devices to read anytime, anywhere — even offline. Perfect for commutes or when you’re on the go.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Yes, you can access Abschied vom Opfertod by Meinrad Limbeck in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in Theology & Religion & Religion. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.
Information
Jesu Weg zum Kreuz
1. Wollte Gott wirklich Jesu Tod?
Mag es in der Lehre noch so große Differenzen zwischen den einzelnen christlichen Kirchen und Gemeinschaften geben, an einem Punkt stimmen alle überein: Jesus von Nazaret hat uns Menschen nach Gottes Willen durch seinen Tod am Kreuz erlöst und mit Gott versöhnt. So hatte bereits eine Vielzahl der ersten Christen in ihren Schriften, in unserem Neuen Testament, Jesu Tod gesehen und gedeutet, und so haben es wohl auch noch die meisten in unserem Land in ihrem Religionsunterricht gelernt. Doch kann man den Kreuzestod Jesu auch heute noch so deuten und verstehen?
Zwei Überlegungen müssten hier nachdenklich machen:
1. Angenommen, Jesu Tod am Kreuz wäre tatsächlich der einzig mögliche Weg zur Erlösung der Menschen gewesen, dann wäre die Erlösung gescheitert, wenn Jesus mit seiner Verkündigung und in seinem Wirken verstanden und akzeptiert worden wäre. Hätte dann aber nicht Gott selbst (menschlich gesprochen) für Jesu Scheitern Sorge tragen müssen (und genau das hatte der Apostel Paulus ja auch geglaubt!2). Dann hätten freilich weder Jesus noch der Großteil seiner Zeitgenossen eine echte Chance zum gegenseitigen Verständnis gehabt! Waren sie also nur Marionetten auf Gottes Bühne?
2. Wann und wo immer Menschen Gottes guten Willen missachten3 – religiös gesprochen: wann und wo immer sie sündigen –, hat ihr Verhalten negative Auswirkungen auf ihre Welt und auf sie selbst: Man lässt positive Möglichkeiten ungenützt, man zerstört mögliches Heil und man wird so in seinem eigenen Fühlen, Denken und Handeln immer liebloser. Wie sollte es da möglich sein, dass der gewaltsame Tod eines anderen Menschen die eigenen inneren Festlegungen – die Prägungen im Gehirn – auflöst und zerbrochene, verfehlte positive Möglichkeiten neu schafft?
Derartige Überlegungen sind freilich unnötig. Wer unvoreingenommen dem ältesten Bericht folgt, der im Rahmen des Markusevangeliums den Weg schildert, an dessen Ende die Kreuzigung Jesu stand, kann sehr deutlich erkennen, welche Erfahrungen, Umstände und Kräfte zu Jesu gewaltsamem Tod geführt hatten. Hätten sich unter anderen Umständen andere Kräfte aufgrund anderer Erfahrungen durchsetzen können, wäre es gewiss nicht zu Jesu Hinrichtung gekommen. Nichts zwingt uns, in Jesu Tod ein unumgängliches gottgewolltes und gottgefälliges Opfer zur Erlösung der Menschen zu sehen.
Freilich, wenn Jesus nicht nach Gottes Willen am Kreuz als Opfer und Sühne für die Sünden aller Menschen starb, worin könnte dann die Bedeutung seines Lebens und Wirkens für uns Menschen heute bestehen? Gibt es dann überhaupt noch einen wirklichen Grund für die Existenz der christlichen Kirchen und Gemeinschaften? Ganz gewiss! Denn in dem Augenblick, in dem die Bedeutung Jesu nicht länger an dessen Hinrichtung auf Golgota festgemacht wird – so wie es bereits beim Apostel Paulus geschah4 –, werden wir fähig zu sehen und zu hören, wie Jesu Botschaft und Wirken uns heute über alle Konfessionen und Glaubensgemeinschaften hinaus den Weg zu einem sinnvollen Leben weisen und dem Glauben an Gott einen guten Grund und eine neue Strahlkraft verleihen können. Dies deutlich zu machen, ist das Ziel der folgenden Kapitel, damit wir nicht länger für die eigentliche, frohe Botschaft taub und blind bleiben, die für immer mit dem Leben und Wirken Jesu von Nazaret verbunden sein wird.
2. Das Gottesbild Jesu
Wer Jesu Leben und Sterben verstehen will, muss eines ganz ernst nehmen: Für Jesus gab es keinen Zweifel an der Existenz Gottes. Als Glied des Volkes Israel hatte er von klein auf gelernt: Seit Israels Auszug aus Ägypten ist Jahwe, der Herr, Israels Gott; denn eben deshalb, weil Jahwe Israels Gott sein wollte, hatte er die Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs aus der ägyptischen Knechtschaft befreit und inmitten all der anderen Völker zu seinem Volk gemacht. Daher lautete auch Jesu Glaubensbekenntnis:
»Höre, Israel! Jahwe, unser Gott, Jahwe ist einzig. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft!« (Deuteronomium / 5 Mose 6,4f.)
So dürfte auch Jesus im Rahmen seiner Familie von Kindheit an gelernt haben, was zu tun und was zu lassen war, wenn man als ein Kind Israels Gott mit ganzem Herzen und mit ganzer Kraft lieben wollte. Das heißt, wir können mit guten Gründen davon ausgehen, dass Jesus sich in seiner Frömmigkeit nicht wesentlich von seinen Alters- und Volksgenossen unterschieden hat. Und doch! Als Jesus öffentlich lehrte und wirkte, wich er an zwei wesentlichen Punkten gezielt und sehr direkt von der allgemein praktizierten Frömmigkeit ab. In diesen Fällen hatte er ein ganz eigenes Gottesbild.
2.1 Heilungen am Sabbat
Weshalb konnten sich nicht alle Zuschauer dabei mitfreuen?
»Am Sabbat lehrte Jesus in einer Synagoge. Dort saß eine Frau, die seit achtzehn Jahren krank war, weil sie von einem Dämon geplagt wurde; ihr Rücken war verkrümmt, und sie konnte nicht mehr aufrecht gehen. Als Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sagte: Frau, du bist von deinem Leiden erlöst. Und er legte ihr die Hände auf. Im gleichen Augenblick richtete sie sich auf und pries Gott. Der Synagogenvorsteher aber war empört darüber, dass Jesus am Sabbat heilte, und sagte zu den Leuten: Sechs Tage sind zum Arbeiten da. Kommt also an diesen Tagen und lasst euch heilen, nicht am Sabbat.« (Lukas 13,10–14)
Und bald darauf noch einmal:
»Als Jesus an einem Sabbat in das Haus eines führenden Pharisäers zum Essen kam, beobachtete man ihn genau. Da stand auf einmal ein Mann vor ihm, der an Wassersucht litt. Jesus wandte sich an die Gesetzeslehrer und die Pharisäer und fragte: Ist es am Sabbat erlaubt zu heilen, oder nicht? Sie schwiegen. Da berührte er den Mann, heilte ihn und ließ ihn gehen.« (Lukas 14,1–4)
Jesus hatte sich mit seinen Heilungen am Sabbat ganz offensichtlich nicht nur Freunde gemacht:
»Als er ein andermal in eine Synagoge ging, saß dort ein Mann, dessen Hand verdorrt war. Und sie gaben acht, ob Jesus ihn am Sabbat heilen werde; sie suchten nämlich einen Grund zur Anklage gegen ihn.« (Markus 3,1f.)
Was waren die Gründe für ein derart feindseliges Verhalten gegenüber Jesus gerade am Sabbat?
Die Antwort finden wir in einer jüdischen Nacherzählung des biblischen Schöpfungsberichts aus dem zweiten vorchristlichen Jahrhundert. Nach ihr offenbarte ein Engel dem Mose:
»Und allen Engeln des Angesichts und allen Engeln der Heiligung, den beiden großen Geschlechtern, uns sagte er [Gott] dieses, dass wir Sabbat feiern sollten mit ihm im Himmel und auf der Erde. Und er sagte zu uns: ›Siehe, ich will schaffen und erwählen mir ein Volk mitten aus meinen Völkern. Und sie werden mir Sabbat halten. Und ich werde sie heiligen mir zu einem Volk. Und ich werde sie segnen. Wie ich geheiligt habe den Tag des Sabbats und ihn mir heiligen werde, so will ich es segnen. Und sie werden mir mein Volk sein, und ich werde ihr Gott sein. Und ich habe auserwählt den Samen Jakobs unter allem, was ich gesehen habe, und ich habe ihn mir aufgeschrieben als erstgeborenen Sohn. Und ich habe ihn mir geheiligt in die Ewigkeit der Ewigkeit. Und den Tag des Sabbats werde ich ihnen zeigen, damit sie Sabbat halten an ihm von aller Arbeit.‹ Und er machte an ihm ein Zeichen, nach welchem sie Sabbat halten sollten mit uns am siebenten Tag, zu essen und zu trinken und ihn zu segnen, der alles geschaffen hat, wie er gesegnet und geheiligt hat sich das Volk, das aus allen Völkern hervorragt, damit sie Sabbat halten in Gemeinschaft mit uns, aufsteigen zu lassen seine Gebote als schönen Duft, der angenehm sein sollte vor ihm alle Tage.«5
Weil für die Menschen in Israel zur Zeit Jesu die Gemeinschaft mit Gott, das heißt: die Teilnahme an Gottes Sabbaten, im Mittelpunkt eines jeden Sabbats stand, hatte in ihren Augen der Mensch am Sabbat seine Bedürfnisse und Nöte zurückzustellen. Zwar unterbricht Gott nach jüdischem Verständnis sein Wirken als Schöpfer und Richter auch am Sabbat nicht, doch sind davon all jene Fälle zu unterscheiden, in denen der Mensch mit seinen nicht lebensnotwendigen Sorgen und Bitten in die Ruhe und Freude Gottes ›einbricht‹; denn in all diesen Fällen macht der einzelne Israelit nicht wirklich ernst damit, dass er am Sabbat an Gottes Ruhe und Freude teilnehmen darf. Um eben dieser göttlichen Ruhe willen soll der Mensch auf sein Bitten verzichten – weshalb bis zum heutigen Tag in der Synagoge am Sabbat kein Bittgebet gesprochen wird: »Alle Bitten um irdische Güter, so wichtig sie die ganze Woche genommen werden, müssen an diesem Tag schweigen.«6
Im Unterschied zu diesem bereits zu Jesu Zeit gängigen und allgemein akzeptierten frommen Sabbatverständnis war Gott in Jesu Augen zu jeder Zeit vor allem für die Menschen da, um ihnen, wann und wo immer möglich, Gutes zu tun und Heil zu schenken. Das heißt, Gottes Heilswille war nach Jesu Überzeugung jederzeit dem Bitten der Menschen voraus. Es gibt keinen Grund zu glauben, Gott würde zu irgendeiner Zeit und unter bestimmten Umständen seinen guten, dem Menschen bedingungslos entgegenkommenden Willen zurücknehmen und vorübergehend außer Kraft setzen.
Dieser Glaube bestimmte Jesus auch im Umgang mit den Sündern und Zöllnern.
2.2 Gemeinschaft mit Sündern und Zöllnern
Dass Jesus während seines öffentlichen Wirkens auch mit den Zöllnern und den sogenannten Sündern zusammengekommen war und Gemeinschaft gepflegt hatte, ist ebenso unbestritten wie die Tatsache, dass Jesus damit in bestimmten Kreisen großen Anstoß erregt hatte – beispielsweise bei der Berufung des Zöllners Levi:
»Als Jesus (am See) weiterging, sah er Levi, den Sohn des Alphäus, am Zoll sitzen und sagte zu ihm: Folge mir nach! Da stand Levi auf und folgte ihm. Und als Jesus in seinem Haus beim Essen war, aßen viele Zöllner und Sünder mit ihm und seinen Jüngern; denn es folgten ihm schon viele. Als die Schriftgelehrten, die zur Partei der Pharisäer gehörten, sahen, dass er mit Zöllnern und Sündern aß, sagten sie zu seinen Jüngern: Wie kann er zusammen mit Zöllnern und Sündern essen?« (Markus 2,14–16)
Ähnlich auch später, als Jesus sich bei dem Oberzöllner Zachäus in Jericho selbst einlud:
»Dann kam Jesus nach Jericho und ging durch die Stadt. Dort wohnte ein Mann namens Zachäus; er war der oberste Zollpächter und war sehr reich. Er wollte gern sehen, wer dieser Jesus sei, doch die Menschenmenge versperrte ihm die Sicht; denn er war sehr klein. Darum lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus zu sehen, der dort vorbeikommen musste. Als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf und sagte zu ihm: Zachäus, komm schnell herunter! Denn ich muss heute in deinem Haus Gast sein. Da stieg er schnell herunter und nahm Jesus freudig bei sich auf. Als die Leute das sahen, empörten sie sich und sagten: Er ist bei einem Sünder eingekehrt.« (Lukas 19,1–7)
Weshalb diese Aufregung und Empörung? Wir verstehen sie nur, wenn wir die folgenden drei Punkte nicht außer Acht lassen:
a) Nachdem die Verbannten um 530 v. Chr. aus dem babylonischen Exil zurückgekehrt waren, und seitdem der zerstörte Tempel in Jerusalem wieder aufgebaut war, hatten die Menschen in Israel immer entschlossener die Weisungen und Gebote zur Grundlage und zum Maßstab ihres Lebens gemacht, die in der Tora (= Weisung), in den sogenannten fünf Büchern Mose, als Ausdruck des göttlichen Willens niedergeschrieben waren. Darin stimmten alle Gläubigen in Israel überein, gleichgültig, ob sie (später) der Partei der Sadduzäer, der Pharisäer, dem Hohen Rat oder der Gemeinschaft von Qumran angehörten.
Freilich, die Menschen in Israel lebten auf keiner Insel, und deshalb kamen sie natürlicherweise auch mit den »heidnischen« Völkern in Berührung – sei es, weil viele von ihnen ins Ausland abwanderten, sei es, weil sich auch immer mehr »Heiden« in Palästina niederließen. Die Folge war unausweichlich. Man erlebte als Angehöriger des auserwählten Volkes, dass man auch dann gut, anständig und glücklich leben und in seinem Handeln Erfolg haben konnte, wenn man sich nicht an die göttlichen Gebote in der Tora, im Gesetz des Mose, hielt. Und so gab es in Israel immer mehr Menschen, die sich nicht länger von ihrer Bibel vorschreiben ließen, wie sie sich in ihrem Privat- und Geschäftsleben als Angehörige des auserwählten Volkes zu verhalten hätten.
Verständlicherweise reagierten alle, die ihre Zugehörigkeit zum auserwählten Volk Israel ernstnahmen, mit Ablehnung auf ein solch liberales, unjüdisches Verhalten. Wer sich vom Gesetz des Mose löste, war in ihren Augen ein Frevler (in griechischer Sprache: ein Sünder), selbst dann, wenn der einzelne dadurch viel Erfolg hatte. Wer gesetzlos lebte, war ein Sünder, der mit seinem Verhalten das Leben und das Land des auserwählten Volkes verunreinigte und der deshalb von allen abgelehnt und gemieden wurde, für die ihre Zugehörigkeit zu Gottes heiligem Volk eine besondere Verpflichtung darstellte.
Eine gute Charakterisierung des Frevlers, des Sünders, finden wir in Psalm 73:
»Ich aber – fast wären meine Füße gestrauchelt,
beinahe wäre ich gefallen.
Denn ich habe mich über die Prahler ereifert,
als ich sah, dass es diesen Frevlern so gut ging.
Sie leiden ja keine Qualen,
ihr Leib ist gesund und wohlgenährt.
Sie kennen nicht die Mühsal der Sterblichen,
sind nicht geplagt wie andere Menschen.
Darum ist Hochmut ihr Halsschmuck,
wie ein Gewand umhüllt sie Gewalttat.
Sie sehen kaum aus den Augen vor Fett,
ihr Herz läuft über von bösen Plänen.
Sie höhnen, und was sie sagen, ist schlecht;
sie sind falsch und reden von oben herab.
Sie reißen ihr Maul bis zum Himmel auf
und lassen auf Erden ihrer Zunge freien Lauf.
Darum wendet sich das Volk ihnen zu
und schlürft ihre Worte in vollen Zügen.
Sie sagen: ›Wie sollte Gott das merken?
Wie kann der Höchste das wissen?‹
Wahrhaftig, so sind die Frevler:
Immer im Glück, häufen sie Reichtum auf Reichtum.« (Psalm 73,2–12)
Die Sünder lebten gewiss nicht am Rande der Gesellschaft, wie bis heute immer wieder fälschlicherweise zu lesen und zu hören ist, um aus Jesus einen »Sozialapostel« zu machen. Sie hatten gesellschaftliche Macht, mit der sie über andere verfügen konnten.
b) Wenn sich e...
Table of contents
- NAVIGATION
- HAUPTTITEL
- INHALT
- Vorwort
- Teil I Jesu Weg zum Kreuz
- Teil II Ostern
- Teil III Deutungen des Todes Jesu
- Teil IV Das Erbe Jesu
- Teil V Der Sinn des Christentums
- Anmerkungen
- ÜBER DEN AUTOR
- ÜBER DAS BUCH
- IMPRESSUM
- HINWEISE DES VERLAGS