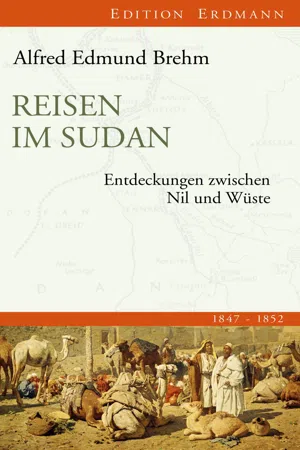![]()
VI. KHARTUM UND SEINE BEWOHNER
Die Geschichte des Sudan beginnt erst in unseren Zeiten; das vorher Geschehene ist durch das Blut von tausenden, der Habgier und Rache geopferten Menschen verwischt worden. Nur traditionell zieht sich die Erinnerung wie ein goldener Faden durch dieses trübe Blutmeer hindurch, die Erinnerung an die früheren glücklichen Zeiten unter der Herrschaft der eingeborenen Könige aus dem Stamm der Fungi, an die Zeiten, wo auf der Insel Argo in Nubien noch tausend Schöpfräder kreischten, wo dort noch ein König Gericht hielt, wo das Volk der Scheikïe, zu Berber und Halfaï, die Bewohner von Sennar, R oseeres und Fassokl noch eigne Herrscher hatten und Kordofan unter dem milden Szepter Darfurs stand. Aber diese Erinnerung lebt nur noch in dem Gedächtniss weniger; erst seit den Jahren 1820 und 1821 ist die Geschichte in aller Munde. Die Begebenheiten jener Jahre werden nie vergessen werden: verlassene Städte, verödete Felder und zu Grunde gerichtete Völker sprechen ohne Worte ihre nie verhallende Sprache. Ich meine mit jenen Ereignissen die Eroberung des Sudans und die Unterjochung seiner Völkerschaften durch die türkisch-ägyptischen Truppen.
Mit der Niedermetzelung der Mamelukken schien Mohammed-Alis Herrschaft in Ägypten erst neu gegründet, aber gesichert zu sein. Allein, noch war die Ruhe nicht hergestellt. Die Häuptlinge der Mamelukken waren gefallen, meuchlings gemordet, unbesiegt. Noch lebte ihre tapfere Kriegerschar. Aus ihrer Mitte wählten sie sich neue Führer und zogen sich nach Nubien zurück, in der Absicht, dort ein neues, von ihnen beherrschtes Reich zu gründen. Mohammed-Alis Truppen folgten ihnen. Ihrihm, Sais und andere Festungen der Mamelukken wurden belagert und erobert, obgleich die Belagerten mit Todesverachtung kämpften und den Siegern nur ihre Leichen überließen.
Im Jahre 1820 stellten sich die Scheikïe1 den Ägyptern bei Korti gegenüber. Mit Schaudern denkt noch heute jeder Nubier des unglücksvollen Tages. Die Ägypter siegten. Ein tapferes, heldenmütiges, aber regelloses Volk kämpfte mit Lanze und Schild gegen tüchtige Krieger mit dem ihm noch unbekannten Feuerrohr in der Hand. Seine Frauen waren mit ihren Kindern hinausgezogen, um die Männer durch gellenden Schlachtruf zum Kampf anzufeuern oder im frommen Gebet den Sieg für sie zu erflehen. Sie hielten ihre Kinder auf den Armen empor und beschworen liebkosend die Väter, ihr Teuerstes vor schmachvoller Knechtschaft zu bewahren. Der Kampf begann. Die Geschütze der Ägypter schleuderten Tod und Verderben in die Reihen der tapferen Nubier und, obgleich diese die Kanonen erreichten und mit dem Schwert in die metallenen Röhren Lücken zeichneten, welche man noch heute sehen kann*, entschied nicht die ruhmvolle Tapferkeit, sondern die Übermacht der Waffen den Sieg.
Nur noch einmal entflammte ihr Heldenfeuer, noch einmal erhob sich das edle Volk zur letzten Gegenwehr. Der kühne Melik el Nimmer2, d. i. der Tigerkönig, versammelte sein Volk zu Schendi. Schendi und Metämme, jene zwei südnubischen Schwesterstädte, sollten aufs Neue die Geisel des Siegers fühlen. Ismaël-Pascha3, des alten Mohammed-Ali Sohn, erschien mit seinen Soldaten im Oktober des Jahres 1822 auf vielen Schiffen vor Schendi. Er verlangte von dem dort herrschenden Melik innerhalb drei Tagen eine nicht zu liefernde Menge von Sklaven und mehr Geld, als je im Besitz des Häuptlings gewesen war. Diesem und seinem gesamten Volk stand die Todesstrafe bevor, wenn er die ihm auferlegte Steuer nicht entrichten konnte. Da gab ihm die Verzweiflung Mut. Der König heuchelte dem Pascha gegenüber die tiefste Unterwerfung. Durch falsche Vorspiegelungen lockte er Ismaël von seiner sicheren Barke in eine geräumige, mit dichter Serieba umschlossene Strohhütte. Große Strohhaufen lagen im Innern der Umzäunung aufgeschichtet und wurden als Kamelfutter ausgegeben. Melik Nimmer selbst richtete in jenem Tokhul dem Pascha ein Gastmahl zu, zu welchem alle höheren Offiziere gebeten wurden und auf Befehl ihres Gebieters erschienen.
Der Pascha und seine Getreuen sitzen beim Mahl. Vor der Serieba tönt die Tarabuka*, das junge Volk übt sich im fröhlichen Tanz. Sie werfen gegenseitig Lanzen aufeinander und fangen sie geschickt mit ihren Schilden auf. Der Pascha wirft zuweilen einen Blick auf das Getümmel und ergötzt sich an dem Geschick der Tanzenden. Und als wollten diese ihre ganze Gewandtheit zeigen, so rasch und wild werden ihre Bewegungen. Sie kämpfen scheinbar mit Erbitterung. Immer tobender werden ihre Spiele, immer heftiger dringen sie aufeinander ein, die Trommel tönt ununterbrochen fort, plötzlich aber auch in allen übrigen Teilen der Stadt. Ein gellendes durchdringendes Geheul durchzittert die Luft. Die Kämpfenden haben sich vereinigt und schleudern ihre Lanzen nicht mehr nach den Schilden ihrer Freunde, sondern in das Innere der Serieba auf die Türken. Von allen Seiten sieht man Frauen mit Flammenbränden herbei eilen und diese in das aufgehäufte Stroh am Tokhul des Paschas werfen. Im Nu hat das Feuer alle Teile des Strohgebäudes ergriffen, ein Flammenmeer rötet den Himmel. Jetzt hört man die Kriegstrommel auch in Metämmej, man hört sie in jedem der benachbarten Dörfer; ihr Klang erschallt von Ort zu Ort und verbreitete sich durch die ganze Provinz. Es ist, als ob die Streiter des geknechteten Volkes der Erde entkeimten. Was Waffen tragen kann, trägt sie; Weiber stehen, ihr Geschlecht vergessend, in den Reihen der Männer, man sieht sie, Asche und Sand in den fettgetränkten Haaren, mit entblößtem Busen und nur um die Lenden geschürzt, die Feinde verfolgen; Kinder und Greise fechten mit der Kraft der Männer. An der brennenden Hütte, welche den Pascha und fünfzig seiner Offiziere einschließt, beginnt der Vernichtungskampf. Wer herausflieht, wird niedergestochen; die Bleibenden frisst das Feuer, keiner entkommt**. Schendi und Metämme sind in einer Nacht von den Feinden befreit. An den übrig gebliebenen Mauern des festen Schlosses zu Metämme bezeugen noch heute dunkle Blutflecke die Begebenheiten jener Tage.
Nur wenige von den Soldaten Ismaël-Paschas entkamen auf ihren Schiffen und brachten dem in Kordofan weilenden Mohammed-Beï el Defterdar4 die grauenvolle Nachricht. Dieser, wegen seiner Grausamkeiten »el Djelahd«, der Henker, genannt, eilte mit der ganzen Macht seines Heeres nach Schendi und schwur, die Mannen seines Oberbefehlshabers und Verwandten blutig zu rächen. Obgleich die Nubier sich mit aller Macht rüsteten, waren sie doch nicht im Stande, den wohlgeübten Truppen Mohammed-Beïs zu widerstehen. Sie wurden wieder geschlagen. Niemand kennt die Zahl der Menschen, welche jener Tyrann seiner Rache opferte; sie soll die Hälfte der damaligen Bewohnerzahl weit überstiegen haben. Mohammed-Beï vernichtete die Blüte der streitbaren Mannschaft Nubiens und mordete die Greise, Frauen und Kinder des unglücklichen Volkes. Die Greueltaten, welche er ausübte, sind nicht zu beschreiben und machten auf das Volk einen fürchterlichen Eindruck. Ich habe das hier Mitgeteilte aus dem Mund eines Augenzeugen vernommen. Der Nubier Tomboldo, einer meiner nachherigen Diener, war in der Periode jener Schreckenstage noch ein kleiner Knabe; er war, wie er sagte, »im Blut seiner Landsleute groß geworden«. Als er mannbar wurde, sprossen ihm statt des kohlschwarzen Haares der Nubier graue Haare um Mund und Kinn; sein Haupthaar ergraute noch vor seinem zwanzigsten Jahr »wegen des vielen Blutes, welches vor seinen Augen vergossen worden war«.
Nach dem letzten, lange dauernden Blutbad war die Unterjochung der Nubier beendet. Das früher freie und stolze Volk der Scheikïe hörte auf, ein Volk zu sein. Die Häuser der Getöteten verfielen, Schendi und Metämme verödeten, die Felder blieben unbebaut, der Sand der Wüste bedeckte das frühere Kulturland. Dreifach schwerer lastete das Joch, welches die Nubier abzuschütteln versucht hatten, auf ihnen; es lastet auch heute noch. Erst nach Jahren entstand ein in der Knechtschaft aufgewachsenes Geschlecht, das sich geduldig dem Beherrscher seines Landes unterwirft. Es ist knechtischer geworden als seine kampflustigen Vorfahren, aber nicht besser als diese*.
Nachdem sich Mohammed-Beï am Blut seiner gemordeten Schlachtopfer genugsam gesättigt hatte, drang er unaufhaltsam dem Süden zu. Die das Land durchreisenden Sklavenhändler brachten vom oberen Lauf des Blauen Flusses Goldkörner und Goldringe, vom Bahr el abi-adt vorzügliches Elfenbein in großer Menge mit sich. Sie erzählten, dass die Sudanesinnen schwere Goldringe in der Nase trügen, dass der König der Fungi zu Sennar, der Hauptstadt seines Reiches, eine Serieba von Elefantenzähnen um seinen Strohpalast gezogen habe, wie man sich dasselbe noch heutzutage vom Sultan Darfurs erzählt. Die Herden der Kamele und Rinder, welche bisher nur von dem König der Wildnis, dem Löwen, belästigt, in den tropischen Wäldern an den Ufern der beiden Ströme weideten, hielten sie für unzählbar. Diese teilweise wahren Erzählungen ermunterten den habsüchtigen Tyrannen zu weiterem Vordringen. Er entthronte den König von Halfaï und besiegte den König der Fungi. Die Provinz Kordofan war dem milden Szepter Darfurs bereits entrissen worden. Dort stand noch ein ziemlich starkes Heer, um das besiegte Volk im Zaum zu halten; der Beï konnte frei agieren.
Die Königreiche Halfaï und Sennar waren bald unterjocht und noch schneller ausgeplündert. Weiter im Süden winkte die Goldernte. Man erreichte Roseeres und erfuhr, dass das Gold noch weiter südlich, in Khassahn, gegraben werde. Aber es war jetzt nicht ratsam, auch bis dahin vorzudringen. Die Truppen waren schon zu weit von Ägypten entfernt, und man musste ihnen erst eine Station errichten, von welcher aus man weitere Feldzüge unternehmen konnte. Die Wahl derselben war äußerst glücklich.
Da, wo der muntere Gebirgsstrom, der »Bahr el asrakh«*, seine raschen Fluten mit den langsam dahinschleichenden, trüben Wässern des Weißen Stroms vermischt, lag ein kleines Dorf: Khartum5. Aus ihm sollte die Hauptstadt der »Königreiche des Sudan« – so nennen die arabischen Gelehrten noch heute jenes Land – hervorgehen. Im Jahre 1823 erbaute man die ersten Tokhahl für die Soldaten ein wenig oberhalb des Dorfes und wegen des guten Trinkwassers aus dem Blauen Fluss dicht an diesem Strom.
Von hier aus wurden nun in späteren Jahren mehrere Feldzüge und viele Sklavenjagden unternommen. Das zwischen dem Roten Meer und dem Blauen Fluss, der Nordgrenze Abessiniens und dem Atbara gelegene Belled Tahka wurde unterjocht; man eroberte die Länder des oberen Blauen Flusses: Roseires, Fassokl und Khassahn, ließ hier aber die früheren Herrscher noch einige Zeit lang nominell in ihrem Besitztum und erlaubte ihnen, ihren Rang und Titel fortzuführen, freilich ebenfalls nur dem Namen nach. Bis jetzt haben diese Länder den Eroberern noch keineswegs große Vorteile gebracht.
El Charthum, gemäß der arabischen Aussprache, liegt dicht am Blauen Fluss und nur hier und da von ihm durch Gärten getrennt. Der Blaue Fluss oder »Bahr el asrakh« vereinigt sich eine Viertelmeile unterhalb der Stadt bei Rahs el Chartum (dem Vorgebirge von Chartum) mit dem »Bahr el abiadt« oder Weißen Fluss und bildet mit ihm den »Bahr el Nihl« oder Nilstrom, welcher von nun an auf seinem fast dreihundert deutsche Meilen langen Bogenlauf nur noch die Fluten des Atbara bei Berber el Mucheïref aufnimmt.
Bevor man zur Stadt gelangt, muss man eine von Aas und anderem Unrat stinkende, staubige Fläche passieren und einen zum Schutz der Häuser gegen die übertretenden Flüsse gezogenen Damm überschreiten. Man betritt auf dem erwähnten Weg die Hauptstraße Khartums, welche vom Westen nach Osten zu die Stadt durchschneidet, und kommt durch sie zunächst auf den Markt. Wenn ich eine Straße Khartums beschreibe, schildere ich auch alle übrigen. Die Straßen sind während der trockenen Jahreszeit staubig und sandig, während der Regenzeit eine ununterbrochene Reihe von Pfützen und Kothaufen. Der in ihnen zu jeder Jahreszeit herrschende Gestank und ihre Hitze sind über alle Begriffe zivilisierter Menschen erhaben. Fast alle Straßen führen nach dem Markt oder zu einem der beiden Amtsgebäude; sie sind selten breit und gerade, sondern meist krumm und unregelmäßig und verstricken sich oft zu einem kaum zu ergründenden Labyrinth. Freie Plätze sind in Khartum selten und haben, wo sie sich finden, gewöhnlich keinen Zweck.
Khartum zeigt in seiner heutigen Gestalt noch deutlich den Gang seiner Entstehung. Anfangs stand es jedem Baulustigen vollkommen frei, sich einen Bauplatz auszusuchen, wie er ihn wünschte. Diesen benutzte er ganz nach seinem Gutdünken. Man findet deshalb mitten in der Hauptstadt noch große Gärten und sieht nirgends die Anzeichen eines von Anfang an befolgten, regelmäßigen Bauplanes.
Die Häuser Khartums sind durchgehend einstöckig, mit plattem Dach. Jede größere Wohnung bildet ein für sich abgeschlossenes Ganzes, zumal wenn sie einem Türken, Kopten oder reichen Araber gehört. Sie enthält gewöhnlich zwei voneinander getrennte Teile: die Behausungen des männlichen und die des weiblichen Personals einer Familie oder, wie man in Ägypten sagt, den »Diwan« und den »Harem«.
Der Bau einer »Tankha« (im Plural »Tanakha«), wie die aus Erde errichteten Wohnhäuser im Sudan genannt werden, geht sehr rasch vonstatten.
Man gräbt und formt die notwendige, tonhaltige Erde so nahe als möglich an der Baustelle und lässt sie in der Sonne trocknen. Bei der immer herrschenden Hitze werden die Luftsteine bald so hart, dass sie zum Bauen verwendet werden können. Nun werden die Mauern bis zu der bestimmten Höhe fortgeführt und dann zur Bedachung vorbereitet. Das Dach ist derjenige Teil des Hauses, auf welchen die größte Sorgfalt verwendet werden muss und deswegen auch am kostspieligsten. Es ruht zuerst auf einer Unterlage von ziemlich starken Balken aus Mimosenholz, welche man, etwa anderthalb bis zwei Fuß voneinander entfernt, in die Wände einmauert. Auf diese Balken legt man querüber dünne, dicht aneinander gereihte Stäbe, von den Eingeborenen »Rassaß« genannt, welche in den tropischen Wäldern geschnitten und oft weit herbeigeschafft werden. Sie tragen doppelt übereinander gebreitete, sorgfältig geflochtene Matten aus Palmenblättern. Jetzt erst folgt die eigentliche, wasserdichte Bedachung: eine mehrere Zoll dicke, festgestampfte, möglichst geglättete Lehmschicht. Nach jedem Gewitterregen sieht man die Einwohner Khartums beschäftigt, die Dächer ihrer Wohnungen wieder auszubessern; oft kommt es sogar vor, dass sich die Abzugskanäle verstopften. Dann bildet sich auf dem Dach eine Wasserlache und erweicht dasselbe so, dass das Wasser nach dem Innern einen Abzug findet und die Räumlichkeiten der Wohnung überschwemmt. Zuweilen hat dies auch den Einsturz des ganzen Gebäudes zur Folge. In Khartum sind schon viele Menschen von dem während eines Gewitters zusammenstürzenden Dach erschlagen worden. Wir waren mehrere Male genötigt, unsere Effekten vor dem in das Zimmer herabstürzenden Regen in Kisten zu bergen und wurden nicht selten aus einem Zimmer ins andere getrieben.
Das Innere der Häuser gleicht ihrem Äußeren. Der Fußboden besteht aus gestampfter Erde, ebenso der um anderthalb Fuß über denselben erhöhte »Diwan«*, auf welchen man später Matten oder Sitzpolster legt. Nur selten haben die vier nackten, etwas geglätteten Lehmwände eine besondere Verschönerung aufzuweisen, nur in wenigen Häusern sind sie außer der Rindermistkruste auch noch mit Weißkalk getüncht worden. Die Fenster sind Mauerlöcher, vor denen man weite oder enge Gitter befestigt hat, die Türen ähneln ihnen und können nur in manchen Gebäuden geschlossen werden. Man findet im ganzen Haus weder Schloss und Riegel, noch Bänder und anderes Eisenwerk. Selbst die in Ägypten gebräuchlichen Holzschlösser sind selten. Alle Zimmer gleichen eher Viehställen als menschlichen Wohnungen.
Am schlimmsten sind in Khartum, was die Wohnung anbelangt, die Neuangekommenen daran. Wenn ein Fremder seine erste Wohnung mietet, bekommt er regelmäßig das schlechteste Haus, weil die besseren Gebäude schon an länger Ansässige verdingt sind. Hier muss er sich nun so gut als möglich selbst einrichten, denn der Haus...