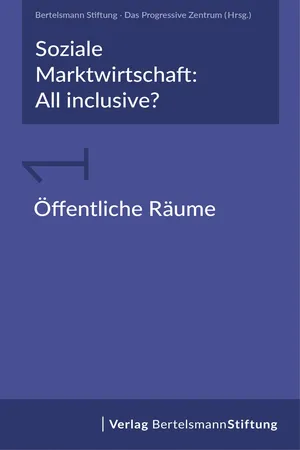![]()
AUF DIE ÖFFENTLICHEN INFRASTRUKTUREN KOMMT ES AN!
WARUM GERECHTIGKEITSORIENTIERTE POLITIK AUF EINE STRATEGIE DER ÖFFENTLICHEN RÄUME UND NETZE SETZEN MUSS
Peter Siller
Es wird höchste Zeit, den politischen Streit für mehr Gerechtigkeit in der Bundesrepublik mit einer anderen Philosophie, einer anderen Strategie und anderen Schlüsselprojekten zu versehen, als wir sie in den letzten Jahrzehnten vorgeführt bekommen haben. Quer durch die bundespolitischen Parteien und Akteure, die sich Gerechtigkeit auf die Fahnen schreiben, erleben wir eine ritualisierte Fokussierung auf die Höhe der Steuersätze und die Höhe und Länge von Sozialtransferleistungen, die zu der entscheidenden Frage gar nicht mehr vordringt, wie sich gesellschaftliche Teilhabe überhaupt herstellt: nämlich wesentlich durch inklusive Infrastrukturen im Sinne öffentlicher Räume und Netze.
Die Erneuerung und Stärkung der öffentlichen Räume und Netze sind der Stoff für eine überzeugende Gerechtigkeitserzählung, die sich an ihrer tatsächlichen Wirksamkeit für mehr Teilhabe der Ausgeschlossenen, Prekären und Verunsicherten messen lassen kann. Die Schauplätze dieser Erzählung sind vielfach die kommunalen Räume und Netze vor Ort – und führen deshalb zwangsläufig zu einer neuen Verantwortung des Bundes für die Unterstützung der kommunalen Infrastrukturen. Die steuerpolitische Frage auf der Einnahmeseite ist dadurch alles andere als obsolet, aber sie ist nicht Selbstzweck, sondern hat auf der Ausgabenseite einen triftigen und transparenten Grund. Auch die Frage der Sozialtransfers wird dadurch nicht per se falsch, denn auch in diesem Bereich besteht immer wieder Ände-rungs- und Anpassungsbedarf. Die Frage nach der Einkommensverteilung bleibt zudem aus (keynesianischen) Gründen mit Blick auf das Ausgabeverhalten privater Haushalte und die dadurch erzeugte wirtschaftliche Dynamik aktuell. Doch der strategische wie der kommunikative Fokus verschiebt sich entlang dieses Ansatzes deutlich.
Diejenige politische Kraft, die sich eine solche Strategie der Teilhabe durch öffentliche Infrastrukturen als Erste aneignen würde, sichtbar und konkret, könnte nicht nur einen radikalen – nämlich wirksamen – Ansatz vorweisen, wäre nicht nur eine für viele plausible Erzählung vom solidarischen Zusammenleben – sie hätte auch ein echtes Alleinstellungsmerkmal in einem Diskurs vorzuweisen, der sich im Wesentlichen darin erschöpft, ob man für höhere Steuern/Sozialtransfers ist oder aus wirtschaftlichen Gründen dagegen.
Die politische Bedeutung öffentlicher Infrastrukturen entspricht der lebensweltlichen Erfahrung vieler Menschen mit Teilhabe- bzw. Ausschlusserfahrungen. Eine entsprechende Strategie beruht gleichzeitig auf Annahmen normativer und empirischer, grundsätzlicher und operativer Art, deren Offenlegung überhaupt erst deutlich macht, wo die entscheidenden Unterschiede zum gerechtigkeitsdiskursiven Status quo liegen. Fangen wir also nochmals von vorne an und gehen die wichtigsten Elemente einer solchen Strategie durch.
Fragen wir zunächst noch einmal, welche Anforderungen ein sinnvoll verstandener Begriff der Gerechtigkeit an politisches Handeln stellt. Dabei geht es zunächst darum zu zeigen, welche unterschiedlichen Grundperspektiven sich hinter diesem noch weitgehend unbestimmten Begriff verbergen (1.). Sodann wird gezeigt, dass Gerechtigkeit nur dann zum normativen Leitbegriff taugt, wenn er auf der Sequenz von Gleichheit und Freiheit aufbaut, also auf dem regulativen Ideal gleicher Freiheitmöglichkeiten beruht (2.). Auf dieser Grundlage erfolgt eine Bestimmung von drei Zentralfiguren im Gerechtigkeitsdiskurs: öffentlichen Gütern, Teilhabegerechtigkeit und realen Möglichkeiten ( 3.). Schließlich erfolgen eine Analyse und eine empirische Beschreibung des sozialen Auseinanderdriftens der Gesellschaft als Teilhabeschere (4.).
Auf der Suche nach einer effektiven Strategie der Stärkung tatsächlicher Teilhabe, also eines realen Zugewinns an allgemeinen Selbstbestimmungsmöglichkeiten, führt der Weg rasch von der bloßen Definition öffentlicher Güter (im Sinne grundlegender Güter eines selbstbestimmten Lebens) zur Frage nach deren Produktionsbedingungen (5.). Das setzt voraus, die Begriffe »Infrastruktur« wie auch »Institution« schärfer zu stellen, die hier bei unterschiedlichen Akzentuierungen in ihrem Kerngehalt synonym verwendet werden (6.). Ebenso notwendig ist eine neue Befassung mit dem Begriff »Öffentlichkeit« – der gleich drei entscheidende Dimensionen für das Gelingen der vorgeschlagenen Strategie aufruft: Gewährleistung, Zugänglichkeit und Begegnung (7.). Auf der Grundlage dieser Überlegungen lässt sich klarer sagen, was die vier Kernanforderungen an das Gelingen öffentlicher Infrastrukturen bzw. Institutionen sind: die Verbindung von Qualität und Zugänglichkeit als Kernsequenz wie auch die Möglichkeit zur Mitgestaltung und zu einer effektiven und auch effizienten Binnenorganisation (8.).
Die hier vorgeschlagene Strategie öffentlicher Teilhabe braucht Erneuerung und finanzielle Stärkung. Sie lässt sich nicht auf eine Strategie der monetären Stärkung öffentlicher Institutionen und Infrastrukturen reduzieren, aber auch nicht auf eine Erneuerung ohne finanzielle Stärkung. Hinsichtlich der Ausgabenfinanzierung und -priorisierung ist es notwendig, sich nochmals mit dem Begriff und der Praxis der öffentlichen Investitionen zu befassen, der mit Blick auf den Teilhabezweck nicht nur zu unscharf gebraucht wird, sondern sowohl in einer Hinsicht zu verkürzt als auch in anderer Hinsicht zu dominant (9.).
Spätestens an dieser Stelle gilt es, sich mit der Frage der ökonomischen Wertschöpfung zu befassen. Eine Strategie öffentlicher Teilhabe ohne das Gelingen der ökonomischen Transformation, ohne eine kompetente Politik der Ordnung, Anreizsetzung und Unterstützung kann nicht gelingen (10.). Auf dieser Grundlage lässt sich sodann genauer beschreiben, wie die finanzpolitischen Konturen der vorgeschlagenen Strategie auf Einnahmen- und Ausgabenseite aussehen (11.). Der Ansatz klarer und priorisierter Ausgaben kulminiert dabei in dem strategischen, praktisch sinnvollen und zugleich symbolträchtigen Vorschlag, öffentliche Mehreinnahmen in einem Verhältnis von 2:1 in öffentlichen Institutionen und Infrastrukturen einzusetzen (12.).
Die diskursive und tatsächliche Blockade einer Politik der öffentlichen Infrastrukturen hat dabei nicht nur mit den eingeschliffenen Parteidiskursen zu tun. Dahinter liegen tiefgreifende gesellschaftliche Vorbehalte und Widerstände, mit denen sich Politik auseinandersetzen muss (13.). Umso mehr kommt es auf der Grundlage dieser Analyse darauf an, die Teilhabegewinne deutlich zu machen, die mit der Stärkung und Erneuerung der öffentlichen Infrastrukturen verbunden sind (14.). Erst eine bewusste Betrachtung der Ängste und Chancen ermöglicht es auch, eine Strategie zu beschreiben, die sukzessiv Vertrauen in den einzuschlagenden Weg schafft (15.). Am Ende ist nicht weniger gefragt als eine neue politische Erzählung der gesellschaftlichen Teilhabe, des gesellschaftlichen Zusammenlebens in Räumen und Netzen, durch die sich ein Leben in Freiheit überhaupt erst eröffnet (16.). Gefragt ist nicht weniger als die Rückgewinnung einer sozialen Fortschrittserzählung auf der Höhe der Zeit. Eine Erzählung, die von der begründeten Hoffnung und der tatsächlichen Erfahrung getragen ist, dass wir es besser machen können, dass wir in Freiheit gesellschaftlich neu zusammenfinden können.
I. Orientierung und Lage: Was braucht Gerechtigkeit?
1. Vermessung der Landschaft: Eine Vielzahl von Gerechtigkeitsbegriffen
Eine politische Strategie, die sich auf Gerechtigkeit beruft, kommt nicht umhin, über die Annahmen ihres Gerechtigkeitsbegriffs Rechenschaft abzulegen. Die Bezugnahme auf diesen Begriff ist im linken Spektrum öfter anzutreffen als anderswo. Dennoch handelt es sich bei Gerechtigkeit um einen oft unbestimmten Begriff, der sehr vieles heißen oder behaupten kann. Im politischen Sprachgebrauch ist er in vielen Fällen mehr rhetorisches Mittel als substanzieller Maßstab, an dem sich politisches Handeln messen ließe. Und so wird der Begriff mitunter je nach politischer Agenda selbst in der gleichen (Sonntags-)Rede mit sehr unterschiedlichen impliziten Bedeutungen eingesetzt.
Ein Blick in die politische Philosophie und Theorie zeigt, dass es lange Traditionslinien des Nachdenkens über den Maßstab der Gerechtigkeit gibt, die zu einer Vielzahl unterschiedlicher Antworten kommen, was Gerechtigkeit im Kern heißen soll. Das ist, neben einer subkutanen Mischung von Gerechtigkeitsempfinden und Eigeninteressen, ein weiterer Grund für die empirische Beschreibung vieler unterschiedlicher Gerechtigkeitsauffassungen. Wahrscheinlich ist vielen Politikerinnen und Politikern gar nicht klar, welche Vielfalt an Bedeutungen das Allerweltswort »Gerechtigkeit« haben kann.
Gerechtigkeitstheorien im Schnelldurchlauf: Es ist ein großer Unterschied, ob man Gerechtigkeit für einen relativen Maßstab hält oder für einen absoluten, also ob Gerechtigkeit einen (relativen) Gleichheitsmaßstab zwischen Subjekten darstellt oder ob er für jedes Subjekt einen (absoluten) Standard einfordert. Innerhalb der absoluten Gerechtigkeitsansätze ist dann weiterhin offen, wodurch sich der Standard bestimmt – Grundbedürfnisse? Grundfähigkeiten? Gutes Leben? etc. Innerhalb der relativen Gerechtigkeitsansätze ist wiederum zu klären, worauf sich der Gleichheitsmaßstab eigentlich bezieht – Ressourcen, Chancen, Möglichkeiten, Freiheitskonstitution, Freiheitsverwirklichung etc.
An diese Grundfragen schließen sich weitere wichtige Fragen an: Wie werden in dem jeweiligen Grundsatz besondere Handicaps und besondere Leistungen berücksichtigt? Was ist, wenn entgegen dem – wie auch immer interpretierten – Gleichheitsgrundsatz eine Ungleichverteilung selbst die Schwächsten einer Gesellschaft besserstellt, als sie bei einer Gleichverteilung stehen würden? Und weiter: In welchem räumlichen und zeitlichen Radius greifen Gerechtigkeitsansprüche? Wer sind die Subjekte von Gerechtigkeitsansprüchen? Und was sind eigentlich die Güter, auf die man einen Gerechtigkeitsanspruch erheben kann? Bereits aus diesen wenigen Sätzen deutet sich eine Vielzahl von (Kombinations-)Möglichkeiten an.
Mit Blick auf die politische Praxis ist weiterhin zu beachten, dass der Schritt von einem moralischen Grundsatz hin zu institutionellen, rechtsförmigen Regeln und Prinzipien einen ganz eigenen Schritt bedeutet. Als moralische Subjekte können wir im Mikrokosmos unserer Gemeinschaften – Beziehungen, Familien, Freundschaften, Nachbarschaften etc. – Gerechtigkeitsentscheidungen oft ganz anders treffen als in den übergeordneten politischen Räumen der Demokratie und des Rechts. Ein einfaches Beispiel: Wenn wir bei einer Geburtstagsfeier in der Familie zusammensitzen, können wir sehr individuell gemeinsam entscheiden, wie wir den Kuchen backen und verteilen (Geschmacksvorlieben, Hunger, Diabetes etc.). Moralische Überzeugungen werden vielleicht eher geteilt, es ist viel Platz für Diskussionen und am Ende gilt oft das Konsensprinzip.
In der gesetzgebenden Demokratie, die Menschen gleich behandeln will und in der deshalb die Gesetze für alle gelten, sind diese moralischen Gerechtigkeitsgrundsätze nicht aufgehoben, aber sie haben sich in einem völlig anderen Kontext zu bewähren und können deshalb zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Wir haben in den Räumen von Demokratie und Rechtsstaat viele Informationen nicht, haben starke Freiheitsrechte in ihrer abwehrrechtlichen Dimension und wissen entsprechend von zahlreichen individuellen Handicaps ebenso wenig wie von zahlreichen individuellen Wünschen und Träumen. Im politisch-institutionellen Raum ist mit Blick auf die Vielzahl von Interessen und Standpunkten ein anderes Maß an Repräsentation gefragt, ist in Unkenntnis vieler Informationen aus dem Nahbereich ein anderes Maß an Typisierung und Standardisierung gefragt, gilt in vielen Fällen das Mehrheitsprinzip – nicht verstanden als Kampf der Interessen, sondern als (zeitlich limitierte) Auseinandersetzung zwischen unterschiedlichen Vorstellungen von Gerechtigkeit und Allgemeinwohl.
2. Licht ins Trübe: Gerechtigkeit als regulatives Ideal gleicher Freiheit
Zwei elementare Grundannahmen der hier vorgeschlagenen Strategie liegen darin, dass Gerechtigkeit eine relative Kategorie der Beziehung zwischen Menschen ist und sie im Kern auf die Gleichverteilung von Freiheitsmöglichkeiten zielt. Hinzu kommen notwendige Aspekte der realen Leistung sowie der gerechtigkeitsbegründeten Ausnahmen vom Gleichheitsgrundsatz, wo etwa Wettbewerb tatsächlich dem Wohle aller dient, auf die hier nicht näher eingegangen werden kann.
Gerechtigkeit erschöpft sich erstens nicht in absoluten Standards unabhängig davon, wie es den anderen geht. Gerechtigkeit beinhaltet eine soziale Relation, die davon ausgeht, dass sich aus unserer Gleichheit als Freie auch die Anforderung ableitet, dass unsere Freiheitsansprüche, die Verwirklichung unserer Bedürfnisse, Wünsche und Träume, gleichermaßen Unterstützung finden. Diese relative Gerechtigkeitsanforderung gegen unverdiente Privilegien und die Lotterie der sozialen Herkunft ist auch deshalb eine entscheidende Annahme, weil erst durch sie deutlich wird, warum Gesellschaften auch dann ein fundamentales Gerechtigkeitsproblem haben, wenn sich zwar das absolute Niveau am unteren Ende der Skala verbessert, aber die relative Schere dramatisch auseinandergeht.
Davon zu unterscheiden ist die Fassung des Armutsbegriffs – ein Zentralbegriff der politischen Gerechtigkeitsdebatten. Tatsächlich zielt der Armutsbegriff noch nicht auf eine Figur der Gleichheit, sondern markiert ein Minimum, das auf keinen Fall unterschritten werden darf. Gleichzeitig wird aber selbst hier schnell deutlich, dass auch ein sinnvoller Armutsbegriff ohne relatives Element nicht auskommt. Ein Ausschluss von zentralen Gütern einer bestimmten gesellschaftlichen Praxis kann zu einer tiefgreifenden Leiderfahrung führen, die sich in einer Gesellschaft ohne diese Praxis so nicht einstellen würde. In einer Klasse beispielsweise, in der fast alle Schülerinnen und Schüler die Klassenfahrt bezahlen können, ist es eine gravierende Armutserfahrung, nicht dabei zu sein. Das gilt auch dann, wenn früher das materielle Niveau der Klassenmitglieder allgemein niedriger war und es gar keine Klassenfahrten gab.
Gerechtigkeit steht zweitens sinnvoll verstanden nicht gegen Freiheit, sondern Gerechtigkeit ist eine Antwort darauf, wie wir uns als Freie zueinander verhalten, wie sich die Freiheitssphären zueinander verhalten. Gerechtigkeit zielt auf gleiche Freiheit im Sinne eines regulativen Ideals, das sich nie vollständig verwirklichen lässt, das aber die Orientierung vorgibt, indem es mit Freiheit das zentrale Gut und mit Gleichheit den zentralen Maßstab von Gerechtigkeit beschreibt. Deshalb hat Rainer Forst recht, wenn er Gerechtigkeit als »erste Frage« beschreibt, als in diesem Sinn einzigen Grundsatz (Forst 2009).
Dieses Verständnis von Gerechtigkeit als gleiche Freiheit ist einfach – und zugleich in vielerlei Hinsicht vielschichtig und anspruchsvoll. Nicht nur deshalb, weil die schwierigen Fragen der Leistungsgerechtigkeit, der allgemein vorteilhaften Ungleichheit oder der Berücksichtigung von teuren Vorlieben zu berücksichtigen sind, sondern auch, weil der Großbegriff der Freiheit selbst wiederum voraussetzungsvoll ist. Freiheit hat zum einen vielfältige Konstitutionsbedingungen, die den Individuen überhaupt einen Denk- und Erfahrungshorizont unterschiedlicher Handlungsoptionen eröffnen. Freiheit hat zum anderen vielfältige Verwirklichungsbedingungen, an denen sich dann entscheidet, ob eine Handlungsoption mit Blick auf Fähigkeiten und Ressourcen tatsächlich ergriffen werden kann.
Beide Freiheitsdimensionen – Autonomisierung und Autonomiegebrauch – verweisen auf die Notwendigkeit eines unverkürzten Gerechtigkeitsbegriffs, der weder Gerechtigkeit auf Autonomisierung noch auf Autonomiegebrauch reduziert. Und sie verweisen auf ein potenzielles Spannungsverhältnis zwischen beiden Dimensionen, das spätestens im Erwachsenenalter grundsätzlich durch die Individuen selbst zu beantworten ist. In jedem Fall schließt Gerechtigkeit nach diesem Verständnis einen politischen Paternalismus aus, der für die Menschen beantwortet, worin ein »gutes Leben« besteht und was ihnen deshalb zusteht. Politische Gerechtigkeitsentscheidungen sind hier nicht advokatorisch gegenüber Kindern zu treffen, sondern mit und gegenüber mündigen Bürgerinnen und Bürgern, die jeweils ganz eigene Vorstellungen von einem gelungenen Leben haben.
Eine emanzipatorische Idee von Teilhabe beinhaltet auch: Wer hinfällt, muss immer wieder aufstehen können. Das gilt für diejenigen, die durch Vorprägungen, Schicksalsschläge oder auch eigene Unzulänglichkeiten abgeglitten und in Sackgassen geraten sind. Es gilt aber auch für Menschen, die ungerade Lebensläufe und biografische Brüche haben, weil sie vielleicht etwas Unkonventionelles ausprobieren wollen. Das Ziel ist im Kern die Überwindung sozialer Blockaden – und damit der Zugang zu einer verbesserten sozioökonomischen Lage. Das Ziel ist hingegen nicht die Anpassung an bestimmte kulturelle Gewohnheiten und Präferenzen, die in der Spannbreite der real existierenden Mittelschicht vorherrschen. Dadurch verbietet sich ein auf Distinktion angelegter, kulturalistischer Mittelschichtsbegriff.
Gerechtigkeit als gleiche Freiheit maßt sich deshalb auch nicht das Versprechen gleichen Glücks an – entgegen dem momentanen Trend der Psychologisierung von Politik. Sie verspricht auch nicht gleichen Erfolg bei der Realisierung eigener Lebenspläne. Was sie ins Auge nimmt, ist vielmehr di...