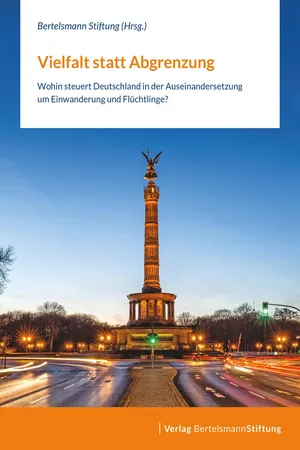![]()
Mit Zumutungen umgehen – Zusammenhalt wahren
Kai Unzicker (Mitarbeit: Gesine Bonnet)
Die Flüchtlingskrise sei »ein Geschenk« für seine Partei, sagte der Vize-Bundessprecher der Alternative für Deutschland (AfD), Alexander Gauland, im Dezember 2015 (»Umfragehoch: AfD-Vize Gauland sieht Flüchtlingskrise als Geschenk« 2015). Tatsächlich spült diese Krise fremden- und vor allem islamfeindliche Einstellungen an die Oberfläche und liefert vermeintlich gute Gründe, selbst radikale Positionen zu vertreten. Doch die Menschenfeindlichkeit und die Ängste, die dahinterstehen, wurzeln tiefer und sind längst belegt (Heitmeyer 2002 bis 2011; van de Wetering in diesem Band). Gleiches gilt für die Ablehnung des Islams, die allerdings in den letzten Jahren in Deutschland zugenommen hat (El-Menouar in diesem Band; Hafez und Schmidt 2015).
Auch die Debatten um eine »deutsche Leitkultur« brechen seit mehr als 15 Jahren immer wieder auf und illustrieren ein schon länger währendes und teils wachsendes Unbehagen (vgl. die Beiträge von Achour, Messerschmidt und Kösemen in diesem Band). Nicht zuletzt sind die zunehmende Entfremdung zwischen Wahlvolk und Gewählten (vgl. Vorländer in diesem Band) sowie Umbrüche in der Mediengesellschaft (vgl. Haller in diesem Band) Krisensymptome, die über die aktuelle Herausforderung der Flüchtlingseinwanderung hinausgehen.
Vieles spricht daher dafür, dass der tiefgreifende gesellschaftliche Wandel der vergangenen Jahrzehnte den rechtspopulistischen Agitatoren Nahrung gibt, weil er von Krisen begleitet ist und Orientierungslosigkeit ebenso wie Zukunftsängste hervorruft. Rasanter technologischer Wandel und eine zunehmend globalisierte Wirtschaft treiben diese gesellschaftlichen Veränderungen an und gehen mit wachsender sozialer Ungleichheit hierzulande einher. Dazu kommt die Emanzipationsdynamik, die freiheitlichen Demokratien selbst zu eigen ist. Durch sie sind vor allem konservative Werte in die Defensive geraten. Das machen ein vielfältigeres Familienbild und die Auflösung der alten Geschlechterordnung ebenso deutlich wie die Neuordnung Deutschlands als Einwanderungsland, zu der auch das reformierte Staatsbürgerschaftsrecht gehört. Damit sind die Zumutungen umrissen, die der heutige Rechtspopulismus auf die Agenda setzt.
Die wachsende Angst vor Veränderungen ist messbar. So fragt das Institut für Demoskopie Allensbach jährlich nach den Hoffnungen und Befürchtungen, mit denen die Menschen in das neue Jahr gehen. Die Ergebnisse belegen, wie tief viele Bürgerinnen und Bürger angesichts der Flüchtlingskrise verunsichert sind. Diese Verunsicherung ist grundlegend und geht über eine bloße Reaktion auf das Tagesgeschehen hinaus (Petersen 2016). Das zeigt in der Umfrage die Zustimmung zu einer der Antwortmöglichkeiten darauf, was konkret Sorge bereitet: »Die allgemeine Unsicherheit, wie es weitergeht«, sagten 29 Prozent der Befragten im Januar 2014 – im Januar 2016 sind es fast doppelt so viele, nämlich 53 Prozent. Besonders ausgeprägt ist das Gefühl der Orientierungslosigkeit unter den Anhängern der AfD, von denen 84 Prozent so empfinden. Bei denen, die der CDU/CSU und SPD nahestehen, sind es lediglich 55 beziehungsweise 51 Prozent. Das legt die Vermutung nahe, dass viele AfD-Anhänger weniger von einer überzeugenden Ideologie oder Haltung getrieben sind als von ihrem Gefühl der Entwurzelung und einer tiefgreifenden Orientierungslosigkeit (ebd.).
Diese Einschätzung macht die Sache nicht besser. Aber sie wirkt sich aus auf den Umgang mit dem Problem Rechtspopulismus und betrifft im Kern die Frage nach dem gesellschaftlichen Zusammenhalt hierzulande. Die Erfolge der AfD bei den Landtagswahlen, die fast schon spielerische Leichtigkeit, mit der es der noch mäßig organisierten Partei gelang, gerade auch Nichtwähler zu mobilisieren, bilden jedenfalls eine Zäsur in der Geschichte der Berliner Republik. Rechtspopulismus ist kein gesellschaftliches Randphänomen mehr: Er ist ganz offenbar in der Mitte der Gesellschaft angekommen.
Zwei inkompatible Konzepte von Zusammenhalt
Wenn das Vertrauen zwischen den Bürgerinnen und Bürgern erodiert und die Verbundenheit mit dem Gemeinwesen abnimmt, wirkt sich das negativ auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt aus. Im Mai 2014 lautete die Zustandsbeschreibung des »Radar gesellschaftlicher Zusammenhalt« noch, dass der Gemeinsinn in Deutschland wächst, wenn auch in den östlichen Bundesländern schwächer als im Westen (Bertelsmann Stiftung 2014: 30 ff.). Schon damals allerdings stellten die Forscher fest, dass die Akzeptanz von kultureller Vielfalt nachgelassen hat. Im Widerspruch zu den Bedrohungsgefühlen, die aus dieser fehlenden Akzeptanz sprechen, steht ein anderes Ergebnis des Radars: dass der gesellschaftliche Zusammenhalt dort besonders hoch ist, wo viele Ausländer wohnen.
Offenbar kommt es entscheidend darauf an, wie Zusammenhalt definiert wird. Denn unübersehbar ist, dass die Kundgebungen von Pegida und AfD, mit ihren Sprechchören und wehenden Deutschlandfahnen, ebenfalls ein Bedürfnis nach Zusammenhalt befriedigen wollen. Ihr Angebot jedoch ist das einer Gemeinschaft, die sich durch scharfe Abgrenzung definiert, »Heimatliebe« zelebriert und auf der Fiktion eines homogenen Volkes mit fest gefügter »nationaler Identität« beruht. Besonders anschaulich machen das die Demonstrationen der AfD mit dem Thüringer Fraktionsvorsitzenden Björn Höcke auf dem Erfurter Domplatz, von denen man sich auf Youtube ein Bild machen kann (vgl. AfD Live 2016; Bernhard 2016).
Die Bertelsmann Stiftung hat in ihrer Definition von gesellschaftlichem Zusammenhalt bewusst das Leitbild eines inklusiven gesellschaftlichen Miteinanders zugrunde gelegt, das Heterogenität »nicht schon definitionsgemäß als Ausdruck geringen Zusammenhalts deutet«. Daraus resultiert die Entscheidung, nicht »Wertekonsens oder ethnische Homogenität der Bevölkerung« als Aspekt in die Definition aufzunehmen, aber den »Umgang mit Wertepluralität und Diversität« (Bertelsmann Stiftung 2014: 17). So ist gewährleistet, dass nicht von einer guten Qualität des gemeinschaftlichen Miteinanders gesprochen werden kann, wenn es auf Kosten von Minderheiten geht.
Unbenommen ist, dass Heterogenität eine Herausforderung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt darstellen kann. Zwar erweitert eine Vielfalt von Lebensstilen, Religionen und kulturellen Einflüssen die Handlungsmöglichkeiten und schafft neue Wahrnehmungsperspektiven. Aber sie macht das Leben auch unübersichtlicher und weckt Fremdheitserfahrungen – vor allem bei denjenigen, die in ihrem Alltag wenig Gelegenheit haben, den Umgang mit Heterogenität zu üben und positive Erfahrungen damit zu sammeln. Traditionelle Einwanderungsländer wie Kanada und die USA machen allerdings vor, dass dieser Umgang lernbar ist und einem starken Zusammenhalt nicht im Wege steht (vgl. Bertelsmann Stiftung 2013a).
Wenn die Zusammensetzung einer Gesellschaft sich verändert, wie es durch die Aufnahme von mehr als einer Million Flüchtlingen der Fall ist, dann wachsen die Herausforderungen und es wird notwendig, aktiv für ein gelingendes gesellschaftliches Miteinander einzutreten: Brücken zu bauen, Beziehungen zu knüpfen und den Neubürgern das Ankommen zu erleichtern, damit sie eine Verbundenheit mit dem noch fremden Land und seinen Institutionen entwickeln können. Genau das meint die Willkommenskultur, für die sich bis heute eine engagierte Zivilgesellschaft einsetzt.
Andere verschließen ihre Türen und suchen (verlorene) Vertrautheit unter Gleichgesinnten und bei gemeinschaftlich geteilten Feindbildern. »Protestparteien wie die AfD sind die Projektionsfläche einer einfacheren Welt«, argumentiert Nico Lange in einer Analyse für die Konrad-Adenauer-Stiftung (Lange 2016). Der Soziologe Hans-Georg Soeffner formuliert es so: »Sowohl nationaler und ideologischer Autoritarismus als auch der weltweit beobachtbare Fundamentalismus und die für ihn charakteristische Suche nach Heimat und fester Bindung stehen also nicht für einen Rückfall in vormoderne Gesellschaftsformen – einen Rückfall, der wegen des ökonomisch, medial und politisch verflochtenen Gefüges unserer Welt ohnehin nicht möglich wäre –, sondern sie stellen gerade wegen der forcierten Sehnsucht nach Rückkehr ein modernes Phänomen dar« (Soeffner 2016).
Wie es weitergeht: Eine skeptische und eine optimistische Perspektive
Die Flüchtlingskrise, in Wolfgang Schäubles Worten das »Rendezvous unserer Gesellschaft mit der Globalisierung«, lässt erahnen, dass diese Modernisierungsdynamik noch längst nicht an ein Ende gekommen ist. Daher ist damit zu rechnen, dass auch rechtspopulistische Gegenwelten weiterhin auf einen Teil der Bevölkerung große Anziehungskraft ausüben.
Wie wird sich also der gesellschaftliche Zusammenhalt entwickeln? Eine skeptische und eine optimistische Perspektive sind denkbar. Für Erstere kann die Einschätzung des Meinungsforschers Thomas Petersen stehen, für den Deutschland die »Merkmale einer gesättigten Demokratie« aufweist. Gerade weil sich die Gesellschaft mit der Gegenwart gut arrangiert habe, fürchte sie sich vor Veränderungen (Petersen 2016). Er nimmt an, »dass die Neigung, am Bestehenden festzuhalten, in den kommenden Jahrzehnten noch zunehmen wird«, denn sie sei »eine wahrscheinlich unausweichliche Folge der Alterung einer Gesellschaft«. Weil »Veränderung an sich bereits als Bedrohung empfunden« werde, tue sich die Bevölkerung hierzulande besonders schwer, die Herausforderung der Flüchtlingseinwanderung »mit Mut und Optimismus anzunehmen« (ebd.).
Wenn Petersens Einschätzung sich als richtig erweist, wird sie sich im Wahlverhalten spiegeln. Länder wie Polen und Ungarn machen vor, was passiert, wenn rechtskonservative Regierungen die demokratischen Institutionen aushöhlen, weil sie glauben, ein vermeintliches »Wohl des Volkes« über das Verfassungsrecht stellen zu dürfen (vgl. Grimm 2016). Um das Projekt Europa ist es ebenfalls schlecht bestellt, wenn sich der populistische Trend einer Rückkehr zum Nationalen auch in Deutschland festsetzt.
Die optimistische Perspektive setzt voraus, dass es besser gelingt als bisher, auch die Bürger anzusprechen und mitzunehmen, die sich vor Veränderungen fürchten und Flüchtlinge pauschal als Fremde ablehnen. Brücken müssten also nicht nur zu den Neuankömmlingen, sondern auch zu den Menschen in Heidenau, Freiberg und Claußnitz geschlagen werden, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu wahren. Dabei sollte klar sein, dass es etwas anderes ist, »die Sorgen der Bürger ernst zu nehmen«, als anzuerkennen, dass es Bürger gibt, die Sorgen haben. Die Überzeugungskraft, die Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft für dieses Projekt benötigen, speist sich aus einer Reihe von Tatsachen:
– Deutschland ist längst ein pluralistisches Einwanderungsland. Jeder Lösungsansatz muss darauf aufbauen, weil er sich sonst gegen Teile der Bevölkerung richtet und mit den Grundwerten unserer Demokratie unvereinbar ist.
– Deutschland zieht seine wirtschaftliche Stärke und seinen internationalen Einfluss aus offenen Grenzen. Eine Politik der Abschottung untergräbt diesen Wohlstand.
– Als zukunftsorientierte Gesellschaft ist unser Land auf einen inklusiven gesellschaftlichen Zusammenhalt angewiesen, der die Pluralität der Lebensentwürfe und Identitäten nicht nur als gegeben hinnimmt, sondern als Stärke begreift.
Was jetzt gefragt ist: Differenzen aushalten und gemeinsame Perspektiven formulieren
Ein guter gesellschaftlicher Zusammenhalt schafft Ressourcen, um Veränderungsprozesse besser zu meistern, Handlungsoptionen in die Zukunft zu entwerfen und vor allem auch konsensfähig in die Tat umzusetzen. Die Qualität des solidarischen Miteinanders beeinflusst damit nicht nur die Lebenszufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger, sie ist auch wesentlich für die Problemlösefähigkeit einer Gesellschaft (vgl. Bertelsmann Stiftung 2014: 12). Diese Fähigkeit und eine positive Zukunftsorientierung sind heute, angesichts der Herausforderung der Aufnahme von mehr als einer Million Flüchtlingen, mehr denn je gefragt. Sie sind auch notwendig, um sich mit Rechtspopulisten auseinanderzusetzen.
Anzuerkennen gilt es dafür zunächst, dass unser Land tatsächlich in jeder Hinsicht vielfältiger geworden ist. Diese neue Pluralität tritt auch darin zutage, dass das Parteienspektrum am rechten Rand gewachsen ist. In dieser Aussage steckt eine Zumutung für all jene, denen eine offene, vielfältige Gesellschaft am Herzen liegt – richten sich die Rechtspopulisten doch explizit gegen dieses Gesellschaftsmodell. Das ist ihr Alleinstellungsmerkmal, darin bilden sie eine echte Alternative zu den etablierten demokratischen Parteien.
Damit gilt es umzugehen und dabei nicht aus dem Blick zu verlieren, was die Gesellschaft zusammenhält. Nachfolgend einige Orientierungspunkte, die uns dafür wichtig erscheinen.
Je vielfältiger eine Gesellschaft ist, desto mehr Toleranz ist gefordert.
In einer offenen Gesellschaft kann man nicht alles und alle mögen, sei es der Pegida-Mitgänger, das muslimische Kopftuch oder der raumgreifende SUV des Nachbarn. Es mag sogar Haltungen und Handlungsweisen geben, die den eigenen Vorstellungen von einem guten Leben grundsätzlich zuwiderlaufen. Dass dennoch vieles zu tolerieren ist, hat damit zu tun, dass Demokratie ohne Freiheit nicht zu haben ist. Das spiegelt sich in den Grundrechten, in denen die Freiheit der Person, die Glaubens-, Gewissens- und Bekenntnisfreiheit, die Meinungs-, Informations- und Pressefreiheit und die Versammlungsfreiheit festgeschrieben sind.
Die Grenzen der Toleranz bestimmt dieselbe Verfassungsordnung, die auch die Freiheitsrechte garantiert. Wie hoch die juristischen Hürden hierfür sind, illustriert das NPD-Verbotsverfahren. Tatsächlich verboten sind nur extremistische Bestrebungen, die sich gegen den Kernbestand der Verfassung – die freiheitlich-demokratische Grundordnung – richten. Hingegen gilt: »Radikale politische Auffassungen haben in unserer pluralistischen Gesellschaftsordnung ihren legitimen Platz« – auf der Website des Bundesamts für Verfassungsschutz (2016) nachzulesen.
Damit ist die Verantwortung zunächst an Zivilgesellschaft und Politik zurückgegeben. Hier, auf dem Feld der politischen und persönlichen Auseinandersetzung, hat die Toleranz ihren eigentlichen Ort. Sie ist anstrengend und geht oft an die Schmerzgrenze. Das allerdings ist schon in ihrem Wesen begründet: Toleranz ist allein in solchen Konflikten gefordert, »die sich nicht normativ lösen, sondern nur durch eine Haltung der Toleranz ›entschärfen‹ lassen« (Forst 2003: 588). Ausgehend davon, dass zu respektieren ist, dass jemand eine gänzlich andere Meinung oder Lebenseinstellung hat, wird es möglich, einen Umgang damit zu entwickeln. Eine solche »Tugend der Toleranz« (ebd.: 656), die sich mit einer Haltung des Respekts verbindet, kann einen wesentlichen Beitrag zum Zusammenhalt in heterogenen Gesellschaften leisten. Sie ist die Voraussetzung dafür, »ohne Angst verschieden sein« zu können (Adorno 2001 [1951]: 131; vgl. Messerschmidt in diesem Band).
Gerade deswegen gilt es aber auch, präzise zu benennen, was nicht mehr tolerierbar ist, weil es sich gegen die freiheitliche, tolerante Gesellschaft selbst richtet. Wer sich menschenverachtend äußert, Minderheiten ausgrenzt oder Frauen eine untergeordnete Rolle zuweist, hat schnell eine ganze Talkshow gegen sich. Das hat nichts mit Maulkorb zu tun, sondern mit der notwendigen Selbstverstä...