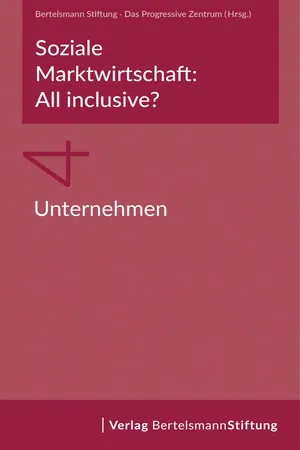
eBook - ePub
Available until 10 Dec |Learn more
Soziale Marktwirtschaft: All inclusive? Band 4: Unternehmen
- 108 pages
- English
- ePUB (mobile friendly)
- Available on iOS & Android
eBook - ePub
Available until 10 Dec |Learn more
About this book
Deutschland ist das Land der Dichter und Denker, nicht aber das Land der Gründerinnen und Gründer. Dabei lebt eine dynamische Gesellschaft von unternehmerischen Innovationen und von Wettbewerb. Für viele Unternehmen ist soziale Verantwortung nicht lästige Pflicht, sondern treibende Kraft. Welche Rahmenbedingungen brauchen sie dafür? Welchen Beitrag können Unternehmer und Unternehmen für eine inklusive Gesellschaft leisten?Die interdisziplinären Beiträge in diesem Band legen dar, welche zentrale Funktion Unternehmen für das "Soziale" in der Marktwirtschaft haben. Vom Mittelstand über Social Entrepreneurship bis hin zu Migrantenunternehmen leisten sie alle einen Beitrag zur gesellschaftlichen Teilhabe und einem inklusiven Wachstum.
Frequently asked questions
Yes, you can cancel anytime from the Subscription tab in your account settings on the Perlego website. Your subscription will stay active until the end of your current billing period. Learn how to cancel your subscription.
At the moment all of our mobile-responsive ePub books are available to download via the app. Most of our PDFs are also available to download and we're working on making the final remaining ones downloadable now. Learn more here.
Perlego offers two plans: Essential and Complete
- Essential is ideal for learners and professionals who enjoy exploring a wide range of subjects. Access the Essential Library with 800,000+ trusted titles and best-sellers across business, personal growth, and the humanities. Includes unlimited reading time and Standard Read Aloud voice.
- Complete: Perfect for advanced learners and researchers needing full, unrestricted access. Unlock 1.4M+ books across hundreds of subjects, including academic and specialized titles. The Complete Plan also includes advanced features like Premium Read Aloud and Research Assistant.
We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.
Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.
Yes! You can use the Perlego app on both iOS or Android devices to read anytime, anywhere — even offline. Perfect for commutes or when you’re on the go.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Yes, you can access Soziale Marktwirtschaft: All inclusive? Band 4: Unternehmen by in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in Politics & International Relations & Political History & Theory. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.
Information
SOZIAL WIRD DIE MARKTWIRTSCHAFT SCHON DURCH IHRE UNTERNEHMER
Das Argument
Wie kommt Verantwortung in die Wirtschaft? Linke Kritiker wie konservative Ethiker oder Finanzmarktinvestoren verbindet der Glaube, dass aus einer kapitalistischen Wirtschaft erst dann eine verantwortliche und soziale Marktwirtschaft wird, wenn der Staat sich zum wirtschaftlichen Geschehen gesellt. Entweder, um in linkem Auftrag Armut durch Umverteilung von Gewinnen am Markt zu beenden, oder, um in ordoliberaler Absicht dem Markt einen Rahmen zu geben.
Doch so einfach liegt die Sache nicht. Zwar ist diese Betrachtungsweise wirtschaftswissenschaftlich fundiert. Aber indem sie die Verantwortung von unternehmerischer Freiheit abtrennt, verkennt sie, was für viele mittelständische Akteure der real existierenden Sozialen Marktwirtschaft konstitutiv ist: eine Praxis der selbstverständlichen sozialen Verantwortung. Sie wird pointiert durch unterschiedliche Formen sozialer Verantwortung: von der Philanthropie bis zum Social Entrepreneurship. Um diese Formen in den Blick zu bekommen, muss man freilich die Brille der neoklassischen Ökonomie durch eine humanistische und pragmatische Brille ersetzen. Dabei wird deutlich: Die Soziale Marktwirtschaft ist als Teilhabewirtschaft wesentlich besser verstanden denn als profitgetriebener, staatlich erst domestizierter Wildwestwettbewerb.
Das gängige Vorurteil: Hier Gier, da Gerechtigkeit
In einer der Debatten mit Hillary Clinton kommentierte Donald Trump den Vorwurf, die wenigen vorliegenden Steuerunterlagen hätten gezeigt, dass er keine Einkommensteuer zahle, mit den Worten: »That makes me smart.« Das fand auch fast die Hälfte der US-Amerikaner, wie eine Reuter/Ipsos-Umfrage zeigte. In der Tat ist die Vorstellung, dass ein guter Geschäftsmann nach seinem eigenen Profit schaut und sich Verantwortung erst vom Staat aufzwingen lassen muss, nicht nur in der Öffentlichkeit weit verbreitet, sondern auch unter Kapitalismusexperten wie dem Investor George Soros, dem Philosophen Wolfgang Kersting oder dem Soziologen Niklas Luhmann.
»Märkte sind amoralisch«, behauptet etwa George Soros in seinem Buch über die Globalisierung (Soros 2005: 6). Die anonyme Teilnehmerin müsse sich nicht um die sozialen Konsequenzen ihrer Entscheidungen kümmern. Als Teilnehmer des Marktes sollten die Leute vielmehr ihre eigenen Selbstinteressen verfolgen – und erst als Teilnehmer des politischen Prozesses sollten sie vom Gemeinwohl geleitet sein. Die Märkte bräuchten daher ein politisches Regulativ.
Die Verantwortung für die Mitwelt, Umwelt oder Nachwelt kommt bei dieser Sichtweise erst durch ein staatliches Gesetz oder Gebot in die Wirtschaft. Ein institutionelles Rahmenwerk von Spielregeln, das die Spielzüge der Akteure bei der Verfolgung ihrer Einzelinteressen mit den grundlegenden Allgemeininteressen harmonisiert: Das ist ja eben die grundlegende Idee liberaler Ordnungspolitik, wie sie der Ordoliberalismus der Freiburger Schule um Walter Eucken und Franz Böhm vorsieht.
Es sind also die Waffen des Gesetzes, die für die Gemeinwohldienlichkeit der Wirtschaft sorgten, »nicht die appellative Bearbeitung des Gewissens der Wirtschaftssubjekte«, wie der Philosoph Wolfgang Kersting sagt. Das besondere Interesse der Ethiker gelte »den modernen Wilden, den Barbaren vom Stamm des Homo oeconomicus. Sie sollen zivilisiert werden, ihnen sollten Sitte und Anstand beigebracht werden. Aber der homo oeconomicus ist ethikresistent, nicht unbedingt als Privatmann, jedoch als Wirtschaftssubjekt. Ihm ins Gewissen zu reden, ist verlorene Liebesmüh’ und schadet überdies der Moral« (Kersting 2002).
Wirtschaftsethik wäre demnach ein völlig fruchtloses Geschäft. So spottete jedenfalls auch der Soziologe Niklas Luhmann: »Die Sache hat einen Namen: Wirtschaftsethik. Und ein Geheimnis, nämlich ihre Regeln. Aber meine Vermutung ist, dass sie zu der Sorte von Erscheinungen gehört wie auch die Staatsräson oder die englische Küche, die in der Form eines Geheimnisses auftreten, weil sie geheim halten müssen, dass sie gar nicht existieren« (Luhmann 1993: 134). Noch kürzer und vernichtender heißt es in einem Bonmot, das dem Aphoristiker Karl Kraus zugeschrieben wird: »Sie wollen Wirtschaftsethik studieren? Dann entscheiden Sie sich für das eine oder das andere« (zitiert nach Ortmanns 2016: 17).
Der Konsens dieser so erfahren und klug daherkommenden Köpfe findet Widerhall in der Politik. Der Markt gilt als schlecht: ein wildes, gieriges Monster. Aber der Staat ist gut: eine milde Mutti, ein gerechter Vater. Die ehemalige Arbeitsministerin Andrea Nahles etwa verfolgt ihre Vorstellungen einer »demokratischen Marktwirtschaft«. Der zufolge zahlen die Unternehmen nicht genug Lohn – also wird der allgemeine Mindestlohn gesetzlich festgelegt. Der Wettbewerb ist unbarmherzig – aber die rettende Rente kommt immer früher. Die Wirtschaft nutzt flexible Arbeitszeiten nur zur Lohndrückerei – deshalb muss der Staat das Normalarbeitsverhältnis stärken. Männer diskriminieren – also sorgt der Staat mit einer Quote für die Frauen.
Denselben Vorstellungen – hier Gier, da Gerechtigkeit – unterliegen auch Gesetzeswerke wie das EEG (Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien), das mit staatlichen Subventionen eigentlich unrentable Energieerzeugung beatmet. Oder Forderungen nach einer Aufweichung des europäischen Stabilitätspaktes, damit Staaten das Wirtschaftswachstum mit größeren Investitionen fördern – also gute Arbeitsplätze mit Schulden kaufen – können. Auch dass die erfolgreiche deutsche Wirtschaft einen Exportüberschuss hat, ist vielen Berliner Politikerinnen und Politikern eigentlich peinlich.
Sozial wird die Marktwirtschaft also erst dann, wenn der Staat eingreift. Als gäbe es zwei Reiche: hier die Wirtschaft als Wilder Westen des ungerechten, rücksichtslosen Wettbewerbs, dort das Paradies des Staates als Retter der Menschlichkeit. In dieser Arbeitsteilung macht die Wirtschaft ungerechte Profite, aber der Staat sorgt für gerechte Verhältnisse. Ethik und Wirtschaft sind getrennt. Verantwortung kommt nur als erzwungene Korrektur in die Wirtschaft – in der Form von Haftung, von Pflichten oder Einschränkungen der Freiheit der Akteure. Und Verantwortung kostet Geld, statt Profite zu fördern.
Die Quelle des Vorurteils: Die Wirtschaftswissenschaften
»Die Ideen von Ökonomen und politischen Philosophen, seien sie richtig oder falsch, sind mächtiger als üblicherweise angenommen. (…) Praktiker, die von sich glauben, sie unterlägen keinerlei intellektuellen Einflüssen, sind gewöhnlich die Sklaven eines längst verstorbenen Ökonomen«, schrieb einer, der es wissen muss: John Maynard Keynes (1966: 323). Das gilt auch für George Soros, Wolfgang Kersting, Niklas Luhmann und viele Politiker: Indem sie die Ethik in der Wirtschaft ins Exil schicken, wiederholen sie bloß die Vorurteile der Wirtschaftswissenschaften der vergangenen 200 Jahre (hierzu einschlägig und für die folgende Argumentation grundlegend und maßgeblich: Dierksmeier 2016).
Zu Anfang des 19. Jahrhunderts ließen sich Volkswirtschaftler von den Naturwissenschaften beeindrucken. Die Rekonstruktion und Vermessung der materialen Welt, wie sie der Physik gelang, sollte im Bereich der Wirtschaft auch den Volkswirtschaftlern gelingen. Die bestehenden teleologischen, auch religiös motivierten Traditionen wirtschaftlichen Denkens von Aristoteles bis zum Moralphilosophen Adam Smith, die wirtschaftliches Handeln im Dienste höherer menschlicher Zwecke beurteilten, sollten ersetzt werden durch die objektive Beschreibung eherner Gesetze wirtschaftlichen Handelns. Wirtschaft wurde jetzt als Mechanik aufeinander einwirkender Kräfte verstanden. Qualitative Werturteile und Werte wie Freiheit und Verantwortung wurden Schritt für Schritt übersetzt in quantifizierbare Kategorien – schlussendlich in Interessen und Kategorien einer Zahlungsbereitschaft im Dienste der Interessen.
Dabei verabschiedete sich die Volkswirtschaft von der Sozialwissenschaft und orientierte sich am methodologischen Fundus der Physik und der Mathematik. Besonders die Mechanik versprach einen Weg zur Modellierung ökonomischer Probleme ohne Rekurs auf ein Wertesystem jenseits der jetzt als abgetrennte Sphäre betrachteten Ökonomie. John Stuart Mill (1806–1873), Auguste Comte (1798–1857) und andere begannen, die ökonomische Praxis mit quasi mechanischen Gesetzen zu beschreiben, die sich in mathematische Gleichungen übersetzen ließen.
Während der Fluss des Geldes oder der Güter kein großes Problem für die entstehende Disziplin der Statistik darstellte, war es wesentlich schwieriger, ethische Überlegungen in ökonomische Kalkulationen zu übersetzen, also von qualitativen Werturteilen zu einer quantitativen Wertzuschreibung zu kommen. Hier hatten die Utilitaristen wie Jeremy Bentham (1748–1832) und James Mill (1773–1836) Vorarbeit geleistet. Sie hatten die jahrhundertealten Konfliktlinien der Metaphysiker überwunden und das vermeintlich objektiv erkennbare Werturteil radikal subjektiviert. Nicht mehr Philosophen oder Priester sollten sagen, was einem universalen Geltungsanspruch zufolge ökonomisch gut sei, sondern jeder Marktteilnehmer sollte selbst entscheiden, was für gut befunden wird. Das Gute wechselte seinen Status vom philosophischen Axiom zum praktischen Nutzen des Einzelnen in der Annahme, dass der Nutzen für jeden und jede am Ende das Glück aller befördern würde.
Die zuvor so zentrale Idee eines Gemeinwohls wurde ersetzt durch das Aggregat der Einzelinteressen – durchaus ein egalitärer, emanzipativer Schritt –, das den einzelnen Menschen ins Zentrum der Theoriebildung stellte, statt traditionelles, oft auch klassenorientiertes aristotelisches oder scholastisches Denken fortzuführen. Allerdings war das eine empirische Wende in der Bewertung der Werte: Jetzt wurde gemessen, was Menschen tatsächlich wertschätzten, ohne zu fragen, was sie möglicherweise mit guten Gründen wertschätzen sollten. Diese Wende öffnete das Tor zum Exil ethischer – moralischer, sozialer, politischer – Überlegungen zur Organisation von Gesellschaft jenseits ökonomischer Interaktionen.
Der programmatische Schritt, die Idee des Gemeinwohls durch das aggregierte Interesse zu ersetzen, fiel mit anderen utilitaristischen Konzeptionen menschlichen Verhaltens zusammen. Die Utilitaristen beschrieben Schmerz und Freude als entscheidende Faktoren menschlichen Handelns, wobei diese auf der Basis des größten Treibers menschlichen Verhaltens, des Eigeninteresses, vermieden oder gesucht wurden. Nun konnte die Intensität von Schmerz oder Freude als qualitativer Zustand quantitativ nicht direkt erfasst werden. Aber William Stanley Jevons (1835–1882) und Alfred Marshall (1842–1924) gingen den nächsten Schritt in der Quantifizierung ethischer Dispositionen: Nützlichkeit in Bezug auf die Vermeidung von Schmerz und die Suche nach Freude konnte gemessen werden in der Bereitschaft, für Güter zu zahlen, die Schmerz vermieden und Freude brachten. Schmerz und Freude konnten jetzt quantitativ vermessen und kalkuliert werden. Das vormals qualitative Problem der Optimierung sozialen Nutzens wurde zum einfachen, quantitativ lösbaren Problem des maximierten Güterkonsums. Werturteile wie »besser« oder »schlechter« wurden ersetzt durch die Ausmessung von »mehr« oder »weniger«.
Die österreichische Schule um Carl Menger (1840–1921) eröffnete diesem physikalistischen Ansatz mit der Grenznutzentheorie die Modellierung von Werten und Preisen. Substanzielle Wertbeurteilungen in Bezug etwa auf eine moralische Qualität oder soziale Funktion wurden ersetzt durch eine prozedurale Bemessung anhand von Preisen und ihrer Entwicklung. Im epistemologischen Programm einer naturwissenschaftlichen Volkswirtschaftslehre störten Werte wie Freiheit und Verantwortung nur die mechanische Regelmäßigkeit ökonomischer Transaktionen, das Fundament wissenschaftlicher Genauigkeit.
Jahrtausende ökonomischen Denkens bis Adam Smith waren davon ausgegangen, dass es objektive Werte gab, mit denen die Wirklichkeit nicht nur deskriptiv erfasst, sondern auch präskriptiv geprägt werden sollte. Indem Werturteile mit Blick auf die Gesamtheit menschlichen Lebens aber ersetzt wurden durch subjektive Wertzuschreibungen, kollabierte die kritische Distanz zwischen Werten und empirischen Fakten – und damit der gesamte präskriptive, kritische und auch kontrafaktische Mehrwert volkswirtschaftlichen Denkens. Nach dem Werturteilsstreit zwischen Max Weber (1864–1920) und Werner Sombart (1863–1941) setzte sich Webers Sichtweise durch, dass sich die Volkswirtschaft normativer Urteile zu enthalten und sich auf die Beschreibung und Erklärung ökonomischen Handelns zu konzentrieren habe. Der einflussreiche Wiener Kreis, den Otto Neurath (1882–1945) gar in den »Wiener Kreis des Physikalismus« umbenennen wollte, begrenzte deshalb die Methodologie der Volkswirtschaftslehre auf empirische Beobachtung und analytisches Denken.
Nachdem das Problem qualitativer Bewertung in die Beschreibung quantitativer Bepreisung überführt worden war, wurde zum zentralen Problem ökonomischen Denkens, wie knappe Ressourcen im Dienste gegebener Ziele eingesetzt werden können. Robbins formulierte kanonisch: »Economics is the science which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses« (Robbins 1932: 6). Seither dominiert die Sprache der Interessen, Profite und Preise sowie der Effizienz sowohl die Wirtschafts- als auch die Betriebswirtschaftslehre.
Werte, Ideale, Zwecke und soziale oder ökologische Anliegen haben keinen Platz mehr in den dominanten Theorien der Wirtschaftswissenschaften. Und auch wenn die mentalen Modelle wirtschaftlicher Mechaniken zunehmend durch mentale Modelle der Thermodynamik und Entropiegesetze ersetzt werden, bleibt die Grundausrichtung modernen ökonomischen Denkens physikalistisch. Werte wie Freiheit und Verantwortung, die moralische Beurteilung erst ermöglichen, begründen und sinnvoll machen, haben in der Wirtschaftslehre gar keinen Platz mehr.
Kein Wunder, dass deshalb der Glaube weit verbreitet ist, Verantwortung könne der Sphäre der Wirtschaft all...
Table of contents
- Cover
- Titel
- Impressum
- Inhalt
- Leistung vs. Erfolg: Welches Unternehmertum braucht die Soziale Marktwirtschaft?
- Sozial wird die Marktwirtschaft schon durch ihre Unternehmer
- Neue Gründer braucht das Land! Zur Rolle und Perspektive von Migrantenunternehmern in Deutschland
- Die Gesellschaft muss vom Fortschritt profitieren
- »Wir müssen ihnen ein schlechtes Gewissen machen« – Ein Interview mit Nihat Sorgeç
- Die Autoren
- Abstract