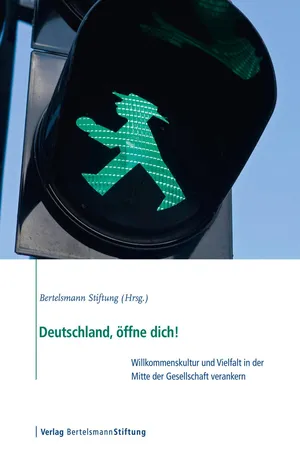![]() Willkommenskultur – Strukturen vor Ort
Willkommenskultur – Strukturen vor Ort![]()
Willkommen in Hamburg – über die Willkommenskultur und das Welcome Center der Hansestadt*
Birte Steller
1 Einführung
Jeder siebte Mensch weltweit hat einen Migrationskontext (UNCSD Secretariat 2012: 1). Menschliche Mobilität im internationalen und nationalen Rahmen ist seit Beginn der statistischen Erhebungen verbreitet wie nie zuvor. Migration ist damit einer der Megatrends des 21. Jahrhunderts (ebd.). Und Deutschland ist ganz vorn unter den Trendsettern: »Im europäischen Vergleich zeigt sich, dass Deutschland weiterhin ein Hauptzielland von Migration ist und im Vergleich zu anderen europäischen Staaten in den letzten beiden Jahren an Attraktivität gewonnen hat« (BAMF 2012a: 12).
Bei der Arbeits- und Ausbildungsimmigration ist die Tendenz der Zuwanderung deutlich steigend, insbesondere aus Ländern wie China, Indien und den USA. Fast drei Viertel, 73,3 Prozent des Zuzugs, kommt allerdings aus Staaten der Europäischen Union (ebd.: 19). Insgesamt konnte die Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2010 rund 28.000 Zuzüge in diesem Bereich verzeichnen, was einem Anstieg von etwa 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht (ebd.: 12). »Auch für das erste Halbjahr 2011 meldete das Statistische Bundesamt in einer Pressemitteilung vom 22.12.2011 einen insgesamt positiven Wanderungssaldo von 135.000 Personen« (Beirat der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration 2012: 5).
Unter den Industrieländern hält Deutschland gleichzeitig unangefochten die Spitzenstellung bei der Aufnahme von Flüchtlingen (Lau 2012). Hierzulande leben 571.000 aufgenommene Flüchtlinge – doppelt so viele wie die USA und mehr als Großbritannien und Frankreich zusammen aufgenommen haben (ebd.).
Wenn sich die Migration nach Deutschland damit zumindest nach statistischer Datenlage als erfolgreiche Trendentwicklung im weltweiten Vergleich darstellt, steht gleichzeitig – oder gerade deshalb – die Frage, wie Integration erfolgreich gelingen kann, weiterhin zur öffentlichen Debatte.
Dabei befindet sich auch der Begriff »Integration« selbst auf dem Prüfstand. In Expertenkreisen wird diskutiert, ob er durch einen anderen Begriff – etwa »Inklusion« oder »Einbeziehung« – ersetzt werden sollte und könnte, da »Integration« grundsätzlich assoziativ einseitig und problemorientiert auf hochschwellige Anforderungen an Zuwandernde bezogen werde. Eine neue »zukunftsorientierte« Migrationspolitik wird daher gefordert, die auch Integrationspolitik sein soll (Hunn 2011: 53).
Als ein wesentlicher Baustein wird in diesem Zusammenhang die »gesellschaftliche und politische Partizipation« von Migrantinnen und Migranten genannt (ebd.). Als Erfolgsfaktor für die Gewährleistung der Teilhabe wird dabei das Herstellen von Chancengerechtigkeit gesehen. Diese wiederum bedürfe eines »interkulturell geschulten Umgangs im Bildungswesen, aber auch in Betrieben, bei den Behörden oder in kulturellen Einrichtungen, die sich für Zuwanderer öffnen müssen. Gleichzeitig müsse aber von den Zuwanderern auch gefordert werden, dass diese sich mit der Sprache, den Rechtsnormen und den gegebenen zivilisatorischen Standards des Zuwanderungslandes vertraut machen und dazu bereit sein sollen, diese Normen und Standards bedingungslos anzuerkennen« (ebd.).
Als weiterer Baustein für eine nachhaltige Migrations- oder auch Einwanderungspolitik ist die Etablierung einer flächendeckenden, deutschlandweiten »Willkommens- und Anerkennungskultur in aller Munde« (BAMF 2012b). So titelt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in einer Pressemeldung vom 16. Mai 2012: »Willkommenskultur konkret: Expertengruppe entwickelt praxisnahe Vorschläge für ein attraktives Deutschland (…). Deutschland macht sich auf, um für Menschen mit Migrationshintergrund attraktiver zu werden« (ebd.).
Diese Willkommenskultur für Zuwandernde – hier konkretisiert als Anforderung an behördliche Leistungen – ist Gegenstand dieses Beitrags. Zunächst folgt ein Überblick zur Entwicklung und gegenwärtigen Lage der Willkommenskultur in der Bundesrepublik Deutschland, sowohl rechtlich als auch faktisch, um dann im nächsten Schritt den Begriff »Willkommenskultur« näher zu fassen. Anschließend wird die Praxis des Hamburg Welcome Center als Beispiel für alltagserprobte behördliche Willkommenskultur erläutert, bevor der weltweite Vergleich von Städten und Städtenetzwerken, mit denen auch das Hamburg Welcome Center kooperiert, zur Thematik der Offenheit für Migrationsprozesse in den Blick genommen wird.
2 Zur Entwicklung der Willkommenskultur für Zuwandernde
Der Begriff »Willkommenskultur« hat – nach einer Onlinerecherche Mitte Juli 2012 – im Zuwanderungskontext der Bundesrepublik Deutschland offensichtlich keine Geschichte. Der Begriff ist also jung und inhaltlich noch zu füllen. Zunächst ist aber zu klären, was ihn überhaupt in die gegenwärtige Integrationsdebatte gebracht hat.
Paradigmenwechsel in der deutschen Integrations- und Zuwanderungspolitik?
»Mit dem Standort Deutschland wird der jahrzehntelange grundsätzliche Anwerbestopp mit komplizierten und bürokratischen Einzelfallausnahmen verbunden und keinesfalls eine offene und transparente Einladungs-, Einwanderungs- und Willkommenskultur« (Beirat der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration 2012: 6).
Direkte und indirekte Kundinnen und Kunden (vgl. die Liste am Ende dieses Beitrags) des Hamburg Welcome Center – gerade z. B. aus dem Hochschulbereich – schildern oft, dass die zu durchlaufenden Verfahren als so wenig transparent, kompliziert, zeitaufwendig und schwierig nachvollziehbar wahrgenommen würden, dass der Eindruck entstehe, hier eigentlich nicht wirklich gewollt und wertgeschätzt zu sein.
Zum aktuellen Recht der Zuwanderung
Ein Blick ins Gesetz zeigt, dass sich diese rechtliche Rahmenlage durch die grundsätzliche Neuorganisation des Zuwanderungsrechts 2005 nicht geändert hat. Auch das zum 1. August 2012 in Kraft tretende neue Recht im Rahmen der Umsetzung der sogenannten Hochqualifizierten-Richtlinie der Europäischen Union (Bundesgesetzblatt 2012, Teil I Nr. 24, 8.6.2012, 1224 ff.) wird nicht den Grundsatz des § 1 Aufenthaltsgesetz ändern. Zweck des Zuwanderungsrechtes bleibt es damit grundsätzlich, den Zuzug nach Deutschland gem. § 1 Abs. 1 Satz 1 Aufenthaltsgesetz zu steuern und zu begrenzen, also weiterhin Zuwanderungsgestaltung mit einer grundsätzlichen abwehrenden Verbotshaltung mit Erlaubnisvorbehalt starr auszustatten.
Die Abschiedsbilanz des zum 30. Juni 2012 ausgeschiedenen Berliner Beauftragten für Integration und Migration Günter Piening vom 21. Juni 2012 bestätigt die Einstellung, dass Deutschland »von einer wirklichen Anerkennung der Einwanderungsgesellschaft und der Gleichstellung der Einwanderer und ihrer Kinder (…) noch weit entfernt« und die »Reform des Aufenthalts- und Staatsbürgerrechts überfällig« sei (Der Beauftragte des Senats von Berlin für Integration und Migration 2012).
Gleichzeitig fordert der Beirat der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration (2012: 2) unter dem Titel »Willkommen. Working and Living in Germany – Your Future« im Frühjahr dieses Jahres mit seinen Empfehlungen ausdrücklich einen »Paradigmenwechsel in der Einwanderungs- und Integrationspolitik der Bundesrepublik Deutschland«.
Der Jahresbericht der Stiftung Mercator 2011 formuliert dazu unmissverständlich: »Dringend muss das neue Zuwanderungsrecht klar an den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes ausgerichtet werden. (…) Die Erfahrung zeigt, dass die Abschottung des Arbeitsmarktes gegen ausländische Fachkräfte nicht zu mehr Beschäftigung von Inländern führt. Das Gegenteil ist richtig: Eine Zuwanderungspolitik, die sich an den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes orientiert, führt zu mehr wirtschaftlicher Dynamik insgesamt und damit auch zu mehr Beschäftigungsmöglichkeiten für Inländer« (Laschet 2011: 17).
Gleichzeitig zeigen die eingangs genannten Zahlen, dass Deutschland faktisch schon Einwanderungsland ist und auch so in Anspruch genommen wird. Zugleich gibt es gegenwärtig einen Hype um die Einführung einer deutschlandweiten Willkommenskultur.
Zur Zuwanderungslage
Wesentlicher Motor für diese letztgenannte Tendenz – die allein hier näher betrachtet wird – dürfte sein, dass trotz positiver Nettozuwachszahlen gerade auch im akademisch qualifizierten Bereich die Bundesrepublik Deutschland mit steigender Tendenz – u.a. demographisch alterungsbedingt – »auf kluge Köpfe aus aller Welt angewiesen« ist (Presse- und Informationsamt der Bundesregierung 2012). In Deutschland stehe der »hohe Beschäftigungsstand (…) in den nächsten Jahrzehnten einem massiven Rückgang des Erwerbspersonenpotenzials (bei konstanter Erwerbsquote) gegenüber« (Beirat der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration 2012: 4).
Trotz positiver Einwanderungszahlen von Personen nicht deutscher Herkunft ist bei einer Gesamtbetrachtung festzustellen, dass im »Durchschnitt des Zeitraums 2005–2010 (…) jährlich 43.000 Personen mit deutschem Pass weniger ein- als ausgewandert« sind (ebd.: 5) bzw. es im Jahr 2010 in Bezug auf deutsche Staatsbürger ein negatives Saldoresultat in Höhe von 26.000 gab.
Weiterhin ist im Jahr 2010 auch »der Wanderungssaldo zwischen den ›alten‹ EU-Staaten sogar negativ, weil einerseits die Nettozuwanderungen ausgesprochen niedrig sind und andererseits die Zahl junger, gut qualifizierter deutscher Fachkräfte zugenommen hat, die im Ausland bessere Berufs- und Einkommenschancen« sehen (ebd.).
Schließlich sollte berücksichtigt werden, dass weiterhin bei den Zuzugszahlen aus Drittstaaten in 2010 nur jeder Vierzigste eine Fach- und Führungskraft war (ebd.: 6). Außerdem lasse sich nicht sagen, ob die gegenwärtigen Einwanderungszahlen nur ein aktueller Effekt sind (z. B. Wirtschaftskrise in einigen EU-Staaten) oder als längerfristige und stabile Trendkorrektur angesehen werden können (ebd.: 5).
Angesichts dieser Datenlage verwundert es nicht, dass Staatsministerin Böhmer bei einem Besuch des Hamburg Welcome Center am 10. Juli 2012 ausführt, dass der »Ausbau einer Willkommenskultur in Deutschland (…) angesichts des zunehmenden Fachkräftemangels immer mehr an Bedeutung« gewinne und dabei die Frage der Integration auch gerade der qualifizierten Zuwanderer nicht vernachlässigt werden dürfe, denn »Integration (sei) auch bei Fachkräften kein Selbstläufer« (Presse- und Informationsamt der Bundesregierung 2012).
Mit anderen Worten: Immer mehr Politik- und Verwaltungsbereiche befassen sich jenseits von rechtlichen Rahmenbedingungen vor allem bei den Zuwanderungsverfahren mit einem neuen, offeneren und adressatenorientierteren Herangehen an das Thema Zuwanderung. Festzustellen bleibt allerdings, dass es sich bei dieser Thematik einer Willkommenskultur um einen rein operativen, lokal zu verortenden und zu gestaltenden Ausschnitt aus dem globalen Thema der Zuwanderungssteuerung handelt, der zudem offensichtlich interessengeleitet an demographisch-ökonomische Kriterien der Ausstattung der gegenwärtigen bzw. absehbaren Beschäftigungslandschaft in Deutschland geknüpft ist.
Einen Paradigmenwechsel in der Zuwanderungssteuerung kann dieser Willkommenshype daher nicht bewirken. Allerdings birgt die Befassung mit und Einführung von Willkommenskulturen die Chance, hiermit indirekt eine Veränderung der Wahrnehmung und Wertschätzung von Zuwanderung zu bewirken. Sofern Zuwanderung und Internationalisierung im Rahmen von Willkommenskulturprozessen zunehmend wahrhaft als Bereicherung für die hier lebende Bevölkerung verstanden und erlebt werden, kann sich dies letztlich auch auf eine offenere, wertschätzendere Gestaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen von Zuwanderung auswirken.
Eine Möglichkeit der Mitgestaltung politischer bzw. administrativer Entscheidungsverfahren im Zuwanderungsrecht hin zu einem offeneren Ansatz besteht bereits jetzt darin, durch Weitergabe von Wahrnehmungen seitens der operativen Verwaltungsbasis – z. B. einer Ausländerdienststelle wie dem Hamburg Welcome Center – auf die ministerielle Ebene praxisorientierte Eindrücke und Bedarfe der Zuwanderer zu spiegeln.
Entstehung und Definition des Begriffs »Willkommenskultur«
Auch wenn der Begriff der Willkommenskultur auf keine Geschichte zurückblicken kann, ist es doch beeindruckend festzustellen, welche rasante Entwicklung er innerhalb eines guten Jahres nehmen konnte.
Zur Entstehung des Begriffs
Wurde der Begriff der...