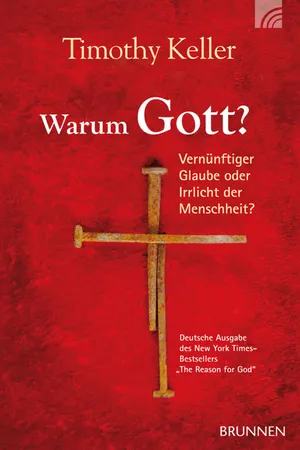
- 336 pages
- English
- ePUB (mobile friendly)
- Available on iOS & Android
eBook - ePub
About this book
Warum Gott? Ist es heute noch vernünftig zu glauben? Ist der Glaube nicht irrelevant, ohne Antworten auf die drängenden Fragen der Zeit? Hat die Wissenschaft nicht den Glauben an Gott längst widerlegt? Mächtige Fragen an den Allmächtigen! Tim Keller findet Antworten, die nicht nur den Zweifler nachdenklich werden lassen. Und er nennt gute Gründe für den Glauben.
Frequently asked questions
Yes, you can cancel anytime from the Subscription tab in your account settings on the Perlego website. Your subscription will stay active until the end of your current billing period. Learn how to cancel your subscription.
No, books cannot be downloaded as external files, such as PDFs, for use outside of Perlego. However, you can download books within the Perlego app for offline reading on mobile or tablet. Learn more here.
Perlego offers two plans: Essential and Complete
- Essential is ideal for learners and professionals who enjoy exploring a wide range of subjects. Access the Essential Library with 800,000+ trusted titles and best-sellers across business, personal growth, and the humanities. Includes unlimited reading time and Standard Read Aloud voice.
- Complete: Perfect for advanced learners and researchers needing full, unrestricted access. Unlock 1.4M+ books across hundreds of subjects, including academic and specialized titles. The Complete Plan also includes advanced features like Premium Read Aloud and Research Assistant.
We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.
Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.
Yes! You can use the Perlego app on both iOS or Android devices to read anytime, anywhere — even offline. Perfect for commutes or when you’re on the go.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Yes, you can access Warum Gott? by Timothy Keller in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in Theology & Religion & Systematic Theology & Ethics. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.
Information
TEIL I
Der Sprung in den Zweifel
KAPITEL 1
„Es kann nicht nur eine wahre Religion geben“
„Wie soll es nur einen wahren Glauben geben können?“, fragte Blair, eine 24 Jahre alte Frau aus Manhattan. „Es ist doch anmaßend, wenn jemand behauptet, dass seine Religion besser als die anderen ist, und die Leute zu ihr zu bekehren versucht. Es sind doch wohl alle Religionen gleich gut, wenn es um die Bedürfnisse ihrer Anhänger geht.“
„Religiöse Exklusivität ist nicht nur engstirnig, sondern mordsgefährlich“, fügte Geoff hinzu, ein Twen aus Großbritannien, der ebenfalls in New York City wohnte, „Religion hat doch immer nur zu Streit, Spaltung und Konflikten geführt; vielleicht ist sie der größte Feind für den Frieden in der Welt. Wenn die Christen weiter behaupten, dass sie die ‚Wahrheit‘ haben, und wenn andere Religionen ins gleiche Horn stoßen, wird es in der Welt nie Frieden geben.“13
I
n meinen jetzt fast zwanzig Jahren in New York habe ich unzählige Gelegenheiten gehabt, Menschen zu fragen: „Was ist Ihr größtes Problem mit dem Christentum? Was stört Sie am meisten an dem, was Christen glauben und leben?“ Eine der häufigsten Antworten, die ich bekommen habe, lässt sich in dem Wort Ausschließlichkeitsanspruch zusammenfassen.
Ich wurde einmal als christlicher Vertreter zu einer Podiumsdiskussion in einem nahe gelegenen College eingeladen, zu der auch ein jüdischer Rabbi und ein muslimischer Imam kamen. Wir drei sollten über die Unterschiede zwischen unseren Religionen diskutieren. Das Gespräch war höflich, intelligent und respektvoll. Wir betonten alle, dass es erhebliche, unüberbrückbare Differenzen zwischen den drei Religionen gab. Ein Beispiel war Jesus. Wir alle stimmten der folgenden Aussage zu: „Wenn die Christen recht haben und Jesus Gott ist, dann lieben die Muslime und Juden Gott nicht so, wie er wirklich ist, und wenn die Muslime und Juden recht haben und Jesus nicht Gott ist, sondern nur ein Lehrer oder Prophet, dann lieben die Christen Gott nicht so, wie er wirklich ist.“ Der springende Punkt war: Es konnte nicht sein, dass wir alle drei mit unseren Auffassungen über das Wesen Gottes recht hatten.
Etliche der Studenten waren höchst aufgebracht. Einer sagte, dass das, worauf es ankam, doch wohl war, dass man überhaupt an Gott glaubte und im Übrigen selber Liebe praktizierte. Die Position, dass die eine Religion der Wahrheit näher kam als die andere, fand er intolerant. Ein anderer Student sah uns drei Geistliche an und sagte frustriert: „Es wird nie Frieden auf der Erde geben, wenn die Vertreter der Religionen weiter solche Ausschließlichkeitsansprüche stellen!“
Religion ist ein Sicherheitsrisiko für den Weltfrieden.
Die Meinung, dass eines der ganz großen Hindernisse für den Weltfrieden die Religion ist – vor allem die großen Weltreligionen, die behaupten, die allein wahren und den anderen überlegen zu sein – ist weitverbreitet. Es wird Sie vielleicht überraschen, wenn ich Ihnen sage, dass ich als Pastor diese Meinung teile. Religionen haben es an sich, dass sie die Herzen ihrer Anhänger auf einen potenziell gefährlichen Weg lenken. Jede Religion sagt ihren Gläubigen, dass sie „die Wahrheit“ haben, worauf sie sich prompt den Anhängern anderer Religionen überlegen fühlen. Sie sagt ihnen weiter, dass sie errettet werden und zu Gott kommen, wenn sie sich dieser Wahrheit ganz hingeben, was sie natürlich leicht dazu bringt, sich von den Menschen, die weniger rein und ernst leben, abzugrenzen. Es ist nur zu leicht, die anderen Religionen schlechtzumachen und zu karikieren. Und wenn es erst einmal so weit ist, ist der Weg zur gesellschaftlichen Ausgrenzung, ja zu Unterdrückung und Gewalt nicht mehr weit.
Religion ist also ein Sicherheitsrisiko für den Frieden. Wie kann man dieses Risiko minimieren? Unter den heutigen politischen und gesellschaftlichen Wortführern in der Welt kursieren drei Strategien: Entweder sie sind dafür, die Religion zu verbieten, sie schlechtzumachen oder sie radikal zur Privatsache zu erklären.14 Viele Menschen setzen große Hoffnungen auf diese Strategien, doch ich glaube nicht, dass sie von Erfolg gekrönt sein werden; eher werden sie die Situation noch verschärfen.
1. Religion verbieten?
Eine klassische Methode, den Ausschließlichkeitsansprüchen der Religionen zu begegnen, besteht darin, sie mit eiserner Hand zu kontrollieren oder sie, wo möglich, zu verbieten. Das 20. Jahrhundert hat gleich mehrere groß angelegte Versuche dazu gesehen. Die Kommunisten in der Sowjetunion, China, Kambodscha und anderswo, aber auf ihre Art auch die Nazis in Deutschland waren entschlossen, die Religionsausübung einzudämmen, um zu verhindern, dass sie die Gesellschaft spaltete oder die Macht des Staates gefährdete. Das Ergebnis war regelmäßig nicht mehr Friede und Harmonie, sondern mehr Unterdrückung. Die tragische Ironie dieser Situation hat Alister McGrath in seiner Geschichte des Atheismus so beschrieben:
Im 20. Jahrhundert finden wir eines der größten und traurigsten Paradoxe in der Geschichte der Menschheit: dass die größte Intoleranz und Gewalt dieses Jahrhunderts von denen praktiziert wurden, die glaubten, dass die Religion zu Intoleranz und Gewalt führt.15
Hand in Hand mit diesen Bemühungen ging die im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert weitverbreitete Annahme, dass im Zuge des weiteren technischen Fortschritts der Menschheit die Religion immer schwächer werden und schließlich aussterben würde. Die Religion hatte ihren Platz in der Entwicklung des Menschen: Früher haben wir die Religion gebraucht, um mit der Angst einflößenden und unerklärbaren Welt zurechtzukommen, aber je weiter die Wissenschaft fortschreiten würde, und je besser wir in der Lage sein würden, unsere Umgebung zu verstehen und zu beherrschen, umso geringer würde unser Bedürfnis nach Religion werden – dachten die Gelehrten.16
Doch genau dies ist nicht geschehen, und heute glaubt kaum noch jemand an diese „Säkularisierungstheorie“.17 Praktisch bei allen großen Religionen wächst die Mitgliederzahl. Vor allem in den Entwicklungsländern ist das Wachstum des Christentums geradezu explosionsartig. Allein in Nigeria gibt es mittlerweile sechsmal mehr Anglikaner als in den ganzen USA. In Ghana gibt es mehr Presbyterianer als in den USA und Schottland zusammen. In Korea ist der Anteil der Christen in 100 Jahren von ein auf 40 Prozent gestiegen, und Experten glauben, dass Ähnliches in China passieren wird. Wenn es in fünfzig Jahren eine halbe Milliarde chinesischer Christen geben sollte, wird dies den Gang der Geschichte verändern.18 Und was da so rasch wächst, ist in den allermeisten Fällen nicht das einst von Soziologen prognostizierte säkulare „Christentum light“, sondern ein robuster Glaube an Übernatürliches, der Wunder, die Autorität der Bibel und persönliche Bekehrung betont.
Die Vitalität der Religion in der Welt ist so groß, dass die Versuche, sie zu unterdrücken oder zu kontrollieren, sie oft nur noch stärker machen. Als die chinesischen Kommunisten nach dem Zweiten Weltkrieg alle westlichen Missionare auswiesen, glaubten sie, damit dem Christentum in China den Todesstoß zu versetzen. Tatsächlich wurden die Lücken in der Leitung der Kirchen von einheimischen Christen gefüllt, was die Kirchen chinesischer und damit stärker machte.
Nein, die Religion ist nicht ein Notbehelf aus primitiveren Stufen der Evolution der Menschheit, sie ist ein permanenter, zentraler Aspekt des Menschseins. Für den nicht religiösen Menschen ist dies eine bittere Pille. Unsere Welt ist eine tief religiöse Welt, und nichts spricht dafür, dass sich dies je ändern wird.
2. Religion schlechtmachen?
Die Religion wird nicht verschwinden, und keine Regierung kann ihre Kraft brechen. Aber kann man nicht den Religionen, die sich im Besitz „der Wahrheit“ wähnen und andere zu bekehren versuchen, durch Aufklärung und die richtigen Argumente den Wind aus den Segeln nehmen? Kann man nicht einfach die Bürger – egal, was für eine Religion sie haben – dazu anhalten, zuzugeben, dass jede Religion nur einer von vielen möglichen Lebensstilen und Wegen zu Gott ist?
Damit schafft man eine Atmosphäre, in der es, und sei es nur im persönlichen Gespräch, als unaufgeklärt und fanatisch gilt, religiöse Ausschließlichkeitsansprüche zu stellen. Man schafft dies durch das ständige Wiederholen gewisser Grundthesen, die mit der Zeit den Status allgemein akzeptierter Wahrheiten erlangen: „Man weiß doch, dass Missionieren falsch ist …“ Wer aus der Reihe tanzt, gilt als naiv oder gefährlich. Anders als die Verbotsstrategie erzielt dieses Rezept gewisse Teilerfolge. Auf Dauer wird es jedoch scheitern, denn es beruht auf einem inneren Widerspruch, ja fast schon einer Doppelmoral. Ich möchte dies zeigen, indem ich einige jener Grundthesen kritisch beleuchte.
„Alle großen Religionen sind gleich wahr und lehren im Grunde dasselbe.“
Diese These ist so verbreitet, dass vor wenigen Jahren ein Journalist jeden, der glaubte, „dass es minderwertige Religionen gibt“, kurzerhand zu einem rechtsradikalen Extremisten erklärte.19 Aber wollen wir wirklich im Ernst behaupten, dass totalitäre Sekten, die im Massenselbstmord enden, oder Religionen, die Kinderopfer verlangen, mit anderen Religionen auf einer Stufe stehen? Die meisten Zeitgenossen werden dies wohl verneinen.
Aber die meisten Menschen, die behaupten, dass alle Religionen gleich sind, denken dabei natürlich an die großen Weltreligionen und nicht an irgendwelche Splittergruppen. So auch der Student, der mir bei der oben erwähnten Podiumsdiskussion widersprach. Er behauptete, dass die Lehrunterschiede zwischen Judentum, Islam, Christentum, Buddhismus und Hinduismus doch letztlich nebensächlich seien und dass die Anhänger dieser Religionen alle an denselben Gott glaubten. Doch als ich ihn fragte, wer dieser Gott war, beschrieb er ihn als einen all-liebenden Geist im Universum. Und genau hier liegt der Widerspruch bei dieser Position: Man behauptet, dass die Lehre nicht so wichtig sei – und bringt im nächsten Atemzug lehrmäßige Aussagen über das Wesen Gottes, die den Lehren aller großen Religionen widersprechen. Der Buddhismus glaubt nicht, dass es überhaupt einen persönlichen Gott gibt. Juden, Christen und Muslime glauben an einen Gott, der die Menschen für ihren Glauben und ihr Leben zur Verantwortung zieht und dessen Eigenschaften sich nicht auf die der Liebe reduzieren lassen. Die Behauptung, dass Lehren nicht so wichtig seien, ist ironischerweise selber bereits eine Lehre. Und deren Vertreter setzen ein ganz bestimmtes Gottesbild voraus, das sie für besser und aufgeklärter als die Gottesbilder der klassischen Religionen halten. Sie tun also genau das, was sie den anderen verbieten wollen!
Die Behauptung, dass Lehren nicht so wichtig seien, ist ironischerweise selber bereits eine Lehre.
„Jede Religion erkennt einen Teil der spirituellen Wahrheit, aber die ganze Wahrheit kann keine sehen.“
Vertreter dieser These zitieren gerne die Geschichte von den Blinden und dem Elefanten. Mehrere Blinde gehen spazieren und stoßen dabei auf einen Elefanten, der sich von ihnen betasten lässt. „Dieses Tier ist so lang und geschmeidig wie eine Schlange“, erklärte der Erste, der den Rüssel des Elefanten erwischt hat. „Nein, nein, es ist dick und rund wie ein großer Baumstamm“, sagt der Zweite, der ein Bein des Elefanten befühlt. „Nein, es ist groß und flach“, erwidert der dritte Blinde, der die Seite des Elefanten entlangfährt. Jeder der Blinden fühlt nur einen Teil des Elefanten; das ganze Tier vorstellen kann sich keiner. Und ganz ähnlich, heißt es dann, erfasst jede der Weltreligionen nur einen Teil der spirituellen Realität, aber keine darf behaupten, die ganze Wahrheit zu erkennen.
Das Elefanten-Beispiel ist ein Schuss, der nach hinten losgeht. Die Geschichte wird nämlich aus der Perspektive von jemandem erzählt, der nicht blind ist. Woher will ich denn wissen, dass jeder der Blinden nur einen Teil des Elefanten erfasst, wenn ich nicht selber für mich in Anspruch nehmen kann, den ganzen Elefanten zu sehen?
Sie sieht demütig aus, die Versicherung, dass die Wahrheit ja viel größer ist als alles, was Menschen fassen können, aber wenn man sie als Mittel benutzt, um alle Wahrheitsansprüche für ungültig zu erklären, ist sie nichts als die höchst anmaßende Behauptung, über ein Wissen zu verfügen, das [allem anderen Wissen] überlegen ist. … Wir müssen hier fragen: „Was ist der [absolute] Bezugspunkt, von dem aus du behauptest, in der Lage zu sein, all die absoluten Behauptungen, die diese verschiedenen heiligen Schriften aufstellen, relativieren zu können?“20
Woher wollen Sie wissen können, dass keine Religion die ganze Wahrheit sieht, wenn Sie nicht selber über diese ganze Wahrheit verfügen? – Von der sie gerade behauptet haben, dass niemand sie hat.
„Der religiöse Glaube ist zu sehr ein Produkt der Geschichte und Kultur, um ,wahr‘ sein zu können.“
Als ich vor zwanzig Jahren nach New York kam, hörte ich oft das Argument, dass alle Religionen gleich wahr seien. Heute höre ich öfter, dass alle Religionen gleich falsch sind. Das geht dann ungefähr so: „Alle moralischen und spirituellen Behauptungen sind das Produkt unseres jeweiligen historischen und kulturellen Augenblicks; daher kann niemand behaupten, dass er die Wahrheit kennt, weil niemand beurteilen kann, ob die eine Aussage über die moralische oder spirituelle Realität zutreffender ist als die andere.“
Der Religionssoziologe Peter L. Berger hat die Unhaltbarkeit dieser häufig zu hörenden Behauptung aufgezeigt: In seinem Buch Auf den Spuren der Engel zeichnet er nach, wie im 20. Jahrhundert die „Soziologie des Wissens“ entdeckt wurde, also dass die Menschen das, was sie glauben, weitgehend deswegen glauben, weil sie gesellschaftlich dazu konditioniert worden sind. Wir denken gerne, dass unser Denken uns selber gehört, aber so einfach ist es nicht. Wir denken vielmehr wie die Menschen, die wir am meisten bewundern bzw. brauchen. Jeder Mensch gehört zu einer Gruppe, in der bestimmte Ansichten gelten und andere verneint werden. Berger bemerkt, dass viele aus dieser Tatsache den Schluss gezogen haben, dass es, da wir doch alle Gefangene unserer historischen und kulturellen Umgebung sind, nicht möglich ist, zu beurteilen, wie wahr oder falsch eine bestimmte Ansicht oder ein Glaube ist.
Doch dieser absolute Relativismus, so Berger weiter, funktioniert nur dann, wenn die Relativisten sich selber absolut, also gerade nicht relativ setzen.21 Wenn ich aus der gesellschaftlichen Bedingtheit allen Glaubens den Schluss ziehe, dass kein Glaube als für alle Menschen wahr betrachtet werden kann, ist diese Aussage ja selber wieder das Produkt bestimmter sozialer und kultureller Faktoren – und kann nach den Spielregeln der Relativisten nicht universal wahr sein. Der Relativismus, so Berger, relativiert sich selber und lässt sich letztlich nicht durchhalten.22 Sicher, unsere kulturellen Scheuklappen erschweren es uns, zwischen miteinander konkurrierenden Wahrheitsansprüchen abzuwägen. Die gesellschaftliche Bedingtheit von Glauben ist eine Tatsache, aber man kann sie nicht als Argument dafür benutzen, dass alle Wahrheit völlig relativ ist, oder das Argument widerlegt sich selber. Berger kommt zu dem Schluss, dass wir uns vor dem Abwägen religiöser Positionen nicht in das Klischee flüchten können, dass man die Wahrheit eben nicht erkennen könne. Die Denkarbeit bleibt uns nicht erspart, zu fragen, welche Behauptungen über Gott, über das Wesen des Menschen und über die spirituelle Realität wahr und welche falsch sind. Auf irgendeine Antwort auf diese Frage müssen wir unser Leben gründen.
Der Philosoph Alvin Plantinga vertritt seine eigene Version von Bergers These. Ihm werde oft gesagt: „Wenn Sie in Marokko geboren wären, wären Sie kein Christ, sondern ein Muslim.“ Plantingas Antwort:
Angenommen, wir räumen also ein, dass dann, wenn ich als Sohn muslimischer Eltern in Marokko und nicht christlicher Eltern in Michigan geboren wäre, meine Religion ganz anders geworden wäre. [Aber] das Gleiche gilt natürlich für den Pluralisten selber. … Wenn er in [Marokko] geboren worden wäre, wäre er heute sehr wahrscheinlich kein Pluralist. Folgt daraus also … dass seine pluralistischen Überzeugungen das Ergebnis eines unzuverlässigen Erkenntnisprozesses sind?23
Plantinga und Berger sagen das Gleiche. Man kann nicht sagen: „Alle Aussagen über die Religionen sind historisch bedingt und relativ, außer der, die ich gerade mache.“ Warum sollten wir jemandem, der behauptet, dass niemand entscheiden kann, welcher Glaube richtig und welcher falsch ist, glauben? Tatsache ist, dass wir alle im Leben Wahrheitsbehauptungen machen und dass es sehr schwierig ist, diese Behauptungen abzuwägen, aber dass wir dazu keine Alternative haben.
„Es ist anmaßend, wenn jemand behauptet, dass seine Religion die richtige ist, und versucht, andere zu ihr zu bekehren.“
Der bekannte Religionswissenschaftler John Hick schreibt: Wen...
Table of contents
- WARUM GOTT?
- VORWORT
- EINLEITUNG
- TEIL I Der Sprung in den Zweifel
- ZWISCHENBILANZ
- TEIL II Warum es Sinn macht zu glauben
- AUSKLANG: UND JETZT?
- DANKE!
- ANMERKUNGEN
- ÜBER DEN AUTOR