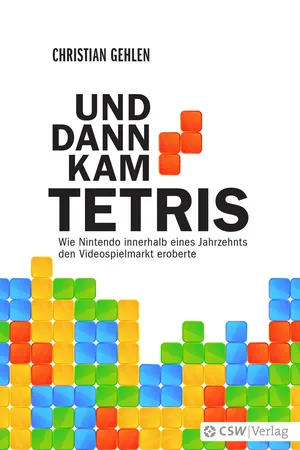![]()
TETRIS
Alexej Paschitnow war ein hochbegabter Mathematiker in Moskau, der irgendwann das Interesse für Computer entdeckte. Im Computer hatte die Welt der Mathematik kein Limit, und mit diesem Werkzeug konnte Paschitnow seine wissenschaftlich-mathematischen Projekte und Gedanken grenzenlos ausleben.
„Solange er am Rechner sitzt“, sagte Paschitnow mal, „ist der Hacker Gott und kann im Universum des Innenlebens eines Computers machen, was er will.“
Also verschlug es den jungen Mathematiker weg von seiner Dozentenstelle an einer Moskauer Universität in das Computerzentrum der Moskauer Akademie für Wissenschaften. An einem schwachbrüstigen Rechner der Marke Elektronika 60 verbrachte er Tag um Tag, Nacht um Nacht, ständig auf der Suche nach einem Durchbruch in der künstlichen Intelligenz oder, seinem Nebenprojekt, der Stimmerkennung.
Sein Rechner war im Prinzip nichts anderes als der russische Klon einer DEC LSI-11, einem PDP-11-Modell. Die PDP-11 wiederum war ein von der Firma DEC vertriebenes mannshohes 16 Bit-Computersystem, das vor allem in den Siebzigern und Achtzigern gekauft wurde. Technisch war das System sehr simpel gehalten, vor allem mit einem universellen Bussystem. Dadurch wurde der Computer einfacher für Prozessanwendungen nutzbar, da das Auf- und Umrüsten dank des standardisierten Bussystems keine größeren Probleme mehr machte. Vor allem an Universitäten wurde die PDP-11 genutzt, aber auch Kraftwerke wurde mit dem Gerät gesteuert. In Hamburg ist so ein Gerät seit 1981 in der Photonenforschung im Einsatz.
1984 bekam Paschitnow ein Exemplar des Brettspiels Pentomino in die Finger. Der englische Rätselmacher Henry Ernest Dudeney hatte das Spiel entwickelt. Ein Dutzend Spielsteine musste so in ein rechteckiges Spielfeld einsortiert werden, dass unter Nutzung aller zwölf Spielsteine die komplette Fläche des Spielfeldes bedeckt war.
Die Spielsteine selbst bestanden aus fünf quadratischen Elementen. Die Form der Spielsteine ergab sich automatisch; sie musste der Regel folgen, dass sich die einzelnen quadratischen Elemente immer mit einer vollen Kante berühren.
Je größer die auszufüllende Fläche, desto mehr Lösungen gab es: Bei einem Spielfeld von drei mal zwanzig Quadraten gab es nur zwei Möglichkeiten, alle zwölf Spielsteine auf der Fläche unterzubringen; bei einer Fläche von sechs mal zehn Quadraten waren es schon über zweitausend mögliche Lösungsvarianten.
Paschitnow mischte die Spielsteine gut durch und versuchte, sie alle auf dem Spielfeld unterzubringen. Dabei merkte er, dass das gar nicht so einfach war, wie es sich angehört hatte. Der Mathematiker in ihm war erwacht.
Er setzte sich an seine Elektronika 60 und versuchte, das Spiel in eine Computerfassung umzusetzen.
Verschiedene Versionen wurden verworfen, als er endlich eine Variante entwickelte, bei der die Spielsteine nur noch aus vier statt aus fünf Quadraten bestanden. „Tetra“, das griechische Wort für Vier, stand Pate für den Namen seines Spiels: Tetris.
Da Paschitnow sich auf vier Elemente bei einem Spielstein beschränkte, kam er nicht auf das volle Dutzend an Spielsteinen, sondern nur auf sieben Stück.
Auch das Spielprinzip änderte er leicht ab. Der Computer sollte eine dieser sieben Formen zufällig auf dem Bildschirm generieren, wo sie von oben herab ins Spielfeld rutschten – auf einfacher Schwierigkeit langsamer, auf höherer Schwierigkeit schneller. Platzierte man die drehbaren Spielsteine so, dass eine lückenlose, horizontale Reihe entstand, verschwand diese: Erfolg. Entstanden Lücken, wuchs der Blockhaufen immer weiter an, bis er den oberen Rand des Spielfelds erreichte: Spielende, leider verloren.
Die technischen Möglichkeiten des Elektronika 60 waren mehr als bescheiden. Paschitnow konnte die Spielsteine nur als rudimentäre Strichzeichnungen darstellen, deren Bewegungen von heftigem Flackern begleitet wurden.
Sonderlich viel Speicher benötigte das Spiel schon damals nicht: Die Pascal-Version kam auf ganze sechzehnhundert Zeilen Code und benötigte kompiliert nicht mehr als siebenundzwanzig Kilobyte.
Er wandte sich an den jungen Hacker Vadim Gerasimov, einem sechzehnjährigen Schüler, der sich selbst in Rekordzeit die Programmiersprachen Pascal und Basic beigebracht hatte, Microsofts DOS aus dem Handgelenk beherrschte und selbst angeblich unknackbare Kopierschutzmechanismen entschlüsseln konnte.
Gemeinsam mit Gerasimov tüftelte Paschitnow im Sommer 1985 zwei Monate lang an einer Farbversion für IBM-kompatible Computer, um das Spiel einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen zu können. Schließlich war es irgendwann geschafft, Paschitnows Kollege Dmitri Pewlowsky fügte noch eine Punktestands-Anzeige hinzu und Tetris lief farbig und fehlerfrei auf allen IBM-Rechnern.
Paschitnow machte Kopien und verteilte diese in der kompletten Akademie. Wie ein Virus griff das Spiel um sich – ein Virus, der aber die Mitarbeiter befiel und nicht die Computer. Gearbeitet wurde bald kaum noch in der Moskauer Akademie der Wissenschaften.
„Es breitete sich aus wie ein Steppenfeuer“, erzählte Paschitnow wenige Jahre später.
Er sprach Viktor Brjabin an, seinen direkten Vorgesetzten an der Akademie. Könnte man Tetris nicht ins Ausland verkaufen?
„Aber bei uns gab es damals kein Urheberrecht“, erklärt Paschitnow. „Jedem gehörte alles. Es gab kein persönliches geistiges Eigentum und somit auch nicht die Möglichkeit, mit solchen Dingen persönlichen Gewinn zu erzielen.“
Brjabin war trotzdem so begeistert von Tetris, dass er eine Diskette davon an das SZKI in Budapest schickte, das ungarische Institut für Computerwissenschaften.
Dort hielt sich damals zufällig auch Robert Stein auf, Boss der Londoner Spieleschmiede Andromeda. Der gebürtige Ungar, der bisher nur Software für Commodore-Rechner verkauft hatte, gründete das Unternehmen 1982 in England, um die Programme ungarischer Software-Unternehmen in Westeuropa zu vertreiben. Einer seiner größten Abnehmer war Mirrorsoft, eine Tochter des britischen Medienkonzerns Maxwell.
An diesem Tag im Jahr 1986 war Stein mal wieder in Ungarn, um sich über neue Programme zu informieren, als auf irgendeinem Bildschirm Tetris lief. Die ungarischen Programmierer hatten mittlerweile Konvertierungen des Spiels auf C64- und Apple-Systeme entwickelt.
„Ich bin ja eigentlich gar kein Spieler, aber von dem Spiel kam ich nicht weg“, sagt Stein.
Er erfuhr, dass Tetris ursprünglich aus Russland stammte und schickte ein Fax an die Moskauer Akademie, in dem er sein Interesse an Tetris bekundete.
„Da will einer Ihr Spiel haben“, sagte Brjabin, als er Paschitnow das Schreiben gab.
„Das war natürlich absolut unbekanntes Terrain für uns“, erzählt Paschitnow heute. „Wir hatten alle keine Ahnung, wer, wie was und wo. Also musste ich die Sache irgendwie selber in die Hand nehmen.“
Es dauerte Wochen, bis er einen Kollegen gefunden, der des Englischen mächtig war und das halbe Dutzend Genehmigungen beisammen hatte, um ein Faxgerät benutzen zu dürfen.
„Ja, wir sind an einem Vertrag interessiert“, lautete Paschitnows Antwort.
Stein war aber schon längst einige Schritte weiter.
Er hatte Mirrorsofts amerikanischer Schwesterfirma Spectrum Holobyte in Kalifornien ein Exemplar geschickt, nachdem die Briten kein Interesse gezeigt hatten. Spectrum Holobyte hatte sich bisher hauptsächlich durch Militärprogramme und die Flugsimulation Falcon einen Namen gemacht – jetzt waren die Inhaber nicht mehr von Tetris wegzubekommen.
„Besorgen Sie mir die Rechte“, ließ der Chef von Spectrum Holobyte seine Kollegen bei Mirrorsoft wissen.
Mirrorsoft und die amerikanische Tochter erwarben bei Robert Stein also alle Rechte – mit Ausnahmen der für Spielhallenversionen und Handvideospiele. Der bekam einen Vorschuss von dreitausend britischen Pfund, allerdings auch das Recht auf Tantiemen je nach Verkaufserfolg von sieben bis fünfzehn Prozent.
Stein faxte im November 1986 sein Angebot nach Moskau: Drei Viertel seiner Erlöse plus zehntausend Dollar Vorschuss. Eine Woche später trudelte das Antwortfax des Leiters von Paschitnows Computerzentrum ein: Einverstanden. Stein wollte teilweise mit C64-Computern bezahlen, auch damit war man in Moskau einverstanden. Beide Parteien waren sich einig, nur über die IBM-kompatible Version des Spiels zu verhandeln.
Die Lizenzabteilung der Akademie der Wissenschaften übernahm alle weiteren Verhandlungen und lud Stein im Dezember 1986 nach Moskau ein.
Dieser traf nicht nur mit dem Ziel ein, mit einem unterschriebenen Lizenzvertrag für Tetris heimzufahren, sondern wollte auch noch eine Kooperation ähnlich wie mit dem SZKI in Budapest vereinbaren.
Die Russen jedenfalls feilschten tagelang mit Stein über Tantiemen und Vorauszahlungen, so sehr, bis Stein entnervt das Handtuch warf und ohne unterzeichnete Verträge die Heimreise antrat.
Er hatte kurz den Gedanken, sich um die Lizenzen der C64-Version zu bemühen, die ungarische Programmierer beim SZKI erstellt hatten. Als er aber mit Spectrum Holobyte und Mirrorsoft sprach, verwarf er diese Idee schnell wieder, denn die Vermarktungsmaschine war im Begriff, anzulaufen. Die Verpackung war bereits designt, ein knallroter Karton mit einem Druck der Sankt Basilius-Kathedrale, darüber in kyrillischer Schrift Tetris. Die kalifornischen Programmierer fügten noch Schlachtenszenen als Hintergrundbilder des Spielfeldes und eine Introsequenz zu, in der ein kleines Flugzeug auf dem Roten Platz landete: Eine kleine Anspielung auf den damals Aufsehen erregenden Kremlflieger Matthias Rust. Zusätzlich hatte man Hintergrundmusik eingebaut und eine Bosstaste, die das Spiel vom Bildschirm verschwinden ließ, sobald der Vorgesetzte ins Büro kam.
Im April 1987 schickte Stein wieder ein Fax nach Moskau und drängte auf Vertragsunterzeichnung. Er informierte weiterhin, dass alle Rechte der IBM-kompatiblen Tetris-Fassung an den Softwarezweig des britischen Medienkonzerns Maxwell, Mirrorsoft, und deren Schwester Spectrum Holobyte verkauft worden waren.
Im Juni unterzeichnete er den Lizenzvertrag mit den drei Häusern, in dem er versicherte, dass er der rechtmäßige Eigentümer aller Urheberrechte auf Tetris sei und frei über alle Lizenzvergaben entscheiden könne. Auch zu diesem Zeitpunkt hatte er immer noch keinen unterschriebenen Lizenzvertrag mit den Moskauer Wissenschaftlern vorliegen.
Im Dezember 1987 schrieb er nochmals nach Russland und forderte die Russen auf, ihm zumindest die Rechtmäßigkeit seines Deals mit Mirrorsoft zu bestätigen. Er bekam immer noch keine Antwort.
Mirrorsoft und Spectrum Holobyte ahnten von Steins Schwierigkeiten mit den russischen Urhebern natürlich nichts und brachten Tetris im Januar 1988 in Europa und den USA auf den Markt. Der Titel schlug ein und verkaufte sich sehr gut. Computer Gaming World schrieb: „Tetris ist täuschend einfach und macht schleichend abhängig:“
Alexej Paschitnow bekam von dem ganzen Hin und Her am allerwenigsten mit. Der Mathematiker tüftelte schon über seinem nächsten Programm, Biograph, das er für Unterrichtszwecke an russische Lehrstühle verkaufen wollte. Zufällig hörte er von einer neuen Behörde namens Elektronorgtechnica, kurz Elorg, deren Zweck der Im- und Export von Software aller Art war. Er unterhielt sich mit dem obersten Leiter Alexander Alexinko und erwähnte auch die Probleme, die ihm die Verhandlungen mit Robert Stein um die Tetris-Lizenzen machte, als ihm Alexinko ins Wort fiel.
„Sie haben da gar nichts zu verhandeln“, stellte er klar, „weder Sie noch die Akademie. Dieser Fall gehrt eindeutig in den Zuständigkeitsbereich der Elorg. Die Verhandlungen führen wir.“
Alexinko ließ sich den kompletten Schriftverkehr bringen und stellte schnell fest, dass Paschitnow viele Faxe missverständlich und zu offen formuliert hatte. Sofort war ihm klar, dass der Verkauf von Tetris unverzüglich gestoppt werden musste.
Stein, der immer noch keinen rechtsgültigen Lizenzvertrag über Tetris besaß, bekam es also mit der Elorg zu tun. Die teilte ihm lapidar mit, dass die bisherigen Verhandlungen über Tetris gegenstandslos...