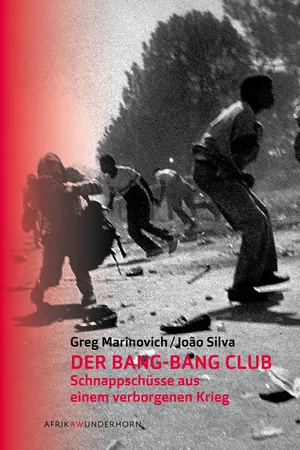![]()
1
DIE MAUER
Wenn ich nur erreichen könnte
Das Zuhause von des Todes Mutter
Oh, meine Tochter
Ich würde eine lange Fackel aus Gras machen …
Ich würde alles völlig zerstören, völlig …
Traditionelles Acholi-Beerdigungslied
Thokoza-Township, Südafrika, 18. April 1994
»Nicht ein Bild«, murmelte ich, als ich durch den Sucher meiner Kamera sah, wie Soldaten systematisch auf die Wohnanlage feuerten. Ich drehte mich um zu der Reihe schreckenerfüllter, zaudernder und schlecht ausgebildeter Soldaten, die direkt neben mir entlang der Mauer kauerten. Ihre Blicke huschten hin und her unter den Rändern ihrer Stahlhelme. Ich wollte diese Furcht einfangen. In der nächsten Minute traf mich ein Schlag – kräftig, hammerhart – in die Brust. Mir fehlt ein kurzer Moment, ein Herzschlag meines Lebens, aber dann fand ich mich auf dem Boden wieder, verdreht in den Beinen der anderen Fotografen, die neben mir arbeiteten. Schmerz durchzuckte meine linke Brust und breitete sich durch meinen Körper aus. Er ging weit über den Punkt hinaus, von dem ich dachte, dass Schmerz bis dahin reicht. »Mist! Ich bin getroffen, ich bin getroffen! Mist! Mist! Mist!«
Da das Maschinengewehrfeuer entlang der Mauer weiterging, zogen mich João und Jim an meiner Kamerajacke verzweifelt näher an die Mauer, suchten Schutz bei den Soldaten und außerhalb der Schusslinie. Dann durchdrang eine erregte Stimme die Geräuschkulisse: »Ken O ist getroffen!« Ich bemühte mich, meinen Kopf aus dem Gewirr der Kameras und Riemen um meinen Hals zu ziehen. Ein paar Meter rechts von mir konnte ich ein Paar langer, dünner Beine sehen, ohne Zweifel Kens Beine, die unter dem Unkraut hervorschauten, das an jener Betonmauer wuchs. Sie waren bewegungslos und standen in einem unmöglichen Winkel zueinander. Jim rannte rüber, wo Gary Ken schüttelte im Versuch, ein Lebenszeichen zu erhalten. Das unregelmäßige Krachen und Rattern des schnellen Maschinengewehrfeuers hallte durch die Luft um das Knäuel aus Journalisten und Soldaten, die versuchten, sich flach gegen die Mauer zu drücken.
Blut sickerte aus dem klaffenden Loch in meinem T-Shirt. Ich presste meine Hand auf das Loch, um das Bluten zu stoppen. Ich stellte mir die Austrittswunde der Kugel als ein tödliches, klaffendes Loch auf meinem Rücken vor. »Such nach einer Austrittswunde«, sagte ich zu João. Er nahm keine Notiz von mir. »Du wirst schon OK sein«, sagte er. Ich dachte mir, es müsste schlimm sein, wenn er erst gar nicht nachschauen wollte, und so, als würde das in einem blödsinnigen Kinofilm geschehen, bat ich ihn, meiner Freundin eine Nachricht zu übermitteln. »Sag Heidi, dass es mir leid tut … dass ich sie liebe«, sagte ich. »Sag’s ihr selbst«, schnauzte er zurück.
Plötzlich überkam mich ein Gefühl vollkommener Ruhe. Das war es. Ich hatte meine Schulden bezahlt. Ich hatte für ein Dutzend von Nahaufnahmen gebüßt, die immer jemanden verletzt oder tot zurückließen, während ich unversehrt mit Bildern in der Hand aus den Chaosszenen herauskam, jedes Mal das Verbrechen beging, ein glückvoller Voyeur zu sein.
Jim kam zurück, geduckt unter dem Schusswechsel, und flüsterte fürsorglich in mein Ohr: »Ken ist gestorben, aber du wirst OK sein«. João hörte das und stand auf, um rüber zu Ken zu rennen, aber andere waren schon bei ihm. Er hob seine Kamera. »Ken wird das später sehen wollen«, sagte er zu sich selbst. Er war ungehalten darüber, dass Kens Haare ins Gesicht hingen und das Bild ruinierten. João machte Fotos von uns beiden – zwei seiner engsten Freunde –, ich ausgestreckt auf dem zerbröselten Beton, meine Brust umklammernd; Ken, wie er von Gary und einem Soldaten unbeholfen hinten in ein Panzerfahrzeug gehievt wird, wobei sein Kopf wie der einer Stoffpuppe lose hin- und herbaumelt und seine Kameras nutzlos von seinem Hals hängen. Dann war ich dran, in den Panzerwagen geladen zu werden; Jim nahm meine Schultern und João meine Beine, aber ich bin groß, und Heidis Verwöhnung hatte noch mehr Kilos draufgelegt. »Du bist zu fett, Mann!«, witzelte João. »Ich kann gehen«, protestierte ich und versuchte zu lachen, aber seltsam eingeschnappt. Ich wollte sie auf das Gewicht der Kameras hinweisen.
Nach vier langen Jahren Gewaltbeobachtung hatten uns die Kugeln schließlich erwischt. Das Bang-Bang war gnädig gewesen, bis jetzt.
Früher an diesem Vormittag hatten wir auf den Seitenstraßen und in den Gassen des verwüsteten Niemandslandes im Thokoza-Township gearbeitet – Ken Oosterbroek, Kevin Carter, João und ich. Über die Jahre waren wir vertraut geworden mit den sich jagenden Auseinandersetzungen zwischen Polizei, Soldaten, modernen Zulu-Kämpfern und Kalaschnikows schleppenden Jugendlichen, als die Apartheid an ihr blutiges Ende kam.
Kevin war nicht bei uns, als die Schießerei stattfand. Er hatte Thokoza verlassen, um mit Lokaljournalisten über den Pulitzer Preis zu sprechen, den er für sein schockierendes Bild eines hungernden Kindes, das im Sudan von einem Geier bedrängt wird, bekommen hatte. Er war hin- und hergerissen, ob er gehen sollte. João hatte ihm geraten zu bleiben, denn obwohl gerade Kampfpause war, würden die Dinge bestimmt wieder hochkochen. Aber Kevin genoss seinen neugewonnenen Status als Berühmtheit und ging.
Beim Steak-Mittagessen in Johannesburg erzählte Kevin von seinem häufig knappen Entkommen. Nach dem Nachtisch sagte er den Journalisten, dass es diesen Morgen eine Menge Bang-Bang gegeben habe in Thokoza und dass er zurückfahren müsse. Während der Rückfahrt in das Township, etwa 16 Kilometer außerhalb von Johannesburg, hörte er in den Radionachrichten, dass Ken und ich angeschossen worden waren und dass Ken tot war. Er raste zum örtlichen Krankenhaus, in das wir gebracht worden waren. Kevin trug so gut wie nie Körperschutz, das tat keiner von uns, und João lehnte das rundweg ab. Aber am Eingang zum Township, bevor er das Krankenhaus erreichte, streifte sich Kevin seine kugelsichere Weste über den Kopf. Mit einem Mal spürte er Angst.
Die Jungs waren nicht länger unberührbar, und noch bevor die Blutspuren an der Betonmauer verblichen waren, sollte ein weiterer von uns tot sein.
![]()
2
»ACH, EIN PONDO – ER VERDIENTE ES ZU STERBEN«
Tod hat den Glücklichsten getötet
Tod hat den Glücklichsten getötet
Tod hat den Großartigen getötet, dem ich vertraute
Traditionelles Acholi-Beerdigungslied
17. August 1990
An einem sonnigen Frühlingsnachmittag 1990 mache ich im Alter von 27 Jahren die 25-Minuten-Fahrt nach Soweto, wo politisch motivierte Kämpfe ausgebrochen sind, und ich fühle, wie sich meine Kehle sachte zusammenzieht und ein Spannungsschauer von meinem Magen ausgeht und über meine Arme läuft, während ich das Lenkrad fester halte. Die Aufregung bereitet mir leichte Übelkeit; es ist wie von einem Albtraum aufzuwachen, dessen Einzelheiten man nicht mehr kennt, aber dessen Eindrücke noch nachwirken. Es ist eine unbestimmte Furcht: Ich bin irgendwie verängstigt, dass ich getötet werden könnte, erschrocken davor, was ich sehen könnte in dem Aufstand, der in den schwarzen Wohngettos explodiert ist, aber ich verstehe die Angst nicht recht. Ich habe auch keine Vorstellung davon, dass dies der Beginn eines neuen Lebens für mich ist.
Ich war – wie immer – in einem grünen, gut gepflegten Vorort des weißen Südafrika aufgewacht, hatte mich in einem weiß gefliesten Badezimmer gewaschen und mit heißem Wasser rasiert. Mein Haus wurde von einer schwarzen Frau saubergemacht, und an der Tankstelle war es ein schwarzer Mann, der mein Benzin nachfüllte und in der Hoffnung auf ein paar Cent Trinkgeld die Windschutzscheibe putzte. So war es schon mein ganzes Leben lang gewesen, trotz meiner intellektuellen Opposition zur Apartheid und meiner vorübergehenden Beteiligung an der Politik des Freiheitskampfs. Während ich aufwuchs, war mein Leben in den meisten Belangen typisch verlaufen für einen Englisch sprechenden weißen südafrikanischen Jungen.
Es gab in den 70ern eine sehr bekannte Werbemelodie, die gewissermaßen den Titelsong meiner Oberstufenjahre gab: »Wir lieben Grillpartys, Rugby, sonnige Himmel und Chevrolet / Sie gehören zusammen in der guten alten Republik Südafrika: Grillpartys, Rugby, sonnige Himmel und Chevrolet!« Dieses Liedchen brachte das Vertrauen der Weißen Südafrikas perfekt zum Ausdruck, geborgen in dem Paradies, das sie für sich selbst geschaffen hatten, trotz der internationalen Sanktionskampagnen, die unser Land isolieren und unsere Minderheitenregierung zwingen sollten, den Kurs der Apartheid zu widerrufen. Weiße Südafrikaner hatten sich zur Verteidigung in ein Laager zurückgezogen, gaben hohe Summen für die Symbole der Selbstgenügsamkeit aus und genossen außergewöhnliche materielle Vergütungen dafür, willfährige Wähler zu sein.
Ich kann nicht sagen, dass mich die Werbemelodie jemals beleidigt hätte, während ich aufwuchs. Ich spielte gern Rugby und mochte den Reiz der kontrollierten Aggression. Ich hielt auch die sonnigen Himmel und mein privilegiertes Leben für selbstverständlich, wenn ich auf den dampfenden Kacheln rund um das öffentliche Schwimmbad nahe unserem Zuhause in dem Johannesburger Vorort lag. Ich dachte nicht an schwarze Teenager in überfüllten Slums ohne Zugang zu Schwimmbecken. Und es gab immer reichlich Grillfleisch, das von den üblichen Wochenend-Grillpartys übriggeblieben war, oder frisches Barbecue.
Die Eltern meiner Mutter waren katholische Kroaten, die in den 20ern aus Jugoslawien emigriert waren, und mein Vater tauchte in den 50ern in Südafrika auf. Ich wurde in einer ausschließlich weißen, Englisch sprechenden Gemeinde aufgezogen und besuchte durchschnittliche englische Schulen. Unser einziger Kontakt zu Schwarzen war der zum Dienstpersonal – Hausarbeiter, »Gartenjungen« und »Mülljungen«. Ich benutzte niemals das Wort »Kaffir« – den muslimischen Ausdruck für »Ungläubiger«, der über Jahrhunderte entstellender Verwendung zu Südafrikas verletzendstem rassischen Schimpfwort geworden war. Ich dachte nie daran, freitagnachts zum Kaffirprügeln zu gehen – ein Brauch, bei dem Gruppen betrunkener weißer Jugendlicher nach einzelnen Schwarzen Ausschau hielten, um sie niederzuschlagen. Ich wusste, dass in unserer Gesellschaft eine Krankheit wucherte, aber damals war mir ihr Ausmaß nicht klar. Ich hielt die Annehmlichkeiten der Apartheid für selbstverständlich. Wie die meisten meiner Zeitgenossen hatte ich darin versagt, die Situation der schwarzen Südafrikaner wahrzunehmen, den Unterschied zu sehen zwischen einer Township-Schule und meinem Anwesen mit grünem Rasen, und ich hatte keine Ahnung von dem Hunger in den Homelands – den ethnisch begründeten Reservaten, in die schwarze Menschen aus dem »weißen« Südafrika hinaus zwangsumgesiedelt wurden. Meine Mutter hatte mir Sinn für Gerechtigkeit und Fairness beigebracht, der vermutlich sicherstellte, dass ich zu einem »netten« Weißen heranwuchs: einem, der seinen Militärdienst leistete, Steuern zahlte und Verteidigungsanleihen kaufte und eine weniger rassistische, verhältnismäßig liberale Partei wählte, um sein Gewissen zu beruhigen. Ich war einer dieser blinden Taubstummen, die dafür sorgten, dass Südafrika genug Geld machte, um die Apartheid zu bezahlen, ohne dass ich mir jemals die Hände schmutzig machte, indem ich jemanden direkt unterdrückte.
Ich war gerade 16, als ich meine ersten Ferien ohne meine Eltern genoss und Rum und Mampoer Moonshine, selbstgebrannten Obstschnaps, am schönen Küstenstreifen im Süden von Natal ausprobierte, der für Weiße reserviert war. Es war während dieser Sommerferien, dass ich ein afrikaanses Bauern-Mädchen kennenlernte, dessen stumpfe Zehen meine Erziehung bezüglich der rassischen Widerwärtigkeit einleiteten, die unsere Gesellschaft untermauerte.
Meine Kumpel und ich spielten Fußball am Strand, und ein dünnes, langbeiniges Mädchen mit nussbraunen Augen und wehenden Haaren spielte mit. Sie hieß Michelle und spielte wie ein Junge. Als das Spiel so langsam zu Ende kam, blieben nur wir zwei noch übrig, die den Ball kickten. Michelle erzählte mir, sie habe mit den Kindern der schwarzen Arbeiter, die auf der Farm ihres Vaters arbeiteten, Fußballspielen gelernt. Sie zeigte mir ihre Zehen, verkrümmt und verbogen vom Barfußspielen auf unebenen Feldern des Farmlands. Mit Ironie sprach sie von ihren schwarzen Spielgenossen als Kaffirs. Ich war schockiert, aber dann verstand ich, dass ihr Wortgebrauch vergleichbar war mit der Art, wie sich schwarze Amerikaner das Wort »Nigger« angeeignet hatten, um ihm den Stachel zu nehmen. Sie war in einem der rassistischsten Bereiche der weißen Gesellschaft mit schwarzen Kindern aufgewachsen. Als Kind war es ihr erlaubt gewesen, mit den schwarzen Kindern zu spielen, aber jetzt, da sie älter wurde, wurde von ihr erwartet, ihre schwarzen Freunde aufzugeben. Die größte Furcht von Weißen war es, dass eines ihrer Mädchen mit einem schwarzen Mann schläft. Michelle war ein Teenager, der gegen seine Umgebung und eine Gesellschaft rebellierte, die in Rassismus festgefahren war.
Ich war verschreckt und fasziniert von ihrer Wut, gefangen von dem Gespür für soziale Ungerechtigkeit, die irgendwie außerhalb meiner Vorstadtwelt herumwaberte. Aber mein Leben war erfüllt von Schule, Sport, Alkoholexperimenten und Lernversuchen bezüglich dieser mysteriösen Wesen, die Mädchen genannt wurden.
Als ich an die Universität nach Pietermaritzburg ging, weit weg von zu Hause, in die Ostprovinz von KwaZulu-Natal, wurde ich mit sozialistischer Politik bekannt und betreute schwarze Schulkinder aus nahegelegenen Township-Schulen, die sich für ihre Schulabschlussprüfungen vorbereiteten. Von ihnen lernte ich die damals gebannte Hymne, das Freiheitslied »Nkosi Sikelel’ iAfrika«. Die ausschließlich weiße Universität war überflutet mit giftigen Studenten vom rechten Flügel, wovon viele vor der schwarzen Herrschaft im neuerdings unabhängigen Simbabwe geflohen waren, dem früheren Rhodesien nördlich von uns. Südafrikaner nannten sie »Als Wirs«, weil sie gewöhnlich darüber jammerten, wie gut alles gewesen war, »Als wir in Rhodesien waren …«. Man konnte sie im Allgemeinen an ihren Kleidern erkennen: kurzärmlige Hemden, Rugby-Hosen, lange Socken und Wanderschuhe. Von ihnen hörte ich zum ersten Mal den Ausdruck »Sauerstoffverschwender« als Bezeichnung für schwarze Menschen, und das schockierte mich. Bald war ich in einige Schlägereien und andere hässliche Auseinandersetzungen verwickelt. Nach der Osterpause im April hörte ich, dass ich nominiert worden war, Rugby in der U-20-Provinzauswahl zu spielen. Obwohl ich sehr gern in diesem Team spielen wollte, hatte ich mich doch schon dafür entschieden, den Sport aufzugeben – der im Rugby um sich greifende Rassismus deprimierte und ärgerte mich viel zu sehr. Ich fing sogar an, jedes Team anzufeuern, das gegen die südafrikanische Nationalmannschaft spielte – die Springboks, denen ich ihre Siege nicht gönnte.
Keine fröhliche Werbemelodie konnte jemals die anderen, dunkleren Kräfte zum Ausdruck bringen, die mein Leben formten. Meine Eltern führten eine furchtbare Ehe, voller Streit, Schläge und Abscheu. Sie wurden geschieden, als mein Bruder und ich noch sehr jung waren, und meine Kindheitstage waren niemals glücklicher, als sie endlich getrennt waren. Ich lebte bei meiner Mutter, Franka, während mein Bruder bei meinem Vater blieb, Mladen. Es war eine schöne Zeit: Sie und ich renovierten Möbel bis in die frühen Morgenstunden, und wenn ich zu müde für die Schule war, schrieb sie falsche Entschuldigungen wegen Übelkeit.
Aber meine Eltern kamen einige Jahre später wieder zusammen, und die Streitereien und Kämpfe begannen von neuem. Es gab Wochen, in denen die Dinge gut liefen, aber dann griff meine Mutter zum Whisky, und das reichte, damit sie sich von einer liebevollen Frau – großzügig, fürsorglich und vergnügt – in jemanden verwandelte, der keinem Streit ausweichen konnte. Mein Vater war ein von Geld besessener Tyrann, der die ganze Zeit zu viel trank und seine Frau wörtlich und physisch missbrauchte. Wann immer es danach aussah, dass Streit begann, spürte ich, wie sich in meinem Magen Angst aufbaute, eine grässliche Furcht vor Gewalt, weit jenseits meiner emotionalen Möglichkeiten, damit umzugehen. Ich erinnere mich noch sehr lebendig an das erste Mal, als es mir gelang, meine Furcht vor meinem Vater zu überwinden. Ich war um die 14 oder 15. Es war an einem Wochenende, und sie waren beide betrunken. Ich hatte den Beginn des Streits nicht mitbekommen, aber er dauerte schon eine Weile – und dann begann er sie zu schlagen. Ich war erschrocken und wütend, aber entschlossen einzugreifen. Für Mladen war dies eine Bedrohung seiner Männlichkeit – er duld...