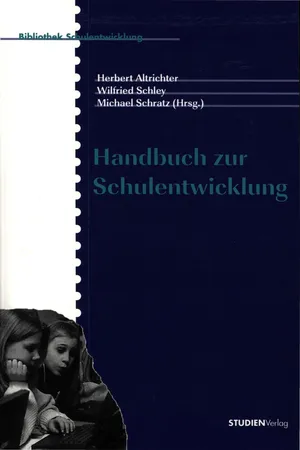![]()
Teil 1
Akteure, Prozeßkomponenten und Gestaltungsformen
![]()
Wilfried Schley
Change Management: Schule als lernende Organisation
1. Wie lernen Organisationen?
Schulen sind in Bewegung gekommen. Schulen ändern sich, d.h. sie reformieren ihr Profil, ihr Programm, ihre Methoden, sie entwickeln neue Formen der Kooperation mit den Eltern, öffnen sich gegenüber den Gemeinden, den Stadtteilen und untereinander. Ganz gleich, ob es aufgrund von Druck oder Zug, von innen oder außen kommend, aus einem Bedarf oder Bedürfnis heraus geschieht (vgl. Schratz/Steiner-Löffler 1998), Schulen haben vielfältige Anlässe gefunden, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Die Aufgabe der Schulentwicklung ist mehr und mehr als eigene Entwicklungsaufgabe der Schulen erkannt und anerkannt.
Die zunehmend drängender werdenden Fragen der knappen materiellen Ressourcen bei steigenden inhaltlichen Anforderungen und Erwartungen beschreiben das konflikthafte Kräftefeld, in dem sich diese Aufgabe abspielt. Die Schulaufsicht driftet mit ihren Aufgaben in Richtung Schulberatung. Eine neue Profession der Schulberater und Moderatoren hat sich entwickelt, und auch die Lehrerbildung wird vom Thema der Schulentwicklung bestimmt.
Entgegen aller Immobilitätsthesen haben sich Schulen als erstaunlich lernfähig und wandlungsfähig erwiesen, haben neue Funktionen übernommen, Integrationsaufgaben bewältigt und die internen Strukturen weiterentwickelt.
Dennoch: Lust und Frust liegen dicht beieinander. Was den einen gut gelingt, scheitert bei den anderen, wo sich auf der einen Seite Freiwilligkeit erreichen läßt und sich Motivationen entwickeln konnten, versandet der Prozeß auf der anderen Seite oder kommt gar nicht erst in Gang.
Die sprunghaft gewachsene Zahl der Veröffentlichungen zum Change Management, zur Veränderung in Organisationen, zum organisatorischen Lernen in allen Lebens- und Arbeitsbereichen verweisen auf eine letztlich noch nicht bewältigte, aber für lösbar gehaltene Aufgabe. Trotz vieler gelungener Beispiele überwiegt allerdings immer noch der programmatische Charakter der neueren Publikationen (Morgan 1997, Senge 1996, Argyris 1996, Handy 1993, Glasl/Lievegoed 1996, Doppler/Lauterburg 1996, Reiß/v. Rosenstiel/Lanz 1997).
Das Schlüsselthema in allen Projekten, Prozeßreflexionen und Veröffentlichungen stellt die Frage dar: Wie gelingt der strukturelle, organisatorische und inhaltliche Wandel? Wie erreichen wir eine mentale, aktionale und emotionale Neuorientierung? Wie schaffen wir damit eine nachhaltige Reform? Wie können dabei die Betroffenen zu Beteiligten werden? Letztlich läuft die gesamte Fachdiskussion darauf hinaus,
• rationale und emotionale Faktoren zu verbinden (Problemlösung und emotionale Intelligenz),
• Strukturfragen zu lösen und Kulturentwicklung zu betreiben,
• Leistungskompetenz zu stärken und Mitarbeiterbeteiligung zu ermöglichen.
Der Umgang mit Komplexität und systemeigenen Widersprüchen steht im Mittelpunkt. Dabei geht es nicht um Systemanalyse als Diagnose- und Erkenntnisprozeß, sondern um die zielgerichtete, systematische, prozeßorientierte Intervention als eigene soziale Handlungsform.
1.1 Bilder der Organisation
Während in der Zeit des Wiederaufbaus nach dem 2. Weltkrieg Familienmodelle der Organisation den Zeitgeist am treffendsten zum Ausdruck brachten und patriarchalische Kulturen die stärkste Bindung und Identifikation erreichten, wurden später andere Bilder zu Orientierungen.
Die technokratische Moderne versprach ein hohes Maß an Rationalität. Veränderungsprozesse brauchten nur in Ist-Soll-Differenzen operationalisiert zu werden und schon schien es möglich, entlang eines Zeitkontinuums die Veränderung und die Umsetzung durchzuführen. Damit sollte gleichzeitig auch die Abhängigkeit von „väterlichen“ Leitfiguren überwunden werden. Das Prinzip hieß Rationalität, ihre Methoden Projektarbeit, Problemlösung und Controlling.
Eine andere Variante der Gegenbewegung zum autokratischen Grundverständnis formulierte sich im Gedanken der Autonomie. Selbstbestimmt leben und arbeiten hob gleich zwei Negativbilder auf: Abhängigkeit und Entfremdung. Dem entsprechend wurden offene Formen bevorzugt, um einen Wandel herbeizuführen: Initiativen, Lernwerkstätten, Workshops. Die negative Seite dieser offenen Strukturen, die ja befreien sollten von Bevormundung und Fremdbestimmung, wurde in vielen sozialen und pädagogischen Institutionen deutlich: z.B. in Beratungsstellen ohne ein gemeinsames Konzept, aber mit vielen interessanten Einzelansätzen oder in Schulen mit einem bunten Nebeneinander offener, projektartiger, klassischer, erweiterter, integrierter, ganzheitlicher etc. Lernformen.
Konsens zu bilden fällt immer noch schwer. Einigung klingt vielen nach Einordnung und Funktionieren nach Vorgaben. Und hier taucht wieder ein Negativmodell auf: Arbeit nach dem Maschinenmodell der Organisation mit klaren Input-Output-Relationen. Niemand möchte gern ein Zahnrad im Getriebe sein und wie geölt funktionieren. Damit bleiben als Entscheidungsmechanismen demokratisch erscheinende Mehrheits-Minderheits-Abstimmun-gen oder offene unverbindliche Handlungsrahmen mit Individualver-antwortung.
Bereits Begriffe wie Organisation, Organisationsentwicklung, Change Management klingen vielen Pädagogen schrill im Ohr. Das gehört in Unternehmen, die Profit zu erwirtschaften haben, aber nicht in Schulen. Demgegenüber wird dann eine Theaterwerkstatt oder eine Künstlervereinigung als Analogie sehr geschätzt. Aber auch diese weisen ihre Mängel auf, ein Zuwenig an Struktur und Zuständigkeit, da haben manche Aspekte einer guten Bürokratie doch auch ihre Vorteile. Vor allem entfallen die bühnenreifen Selbstdarstellungen, ob sie nun gekonnt oder langweilig vorgetragen werden.
Es lohnt sich, die in einem Kollegium einer Schule, einem Team des Beratungszentrums, einem Gremium der Schulaufsicht oder einer Einrichtung zur Lehrerbildung bestehenden Bilder der Organisation Schule einmal aufzunehmen und zum Gegenstand der Reflexion zu machen, um die darin enthaltenen Werte und Leitgedanken zu entschlüsseln. Organisationsbilder können Motivationen wecken und durchaus schon Teil des Diagnoseprozesses sein und eine Bereitschaft zur Entdeckung der „Wahrheit der Situation“ fördern.
Organisationen sind soziale Systeme, die – mit Sinn- und Existenzgrund versehen – relevante Aufgaben auf professionelle Weise wahrnehmen. Sie bilden dazu ineinandergreifende und aufeinander bezogene Subsysteme.
1.2 Was sind Systeme? Wie wirken sie?
Systeme sind Abstraktionen und Konkretionen zugleich:
• sie bilden Ordnungen: Klassen, Jahrgänge, Zweige, Niveaus ...
• sie strukturieren Aufgaben: Bildungspläne, Fächerinhalte ...
• sie regeln Abläufe: Aufnahmeverfahren, Klassenarbeiten, Prüfungen ...
• sie verbreiten Informationen: Unterricht, Lehr- Lernformen, ...
• sie entwickeln eigene Kulturen: Schulklima, Schulkultur, Lernkultur ...
• sie reduzieren Komplexität: Unterrichtseinheiten, Stunden ...
• sie durchlaufen Phasen: Pionier-, Differenzierungs-, Integrations-, Transformationsphasen.
Systeme haben ihre eigene Dynamik, charakteristische Muster der Problembewältigung, sie entfalten sich, haben Blütezeiten, Übergänge und Krisen.
Systeme sind lebendige, funktionsfähige Einheiten, die in den Schulen aus kommunizierenden und kooperierenden Menschen bestehen, die damit gesetzte Aufgaben wahrnehmen, bestimmte Zwecke verfolgen und spezifischen Zielen dienen. Die Systemabstraktionen konkretisieren sich in Menschen: Lehrkräfte, Schüler, Eltern, Schulaufsicht, Dienstleister. Die Menschen sind es, die Schulen machen. Schule ist eine komplexe Organisation, die Struktur und Kultur, Formelles und Informelles, Geplantes und Spontanes, Vorgabe und Freiheit verbindet. Das macht sie vielseitig, entwicklungsoffen und gestaltbar.
1.3 Fallstudien I
Fall 1: Veränderung der Stundentafel
An einem humanistischem Gymnasium mit einer langen Tradition hat sich eine Diskussion über das Profil und die zukünftigen Schwerpunkte entwik-kelt. Eine Arbeitsgruppe zur Reform der Stundentafel hat sich nach langen Beratungen zu einem Vorschlag durchgerungen, im 8. Schuljahr eine weitere Wochenstunde im Fach Chemie anzubieten und das Kontingent den Stunden für Latein zu entnehmen.
Die Ausarbeitung war gut begründet, mit Hinweisen auf Elternerwartungen versehen und mit Standortfaktoren begründet. Die Stadt, in der sich die Schule befindet, lebt von der Chemie. Naturwissenschaften haben einen hohen Stellenwert.
Die Vorlage wurde gelobt, die Anstöße als interessant befunden. Doch letztlich fand sie keine Mehrheit. Nicht nur die Lateinlehrer – sie waren aus Gründen der Besitzstandswahrung dagegen –, sondern auch die anderen Sprachlehrer – sie solidarisierten sich – und weitere Fachvertreter – sie wehrten den Anfängen und folgten eigenen Befürchtungen – bildeten eine Ablehnungsgemeinschaft. Der Status quo wurde gewahrt und für mehrere Jahre einer Veränderung der Stundentafel der Boden entzogen.
Wie kam es zu diesem Scheitern?
Fall 2: Einführung einer landesweiten Reform
Die Grund- oder Primarschule soll die Eingangsbedingungen ins Bildungssystem sichern und zugleich für teilzeitberufstätige Mütter berechenbar sein. Das jedenfalls war das Rational, eine von allen Seiten grundsätzlich befürwortete Reform.
Die Einführung wurde in Schritten vorbereitet. Eine eigene Projektorganisation mit Projektleiter sollte die Umsetzung begleiten und steuern. Die inhaltliche Seite einer Veränderung des schulischen Angebots, der schulischen Zeitstruktur und die kollegiale Weiterbildung war bereits mitgedacht.
Nach kurzer Zeit brach über das Projekt eine umfassende Kritik herein, die den Zwangscharakter, die Art der Vorbereitung, die materiellen Vorgaben, die zusätzliche Arbeitsleistung und die mangelnde Beteiligung bereits bestehender Konzepte und Initiativen hervorhob.
Einige, in der Anfangsphase auf Veranstaltungen geführten Diskussionen und Auskünfte der Projektleitung sorgten für Verunsicherung und Irritation. Alles, was irgendwie falsch verstanden werden konnte, wurde auch falsch verstanden. Aus Weggefährten wurden Kontrahenten, aus motivierten Mitstreitern und Gestaltern wurden Nörgler und Verweigerer: So nicht!
Wieso konnte die Anfangsmotivation nicht erhalten werden? Was hat die Situation kippen lassen?
Fall 3: OE-Begeisterung an einer Fachschule, oder: Die Autonomie wird in die Schranken verwiesen
Eine über mehrere Jahre vom Scheitern bedrohte Fachschule für sozialpädagogische Berufe hatte Wind unter die Flügel bekommen. Die Anmeldungszahlen stiegen, es konnten in jedem Jahr zwei weitere Klassen eingerichtet werden. Ein neuer Leiter sorgte für eine systematische Zukunftsentwicklung, ein Schulentwicklungsprojekt unterstützte diese Neuorientierung, es kam Schwung auf.
Die Lernorganisation sollte innovativer werden, integrierte Praxisprojekte in Verbindung mit fächerübergreifender Projektstruktur bildete den Kern. Die Fachschule blühte auf und stel...