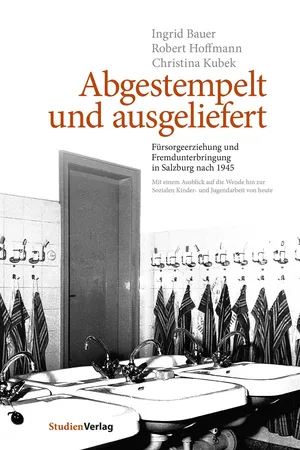![]()
VII. Jugendwohlfahrt1/Soziale Kinder- und Jugendarbeit im Längsschnitt: 1900–2000 Gesellschaftlicher Kontext, fachliche Diskurse, Institutionen und deren AkteurInnen
1. Jugendfürsorge von der Monarchie bis zum Nationalsozialismus
1.1. Vorsozialstaatliche Jugendfürsorge bis 1918 – Armenhäuser, Besserungsanstalten, Zufluchtshäuser
Eine zusammenfassende und epochenübergreifende Geschichte der Jugendwohlfahrtspflege bzw. der Jugendfürsorge – so der ältere Begriff – in Österreich existiert nicht. Auch für Salzburg finden sich bislang nur Untersuchungen über verwandte Bereiche des Fürsorgewesens wie etwa zur Geschichte des Armenwesens und der Altersversorgung oder bestimmter Fürsorgeinstitutionen.2 Eine Ursache dieses Mangels liegt darin, dass es vor dem Ersten Weltkrieg in Österreich eine den heutigen Gegebenheiten vergleichbare Jugendwohlfahrtspflege nicht gab. Die Aufsicht über arme, verwaiste und verlassene Kinder oblag ebenso wie die Armenversorgung im Allgemeinen den Gemeinden, denen im Übrigen auch das Vormundschaftswesen bei unehelich Geborenen übertragen war. Da die Gemeinden zumeist über keine oder zu wenige eigene Anstalten für die Unterbringung von Kindern und Jugendlichen verfügten, erfolgte deren Betreuung vielfach in geistlichen Institutionen. Nicht scharf davon getrennt war die Fürsorgeerziehung von sogenannten verwahrlosten und schlimmen Kindern, die zumeist ebenfalls in geistlich geführten Erziehungsanstalten und „Rettungshäusern“, oder aber – sofern es sich um straffällig gewordene Jugendliche handelte – in zuchthausähnlichen Anstalten verwahrt wurden.
Allein für Salzburg listet das erzbischöfliche Personalstands-Verzeichnis von 1910 zehn geistlich geführte Erziehungsanstalten auf, die überwiegend zur Unterbringung von weiblichen Zöglingen vorgesehen waren:3
• Anstalt zur Erziehung weiblicher Dienstboten, St. Sebastian, gegr. 1852, ca. 70 Zöglinge, unter der Leitung der Barmherzigen Schwestern;
• Mädchen-Waisenhaus zu Mülln, 1858 wiederbergründet, 70 Zöglinge, unter der Leitung der Barmherzigen Schwestern;
• Kinder Asyl zu Mülln (1886), unter der Leitung der Barmherzigen Schwestern;
• Herz-Jesu-Institut zu Maxglan (1887) mit Mädchenerziehungs-Anstalt, 33 Zöglinge, unter der Leitung der Barmherzigen Schwestern;
• Mädchen-Asyl (1873), Nonnberggasse, 20 Kinder;
• Erziehungsinstitut der Schulschwestern in Hallein (1723), u. a. Kinderbewahranstalt (90 Kinder) und Erziehungsinstitut (38 Zöglinge);
• Kinderbewahr-Anstalt (1853), Salzburg;
• Zufluchtshaus zum hl. Josef, errichtet 1888, mit Mädchen-Besserungsanstalt;
• Knaben-Erziehungsanstalt in der Edmundsburg, gegr. 1853, seit 1878 unter der Leitung der Kreuzschwestern, 129 Zöglinge; in dieser Anstalt wurden „Knaben im Alter von 6 bis 12 Jahren aufgenommen, vornehmlich solche, welche der Gefahr der Verwahrlosung ausgesetzt wären“;4
• Schul-Knaben-Asyl (Johanneum), 100 Zöglinge.
Als „Besserungsanstalt“ im eigentlichen Sinn scheint um 19005 im Salzburger Raum somit nur das Zufluchtshaus St. Josef auf, das 1880 vom St. Josefsverein gegründet und zunächst von Franziskanerinnen geführt wurde. 1885 befanden sich bereits 75 Mädchen in der an der Hellbrunner Straße neu errichteten Anstalt. Selbst am Höhepunkt des Kulturkampfes nutzte die liberale Salzburger Gemeindevorstehung St. Josef ganz selbstverständlich zur Unterbringung der „verwahrlosten weiblichen Jugend“.6 Nur nebenbei sei erwähnt, dass die Benediktiner von St. Peter seit 1890 das Josefinum in Kleinvolderberg in Tirol als eine private Besserungsanstalt für Knaben betrieben.
Die Monopolstellung der katholischen Orden und Kongregationen im Fürsorgeerziehungswesen war eine unmittelbare Folge des mangelnden staatlichen Engagements in der Jugendwohlfahrtspflege. Zwar bemühte sich die von einem sozialreformerischen Geist getragene Kinderschutz- und Jugendfürsorgebewegung um eine Reform der Jugendfürsorge, etwa am Ersten österreichischen Kinderschutzkongress 1907 in Wien, auf dem entschiedene Maßnahmen zur Abhilfe des Kinderelends gefordert wurden. Ein Gesetzesentwurf über die Fürsorgeerziehung gelangte im Reichsrat jedoch nicht zur Beschlussfassung. Reformiert wurde zunächst nur das Vormundschaftswesen, indem eine Abkehr von der bisherigen Praxis der von der Gemeinde bestellten privaten Vormünder erfolgte und 1910 das Amt der Berufsvormünder nach dem Vorbild des damaligen Deutschen Reiches begründet und den Bezirksverwaltungsbehörden bzw. den Magistraten unterstellt wurde.
Wie antiquiert die Jugendfürsorge im Kronland Salzburg zu dieser Zeit noch war, geht aus einem „Bericht des Landesausschusses des Herzogtumes Salzburg betreffend das Armenversorgungswesen im Kronland Salzburg“ hervor:
„Anlangend die Versorgung der armen Kinder einer Gemeinde, für welche diese selbst die Obsorge übernommen hat, wird folgendes bemerkt: Diese Kinder sind größtenteils auf Stiftplätzen untergebracht. Den Gemeindevorstehungen wurde warm ans Herz gelegt, auf die Vertrauensmänner einzuwirken, daß sie für die Pflegekinder gute Plätze ausfindig machen und sich wiederholt im Jahre davon überzeugen, ob die Verpflegung derselben eine einwandfreie ist. (…) In einem besonderen Falle wurde durch die Revision festgestellt, daß ein Kind durch die Unterbringung in einem schlechten Pflegeplatze geistig und körperlich Schaden gelitten hat (…).“7
Vielfach waren Kinder auch in Armenhäusern untergebracht, wobei es der Landesausschuss als „erfreuliche Erscheinung“ ansah, „daß auch in kleinen Gebirgsgemeinden solche Armenhäuser entstehen“.8
Die neugeschaffenen Berufsvormundschaften erstreckten sich auf Kinder, die sich in Gemeindepflege befanden, also auf Waisenkinder, uneheliche Kinder sowie Ziehkinder, wobei die beamteten Vormünder von den Vormundschaftsgerichten bestellt wurden. Für die Betreuung der Mündel konnten die Berufsvormünder – vorerst allerdings nur in Wien – Fürsorgerinnen heranziehen. Wesentliche gesetzliche Veränderungen in der Jugendwohlfahrtspflege erfolgten erst während des Krieges, wie die Einführung sog. Generalvormundschaften nach deutschem Vorbild im Jahr 19169, welche von neu zu schaffenden Bezirksjugendämtern auszuüben war. Von nun an wurde nicht mehr ein bestimmter Vormund als Person einem bestimmten Mündel zugeordnet, sondern die Vormundschaft wurde einer bestimmten Behörde – nämlich dem Bezirksjugendamt – übertragen, wobei das Amt des Generalvormundes durch dessen Leiter – meist ein rechtskundiger Beamter – und die ihm zugeordneten Berufspflegerinnen auszuüben war.10 Zur Gründung von Bezirksjugendämtern kam es vorerst aber nur in Wien und Graz, wobei die Generalvormundschaft in Wien tatsächlich erst im Jahr 1922 eingeführt wurde.11
1.2. „Dringende Notwendigkeit der Errichtung solcher Stellen“ – Von der Gründung des Landesjugendamts bis zum Anschluss
Weitere Reformschritte erfolgten während der kurzen Phase des sozialpolitischen Aufbruchs nach dem Ende des Ersten Weltkriegs. Zunächst wurde mit der Ziehkinderverordnung von 1919 die Einrichtung von Ziehkinderaufsichtsstellen veranlasst, deren Tätigkeitsbereich in jenen der gemäß Bundesverfassungsgesetz von 192012 zu gründenden Landesjugendämter integriert werden sollte. Im Bundesverfassungsgesetz wurde die heute noch geltende Regelung gefunden, dass die Richtlinienkompetenz auf dem Gebiet der „Mütter-, Säuglings- und Jugendfürsorge“ beim Bund liegt, die Ausführungsgesetzgebung und Vollziehung hingegen den Ländern zusteht. In Konsequenz dieser Bestimmung erfolgte bis 1924 in allen Bundesländern außer dem Burgenland, Tirol und Vorarlberg die Einrichtung von Landesjugendämtern, welche als zentrale Behörden die Agenden der Jugendwohlfahrtspflege übernahmen. Da der Bund aufgrund des Widerstands der Länder, die einer weitergehenden Verstaatlichung der Fürsorgeagenden ablehnend gegenüberstanden, in der gesetzten Frist bis 30. September 1928 keine eigene Grundsatzgesetzgebung in Sachen „Armenwesen“ und „Mutterschafts-, Säuglings- und Jugendfürsorge“ erließ, blieb die Jugendwohlfahrts-Gesetzgebung der Zwischenkriegszeit letztlich ein Torso. Nur nebenbei sei erwähnt, dass ein 1928 bereits vorliegender, dann jedoch nicht beschlossener Regierungsentwurf für ein Jugendwohlfahrtsgesetz sich in wesentlichen Inhalten an das deutsche Reichsjugendwohlfahrtsgesetz von 1922 angelehnt hätte.13 In der Ständestaatsverfassung wurde die Jugendfürsorge schließlich aus Ersparnisgründen zur Gänze aus dem Wirkungskreis des Bundes gestrichen.
In Salzburg erfolgte die Gründung des Landesjugendamts erst im Jahr 1922. Den Grundstock des Amtes bildeten die bereits 1919 eingerichteten Ziehkinderaufsichtsstellen, „die auch die Arbeiten nach dem Jugendgerichtshilfe- und dem Kinderarbeitsüberwachungsgesetz leisteten“ sowie die vom amerikanischen Roten Kreuz 1921 eingerichteten Mutterberatungsstellen.14
Nach einem Tätigkeitsbericht aus dem Jahr 1938 wurden diese „Zweige der Jugendfürsorge“ damals zusammengefasst und zu Bezirksfürsorgestellen des Landesjugendamtes ausgebaut und zwar so,
„daß sämtliche Zweige der sozialen und Gesundheitsfürsorge, wie sie im Statut des Landesjugendamtes festgelegt sind, bearbeitet wurden, insbesondere wurde als wichtiger Faktor der sozialen Fürsorge die Berufsvormundschaft als Teil der Fürsorgestelle an den wichtigsten Punkten des Landes eingerichtet“.15
Das neugeschaffene Landesjugendamt wurde „in kleinstem Umfange“ als selbständiges Amt der damals für alle Angelegenheiten der sozialen Fürsorge zuständigen Abt. 2 (später Abteilung III) der Landesregierung zugeordnet, wobei Abteilungsleiter Dr. Oskar Hausner zugleich auch als Jugendamtsleiter fungierte. Neben Hausner scheinen in den Amtskalendern der Zwischenkriegszeit Dr. Helmut Hirschal,...