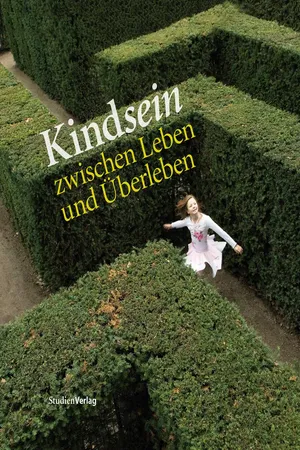![]()
Sophies stille Präsenz
Sophies Zimmer liegt im Erdgeschoß, direkt neben dem nachträglich eingebauten Bad. Ihr Bett steht am Fenster. Ein luftiger Store taucht ihr Zimmer in ein warmes Hellgelb. Vor dem Zimmerfenster stehen Bäume. Die Gärten der anderen Häuser sind zu sehen. Es ist still. Nur Sophies langsamer, raschelnder Atem ist zu hören. Sophie liegt mit geschlossenen Augen reglos in ihrem Bett. Gehüllt in weiche Polster und eine anschmiegsame Decke. Alles in zartem Gelb. Ein Bild von ihren FreundInnen aus dem Beschäftigungsprojekt steht in einem bunten Rahmen am Nachtkästchen. Ein Geschenk zu Sophies 20. Geburtstag. „Liebe Sophie, alles Gute zu Deinem Geburtstag wünschen Dir Deine Freunde aus der Lebenshilfe“, steht auf der Karte geschrieben. Unterzeichnet mit vielen wackeligen Handschriften. Bilder hängen an der Wand und zeigen Sophie als kleines, quirliges Mädchen. Von ihrem strahlenden Wesen ist nichts mehr zu spüren. Sophie schläft viel. Für Außenstehende wirkt es, als ob sie nie wirklich wach wäre. Sie meinen ihr Blick bliebe nirgends haften und ihre Augen wirkten leer. Aber nicht für mich, wir beide haben eine enge Verbindung. Wir kommunizieren ohne Worte, denn Sophie kann nicht mehr sprechen, obwohl es manchmal den Anschein hat, als bewege sie ihre Lippen.
Da sich Sophie nicht mehr ausdrücken kann, erzähle ich, ihre Kinderdorf-Mutter, ihre und unsere Geschichte: Sophie ist mit sieben Jahren ins Kinderdorf gekommen. Bis zu diesem Zeitpunkt lebte sie bei ihrer Großmutter, die ihre schwer kranken Töchter, Sophies Mutter und Tante, pflegte. Sophies Großmutter hat das Mädchen sehr geliebt und sich so um sie gekümmert, wie es in ihrer Macht stand. Aber durch die intensive Pflege der beiden erwachsenen Töchter war für ihre Enkelin kaum mehr Kraft und Zeit übrig. Vier ihrer fünf Kinder litten an Chorea Huntington, einer tödlichen Erbkrankheit, die ihr den Mann und den Kindern den Vater nahm. Chorea Huntington wird als eine Mischung aus Multipler Sklerose, Parkinson und Alzheimer beschrieben. Die Krankheit wurde erst sehr spät in der Familie diagnostiziert. Auch Sophie zeigte Auffälligkeiten in ihren Bewegungsabläufen. Damals glaubte man aber, sie ahme ihre Mutter und Tante nach. Mit der Zeit wurden ihre Bewegungen immer unkoordinierter, teilweise fiel sie ohne ersichtlichen Grund zu Boden. Die Vermutung erhärtete sich, dass auch Sophie unter dieser Krankheit litt. Die folgenden Untersuchungen bestätigten diese Annahme.
Mit dem detaillierten Wissen über das Krankheitsbild und den tödlichen Verlauf, war es für Sophies damalige Kinderdorfmutter auf lange Sicht nicht denkbar, sich weiterhin um die damals Zehnjährige zu kümmern. Da zu dieser Zeit sowohl Sophies Mutter als auch Tante bereits in einem Pflegeheim waren, hätte sich Sophies Kinderdorfmutter gewünscht, dass sie wieder nach Hause zu ihrer Oma zurückkehren könne. Diese Belastung wäre aber zu groß gewesen. Sophies Zustand war für ein Pflegeheim zu gut, aber keine andere Einrichtung würde sie mit dieser Krankheit aufnehmen. Von ärztlicher Seite gab es den Rat, Sophie in ihrem gewohnten Umfeld zu belassen, da jede Veränderung Stress für sie bedeute und Verschlechterungsschübe auslösen könne.
Chorea Huntington – Eine seltene Erkrankung bei Kindern und Jugendlichen
Chorea Huntington, auch unter dem Namen Huntington-Krankheit oder erblicher Veitstanz bekannt, ist eine vererbbare Nervenkrankheit. Es handelt sich um eine fortschreitende Erkrankung, die häufig innerhalb von einigen Jahren zu unkontrollierten Bewegungen, Demenz und Veränderungen des Charakters führt. In den meisten Fällen bricht Chorea Huntington zwischen dem 35. und 50. Lebensjahr aus, sehr selten jedoch bei Kindern und Jugendlichen. In Österreich gibt es etwa 500 Erwachsene und Kinder, die an Chorea Huntington leiden. Derzeit ist diese Krankheit noch unheilbar und führt zum Tod – wobei man keine zeitlichen Prognosen stellen kann, wie schnell sie fortschreitet, denn das ist von PatientIn zu PatientIn sehr unterschiedlich und individuell.
Erstsymptome im Kindesalter können unter anderem eine zunehmende Ungeschicklichkeit in der Bewegung von Armen und Beinen, eine Steifigkeit der Extremitäten, eine Abnahme der kognitiven Leistung, Verhaltensänderungen bzw. Verhaltensstörungen sowie epileptische Anfälle sein. Kinder mit Chorea Huntington leiden darüber hinaus häufig an Entwicklungsrückschritten, das heißt, dass bereits erlernte Fähigkeiten wieder verlernt werden. Dadurch kommt es häufig zu Problemen in der Schule, da die Kinder nicht mehr wie bisher dem normalen Unterricht folgen können. Mit fortschreitender Erkrankung können daher spezielle Maßnahmen notwendig werden, um erkrankten Kindern weiterhin den Schulbesuch zu ermöglichen. Wichtig dabei ist eine multidisziplinäre Betreuung der Kinder durch LehrerInnen, PsychologInnen, ÄrztInnen sowie Verhaltens-, und PhysiotherapeutInnen, LogopädInnen und ErnährungsberaterInnen.
Chorea Huntington schreitet über mehrere Jahre fort, wobei es meist zu zunehmenden Schwierigkeiten in der Kontrolle und Koordination von Bewegungen sowie zu einer fortschreitenden Demenz kommt. Wie schnell die Krankheit beim einzelnen Kind fortschreitet, lässt sich jedoch nicht vorhersagen.
Durch die chronische Erkrankung des Kindes, sowie die Ungewissheit bezüglich der Krankheitsentwicklung kann es zu einer erheblichen Belastung der Familie sowie der Betreuungspersonen kommen. Dabei können Selbsthilfegruppen für Familien mit chronisch kranken Kindern bzw. Kindern mit neurologischen Erkrankungen den Familien wertvolle Unterstützung bieten. Wichtig ist es auch die betroffenen Kinder selbst, sowie deren Geschwister – ans Alter angepasst – über die Krankheit zu informieren.
Monika Scheibl, Huntington Ambulanz, Psychiatrische Klinik, LKH Graz
Eines Tages kam der Dorfleiter zu mir und fragte, ob ich mir vorstellen könne, Sophie in meine Familie aufzunehmen. Viele Fragen stellten sich mir: „Wie gehe ich, wie gehen wir als Familie mit schwerer Krankheit um? Was mute ich meinen anderen Kindern zu? Aber was könnten wir durch Sophie vielleicht auch lernen? Was passiert mit Sophie, wenn ich in Pension gehe?“ Irgendwann kam ich an den Punkt, an dem ich dachte: so wie Sophie jetzt ist, kann ich mir gut vorstellen, dass sie Teil unserer Familie wird und alle anderen Schritte werde ich erlernen. Und um ehrlich zu sein, weiß ich bei keinem Kind, was kommt und wie sein Lebensweg verlaufen wird. Im Grunde genommen hatte ich schon bei der Frage des Dorfleiters innerlich zugestimmt.
Schwierig war für mich die Auflage, dass ich mit niemandem außer dem Dorfleiter und der Psychologin darüber reden sollte. Der Grund war, dass Sophie nicht durch Gerüchte erfahren sollte, dass sie in eine neue Familie kam. Auch sollte sie den wahren Grund ihres Familienwechsels nicht erfahren. Es war ein Versuch sie zu schützen, denn die Wahrheit schien unzumutbar. Wie sollte man einem Kind sagen, dass es aufgrund der von ihr gehassten Krankheit zum zweiten Mal die Familie verlor? Ich stimmte damit kaum überein, trug die Entscheidung aber mit. So waren mir die Hände gebunden, meine Kinder auf die Ankunft von Sophie gut vorzubereiten. Als Sophie dann kam, wurde sie mit wenig Begeisterung empfangen. Sandra und Julia, die beiden Kleinen, hatten sich jemanden gewünscht, mit dem sie „normal“ spielen konnten, und der fünfzehnjährige Michael und die schon aus dem Haus Entwachsenen hatten Angst, dass ich mich übernehme. Für Sophie war es unverständlich, dass sie nicht mehr in ihrer Familie leben konnte, sondern nun mit mir eine neue Mutter und Familie bekam. Gründe wie, die Kinder in der anderen Familie seien zu lebhaft und zu wild, waren für Sophie nicht nachvollziehbar, denn Julia und Sandra waren auch keine „Engerl“. Ich konnte es ihr nicht erklären, denn ich wollte nicht lügen. Es war mir aber auch nicht möglich ihr die Wahrheit zu sagen. Eine schwierige Situation. Heute würde ich anders handeln, aber damals war es mir und auch den anderen nicht möglich – leider.
Psychologische Aspekte in der Begleitung von schwerkranken Kindern und deren Angehörigen
Ein zentrales psychologisches Element in der Betreuung von schwerkranken, aber auch unheilbar erkrankten Kindern, besteht in der Frage der Aufklärung über die Krankheit. Dies ist oft der heikelste Punkt für alle Beteiligten – für Eltern, Geschwisterkinder und Betreuer.
Alle Kinder, insbesondere aber schwerkranke Kinder, wollen in der Regel größtmöglichste Offenheit, selbst über die Aspekte des Todes; Eltern wollen hingegen größtmöglichste Schonung des Kindes. Der daraus resultierende Konflikt besteht nicht erst beim Übergang von kurativer zu palliativer Therapie, sondern beginnt schon mit der Diagnoseeröffnung. Die Frage:
„Wie spreche ich mit einem sterbenden Kind?“ ist zu kurz gegriffen. Vielmehr muss die Frage lauten: „Wie ermögliche ich von Beginn der Behandlung an einen offenen Dialog mit dem Kind und den Angehörigen – auch über den gefährlichsten Aspekt der Erkrankung?“ Am Anfang ist ein Konsens aller Beteiligten wichtigstes Ziel.
Um mit dem schwerkranken Kind selbst einen offenen Dialog zu erreichen, ist das Wissen um die Entwicklungspsychologie von Sterben und Tod für die klinische Tätigkeit und die professionelle Betreuung des Kindes von entscheidender Bedeutung.
Ein weiterer zentraler Begriff im Verständnis von psychologischen Vorgängen um das schwerkranke Kind ist der der „antizipatorischen (vorgreifenden) Trauer“. Er bedeutet, dass das kommende (mögliche oder sichere) Sterben bzw. der Tod sowohl vom Patienten als auch den Angehörigen vorweggenommen wird. Bedingt durch das mögliche Sterben wird selbst bei günstiger Prognose ein innerer Prozess der Auseinandersetzung eingeleitet, der psychologisch gesehen nicht verhindert werden kann. Der mögliche reale Tod ist das Damokles-Schwert, unter dem sowohl die Patienten als auch die Eltern leben. Aus dieser vorgreifenden Trauer resultieren in der Regel für die begleitenden Angehörigen und Helfer leicht Schuldgefühle, da der Tod des Kindes dadurch vorweggenommen wird. Der ärztlichen Gesprächsführung kommt deshalb aus psychologischer Sicht in diesem Sinne herausragende Stellung zu, da das ärztliche Gespräch die Trennung von äußerer und innerer, seelischer Realität vornimmt. Die medizinische und psychologische Aufklärung klärt Inneres und Äußeres, trennt zwischen der Welt der Phantasie und der Welt der empirisch gewonnenen Fakten. Die Schuldgefühle können dadurch in der Regel gemildert werden.
Dr. Reinhard J. Topf, klinischer Psychologe, Psychotherapeut und Psychoanalytiker. Leiter der Psychosozialen Gruppe im St. Anna-Kinderspital in Wien sowie freiberuflich als Psychotherapeut und Supervisor tätig.
Sophie hatte ein sonniges und offenes Wesen und bekam viel Aufmerksamkeit. Sie zog Menschen durch ihre sympathische und strahlende Art in den Bann. Sandra und Julia waren eifersüchtig und meinten immer wieder „warum kann sie nicht im anderen Haus bleiben, warum muss sie bei uns sein?“ Das schmerzte Sophie, denn sie wünschte sich nichts sehnlicher, als wieder in ihrer „alten“ Familie leben zu dürfen. Die Mädchen waren manchmal gemein zu Sophie, was ihnen rundherum Ärger einbrachte und ihre Abwehrreaktionen noch verstärkte. Sie bekamen zu hören, dass sie Sophie verstehen und sie sich zusammenreißen sollten, denn sie seien schließlich gesund. Solchen Argumenten bin ich immer entgegengetreten, denn die beiden haben, wie alle Kinder, grundlegend ein Recht auf ein normales Leben, ohne schlechtem Gewissen gesund zu sein.
Der erste Wendepunkt in der Beziehung der Mädchen zueinander war der Besuch bei Sophies Mutter im Pflegeheim. Noch heute bin ich froh, dass ich die beiden mitgenommen habe. Als Julia und Sandra Sophies Mutter regungslos im Bett liegen sahen, merkte ich, wie sie plötzlich begriffen, dass es Sophie auch einmal so ergehen wird. Sie zeigten Mitgefühl für das Schicksal von Sophie und ihrer Mutter. Sandra nahm die Hand von Sophies Mutter und legte diese in die von Sophie. Ich bin mir sicher, dass sich ab diesem Moment die Einstellung der beiden Mädchen zu Sophie zu ändern begann.
Es war das erste und das letzte Mal, dass wir Sophies Mutter sahen. Einen Monat später starb sie. Sophie hat sich gewünscht, dass Sandra und Julia auch beim Begräbnis ihrer Mutter dabei waren – das hat die drei wieder ein Stück näher zusammengebracht.
Der Alltag war nicht leicht. Ich musste vieles dazulernen. Vor allem Geduld, die ich dachte bereits zu besitzen, aber Sophie lehrte mich etwas anderes. Bei ihr dauerte alles mindestens doppelt so lang wie bei den anderen Kindern. Ich wollte Sophie selber essen lassen, was viel länger dauerte, als wenn ich ihr geholfen hätte. Ich wollte sie sich selbst waschen lassen, sie alleine und selbstständig zu Ende reden lassen. Am schwersten ist mir gefallen, dass ich sie so schlecht verstehen konnte. Ihre sprachliche Ausdrucksfähigkeit war bereits stark beeinträchtigt und ich musste intensiv hinhören, damit ich begriff, was sie meinte. Und Sophie erzählte immer sehr genau und detailreich. Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich anfangs froh war, wenn sie schlief. Die viele Arbeit rundherum war bei Weitem nicht so anstrengend wie das konzentrierte Zuhören.
Geschwisterkinder
Es gibt wohl kaum ein Ereignis, das eine Familie so hart trifft, wie die lebensbedrohliche Erkrankung eines Kindes. Auch Geschwisterkinder sind dabei essentiell betroffen. Sie erleben nicht nur den drohenden Verlust des erkrankten Kindes, eines Spielkameraden und Partners, sondern auch den Verlust ihres vertrauten Alltags und eines Teils der elterlichen Verfügbarkeit auf unbestimmte Zeit. Die Entbehrung der primären Bezugspersonen ...