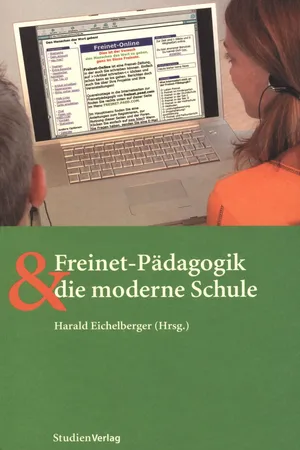![]()
Uschi Resch, Walter Hövel
Zur Bedeutung der Freinet-Pädagogik heute
„Das ist gewöhnliche Pädagogik: Ungefragte Antworten und unbeantwortete Fragen.“
Karl Popper
Zwischen Musterschule und Gegnerschaft
Die Freinet-Pädagogik gibt es seit 1920. Sie schafft es seit Jahrzehnten nicht zu veralten, sondern immer wieder bei der Schaffung der modernen „Modernen Schule“ mitzuwirken. Sie wird zusehends von Seiten der Wissenschaft als Beispiel gebend anerkannt und von Seiten der bildungspolitischen Entwicklungsplaner als zu untersuchendes Objekt betrachtet.
Hier taucht sie auf mit einer vorzeigbaren „Musterklasse“, dort mit einer „Modellschule“. An einigen Universitäten gibt es sie in antiquarisch-historischer Form, indem die Originalliteratur Freinets eingereiht wird in alte reformpädagogische Modelle, andere schicken ihre Studenten los, um jene „alternativen Unterrichtsformen“ zu erforschen, um die Frage disputieren zu lassen, ob sie wohl für die Regelschule geeignet wären1. In der Lehrerinnenbildung tauchen mit immer größerer Regelmäßigkeiten Begriffe und Techniken der Freinet-Pädagogik auf, wie etwa „Freie Texte“, „Verträge“, „Wiedererkennen in der Mathematik“, Klassenrat“, „Klassenämter“, der „Kreis“, „Freies Arbeiten“, die „Draußenschule“, und viele andere mehr. Andere Hochschulen richten Forschungsstellen ein, untersuchen sogar die heutige Praxis der Freinet-Pädagogik. Die Frage von Freinet-Studiengängen wird realisiert, die staatliche Organisations- und Qualitätsentwicklung von Bildung und Erziehung lässt forschen, die Lehrerinnenbildung bietet das Thema als „Zusatzqualifikation“ an.
Die Gegner der Freinet-Pädagogik wie die Kommunalpolitiker, die Freinet einst aus dem Schuldienst trieben, die Inspektoren und Schulräte, die bis in die 90er Jahre Freinet-Lehrerinnen und -lehrer als Chaoten und unfähig diffamierten, die Professoren, die vor Kuscheleckenpädagogik und antiautoritärer Werteverfall warnten, die Bildungspolitiker, die die Angsttrommel vor zu wenig Leistung und sinkendem Bildungsqualifikation rühren, scheinen sich weniger mit uns zu beschäftigen. Sie scheinen eigenen oder anderen Problemen nach zu laufen. Aber diese Gegnerschaft kann uns auch heute noch und wieder begegnen.
Woran liegt das?
Es sind in der Regel politische Gründe, denn die Freinet-Pädagogik ist durch und durch dehierarchisch, also ein Dorn im Auge aller in autoritären Kategorien denkender Menschen.
Die Freinet-Pädagogik arbeitet daran, lernenden Menschen ihre Macht über sich selbst zurück zu geben. Sie gibt den Menschen ihre eigene Verantwortung zurück. Sie organisiert die Aneignung der Fähigkeiten zur Selbstorganisation der lernenden Menschen. Systemisch ausgedrückt könnte das auch bedeuten, dass wir das Lernen Lernen lernen.
Sie ist immer als eine linke Pädagogik anerkannt worden, die sich von der Vision einer egalitären, libertären, kooperierenden Gesellschaft leiten lässt. Sie unterscheidet sich zumindest an zwei Stellen von veralteten „linken“ Vorstellungen. Sie folgt nicht der Idee einer „Zwangsbeglückung“ der Menschen in einem „besseren System“, sondern geht den Weg der Selbst-Organisation und Selbst-Befreiung der Menschen. Der zweite Unterschied ist der, dass solche „Visionen“ der Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung schon heute gelebt werden, wo und wann immer das möglich ist. Die Mitglieder der Freinet-Bewegung sind dabei an keine politische oder religiöse Weltanschauung gebunden.
Diffamierungen kamen und kommen aus dem Lager des Extremismus, aus dem Lager des faschistischen, fremdenfeindlichen oder anti-demokratischen Gedankenguts oder aus religiös-fundamentalistischen Kreisen.
Unverständnis ernten wir von solchen Menschen, die z.B. als Wissenschaftler in Descart’schen Denkgebäuden, oder Politikern, die in alten Links-Rechts-Schemata gefangen sind.
Schwierigkeiten der Vermittlung unseres Handelns haben wir bei Menschen, die aus gesellschaftlichen Ängsten und Unsicherheiten heraus, die Schule und ihre Selektion für wichtiger halten als die Entwicklung und das Leben ihrer Kinder.
Warum ist Freinet-Pädagogik so erfolgreich?
Ein entscheidender Grund ist der, dass sie zwei Dinge gleichzeitig tut, die sonst als Gegensätze angesehen werden: Sie organisiert für jeden einzelnen Lerner einen eigenen Lernweg, der einerseits uneingeschränkt die individuellen Interessen und Kompetenzen als Ausgangspunkt und Ziel hat, andererseits jedes Lernen in die Kooperation der eigenen Lerngruppe, als auch in die Kooperation mit der realen Umwelt einbettet. Demokratische Lern- und Arbeitstechniken ermöglichen die gegenseitige Befruchtung von individuellem und gemeinsamen Lernen.
Sie ist so erfolgreich, weil sie dem Lerner nicht defizitäre Bedürfnisse unterstellt, sondern alle seine Kompetenzen als Mittel des eigenen Lernens und Erkennens in verschiedenen Formen freisetzt und ihm seine Fähigkeiten als Arbeitsmittel bewusst macht. Mittel dieser Lernstrategien sind u.a. der freie Ausdruck, handlungsorientiertes ganzheitliches Lernen mit allen Sinnen, tastende Versuche, experimentelles Lernen, die Methode Naturelle, Techniken der verbalen und nonverbalen Kommunikation, selbstorganisiertes, geplantes, verbindliches Lernen in freier Kooperation.
Sie ist so erfolgreich, weil ihr Lernen ein systemischer Vorgang ist. Sie folgt nie einem starren System eigener Methodik und Didaktik. Jede Lerngruppe baut ihr eigenes, typisches Lernsystem auf. Dieses wird ständig durch die eigene Arbeit und die eigene systeminterne Evaluation korrigiert, sie wächst ständig durch die Übernahme neuer Lern- und Arbeitstechniken, die Freinet-Lehrerinnen und Freinet-Lehrer durch ihre professionelle selbstorganisierte Weiterbildung einbringen.
Das System „Freinet“ korrigiert sich ständig selbst, im Klassenrat, als Gespräch, im Kreis, in der Arbeitsplanung, der Präsentation, in der Freinet-Gruppe, auf Treffen, in Ateliers, durch die Kooperation mit Eltern.
Die Korrektur, die selbstkritische Veränderung der Lernprozesse ist für Freinetpädagogen nicht die Ausnahme, sondern Prinzip der Arbeit.
Wo können nun Probleme auftauchen?
Das häufigste Problem für Freinet-Pädagogen ist, wie bereits beschrieben, seit Anbeginn dieser Pädagogik die Diffamierung durch politische kommunale Kreise oder schulische Behörden, Vorgesetzte wie Schulleiter oder Inspektoren, die dann meist politisch motiviert sind oder der Unkenntnis dieser Menschen bezüglich der Funktionsweise dieser Pädagogik entspringen. Diese Ursache verschwindet mit zunehmender Reform des Schulwesens in den letzten Jahren mehr und mehr.
Ein zweiter Grund kann in Ängsten und Ressentiments von Eltern begründet sein. Der vorhandene gesellschaftliche Druck, den die Eltern bezüglich der Schulkarriere ihrer Kinder unter dem Aspekt schlechter Zukunftsperspektiven spüren, die eigene negative Schulerfahrung, die nicht verarbeitet wurde, können das Vertrauen in die Lernfähigkeit ihrer eigenen Kinder beeinträchtigen und dies kann auf die Schule übertragen werden.
Häufig wird das Kind gezwungen, zu Hause nach anderen Methoden als in der Freinet-Klasse zu lernen, zu pauken. Das Kind erfährt genau den Druck, den die Freinet-Pädagogik ablehnt. Das Kind verliert die Freude am Lernen, seine Leistungsbereitschaft, es beginnt schlechter zu lernen.
Der Kreislauf einer self-fulfilling prophecy beginnt zu wirken. Trotz Freinet in der Schule beginnt das Kind „schlechter“ zu werden. Zuhause hört das Kind das Schimpfen über die Schule, Beschwerden und Unterstellungen.
Meist reagieren die Kinder so, dass sie zunächst spürbar traurig werden. Sie ziehen sich zurück, distanzieren sich vom selbständigen Lernen und beginnen, vorgegebene Aufgabenstellungen einzufordern. Sie beginnen, „sich vor der Arbeit zu drücken“.
Da sie am Nachmittag oder am Abend zu Hause unter Druck lernen müssen, beginnen sie am Vormittag in der Schule zu „faulenzen“, zu „spielen“, „Unfug zu machen“. Sie versuchen einen Freiraum fernab vom Lernen zu erobern. Dies kann bis zur totalen Arbeitsverweigerung und zu aggressiven Handlungen führen.
Eltern sagen dann, „mein Kind lernt nichts in der Schule“, eine nachweisbare Behauptung. Sie wollen oder können nicht sehen, dass sie selbst die Initiatoren dieses Prozesses sein könnten. Freinet-Lehrer reagieren darauf nicht „mit dem Anziehen der Zügel“ oder der Devise „Daumen drauf“. Vielmehr suchen sie einerseits das offene, erklärende Gespräch mit den Eltern, andererseits mit dem Kind, einzeln oder in der Klassengemeinschaft. Sie versuchen, ihm Angebote zu machen, ihre traumatische Situation zu verarbeiten.
Sie empfehlen das freie Malen und Zeichnen, das freie Schreiben, kinderinterne „Sorgengesprächskreise“, das Führen geheimer „Sorgenbücher“, freien Ausdruck in Tanz, Musik- und Theaterspiel. Behutsam wird das Kind immer wieder zur systematischen, selbstverantwortlichen Arbeit aufgefordert, immer wieder wird es an kooperierende Arbeitsgruppen heran geführt. Es wird aber weder gezwungen, noch überredet, noch übertölpelt, im gleichen Maße, wie die allgemeinen Regeln in der Klasse auch von diesen Kindern eingehalten werden müssen. Das Kind und sein Problem werden ernst genommen, die Bewältigung des Problems ist nun seine wichtigste Lernaufgabe. Fatal sind hier Schulleitungen oder auch Kollegen, die die (hilflose, nicht professionelle) Forderung von Eltern nach mehr Druck auf die Kinder unterstützen. In solchen Situationen müssen Freinet-Lehrer oft die Unterstützung anderer schulischer oder außerschulischer Beratungspersonen suchen.
Zuerst muss immer dem Kind geholfen werden, nicht den Eltern. Sollten diese auch nach Gesprächen kein Vertrauen in die Lernweise der Freinet-Klasse gewinnen, können sie in den Unterricht der K...